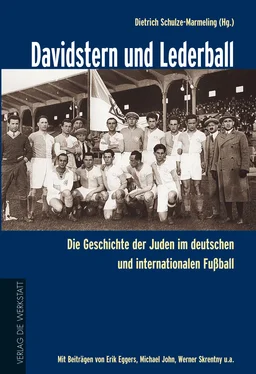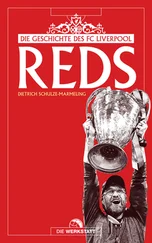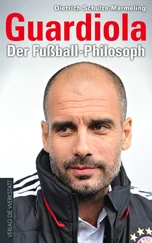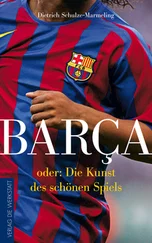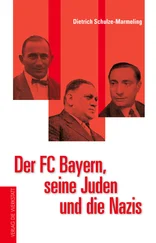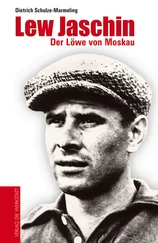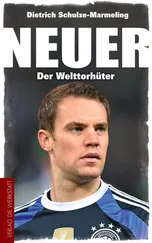Was der 20-jährige GI erfährt: Julius Leiserowitsch, der Vater von Simon und sein eigener Großvater, ist 1943 im KZ Theresienstadt umgekommen. Fritz Leiser (er hat den ursprünglichen Familiennamen verkürzt), ehemals Außenläufer und im Spielausschuss von TeBe, ist 1943 mit seiner Frau Amalia (geb. 1909) und Tochter Baschewa (geb. 1939), genannt »Schäfchen« bzw. »Schäfelein«, in Auschwitz ermordet worden. Für Ehefrau und Kind gilt das Todesdatum 7.3.1943, Fritz wird letztmals im August 1943 auf der Krankenstation gemeldet, dann verliert sich die Spur. Bertha, die Schwester von Simon, ist im Februar 1943 in Auschwitz vergast worden. Luise, die Schwester des Berliner Fußballstars, kam 1944 im KZ Theresienstadt ums Leben.
Die Flucht hat die Familie Leiserowitsch in viele Länder der Erde geführt. Miriam F. Leiseroff, Jahrgang 1944, nicht-eheliche Tochter von Simons erstem Sohn Günter (der als so genannter Halbjude Miriams Mutter Frieda in der NS-Zeit nicht heiraten darf), heiratet in die USA, tritt 1988 zum Judentum über und trägt seit 1998 in Anbetracht ihrer jüdischen Ursprünge den Nachnamen Leiseroff. Sie hat sich angeschickt, die Fäden der Familie wieder zusammenzuführen und war uns eine ausgezeichnete Informantin. »Es gelang mir, die Überlebenden der Leisero-witsch-Familie in verschiedenen Teilen der Welt zu finden«, sagt die Kali-fornierin.
Simon und Miriam Leiserowitsch überstehen die NS-Zeit wie geschildert in Palästina bzw. Israel. Simons Bruder Leopold, der Konzertmeister, hat die NS-Zeit im Versteck in Berlin überlebt. 1951 ist er in Berlin verstorben. Seine Tochter Ruth lebt heute in Italien. Simon Leiserowitschs zweiter Sohn, Manfred, wird vom zweiten Ehemann der Mutter, einem polnischen Katholiken, verborgen und mit der Mutter nach England gebracht, wo er sich Matthews nennt. Berthold, Sohn von Luise Rodmann, geb. Leiserowitsch (den Nachnamen Radmann musste man auf NS-Weisung ablegen, da er an einen »arischen« Beruf erinnere), emigriert nach Palästina. Er lebt anfangs bei seinem Onkel Simon Leiserowitsch, was darauf schließen lässt, dass dieser noch Kontakte zu den Geschwistern nach Berlin hatte. Nach dem Tod seiner Frau verbringt Simon den Lebensabend bei ihm. Siegmund, zweiter Sohn von Simons Schwester Luise, findet als »Staatenloser« mit Ehefrau Margot 1939 Asyl in Shanghai. Von China führt der Weg 1950 über Kanada nach Kalifornien, wo Sigi Rodman, wie er sich dort nennt, 1993 in Los Angeles verstirbt. Seine Frau Margot stirbt im Alter von 96 Jahren am 14.1.2003 in Las Vegas.
Und irgendwann schließt sich dann der Kreis zu den Fußball spielenden Leiserowitsch-Brüdern aus Berlin: Eric Leiseroffs Enkelin Emma nämlich, heute zwölf Jahre jung, spielt in den USA begeistert – Fußball!
Literatur
Berliner Tennis Club Borussia (Hrsg.): 50 Jahre Tennis Borussia. Berlin 1952.
Berliner Tennis Club Borussia (Hrsg.): Clubnachrichten vom Berliner Tennis-Club »Borussia« 1924-1928.
100 Jahre Tennis Borussia Berlin. Eine Chronik. Berlin 2002
Ticher, Mike: Jews and Football in Berlin, 1890-1933
Dank für Informationen an: Staatsbibliothek Berlin, Tennis Borussia Berlin, Jan Buschbom (Berlin), Eric Leiseroff (White Plains, USA), Miriam F. Leiseroff (San Jose, USA)
Das Buch »Liberation Day« ist nachzulesen als »A German/American Story« im Internet unter www.89infdivww2.org/ohrdurf/gram.htm. Im KZ Ohrdruf bei Gotha, einem Außenlager von Buchenwald, sah Eric Leiseroff die Verbrechen der Nazis mit eigenen Augen. Ohrdruf ist auch deshalb bekannt, weil dorthin die US-Generäle Eisenhower, Patton und Brad-ley kamen. Die Bilder gingen um die Welt.
Dietrich Schulze-Marmeling
»Das waren alles gute Leute« – der FC Bayern und seine Juden
Die Fußballer des FC Bayern begannen als rebellische Minderheit des Männerturnvereins München von 1879 (MTV 1879). Bereits 1897, drei Jahre vor der Geburt des FC Bayern, hatte sich eine Fußballabteilung im MTV konstituiert, die zur stärksten Kraft im Münchener Fußball avancierte.
Zu den Gründern gehörte auch der jüdische Fußballpionier und spätere Gründer der Fußballzeitung »Kicker«, Walther Bensemann. 1 Bensemann lebte damals »in jenem Viertel, wo die Schellingstraße und die Türkenstraße liegen« 2 , also in der Nähe der Universität und in Schwabing, der Heimat des späteren FC Bayern. Nur zehn Fußminuten von Bensemanns damaliger Unterkunft entfernt erhielt der FC Bayern 1901 an der Clemensstraße seinen ersten Platz. Der Wanderer Walther Bensemann verließ München zwar bald wieder, stand dem FC Bayern aber, wie noch gezeigt wird, später wiederholt zu Diensten.
Die Hauptleitung des MTV 1879 bezog eine skeptische Haltung zum Fußball. Doch nicht nur zwischen Turnern und Fußballern, sondern auch innerhalb der Fußballabteilung, eine Minderheit im Gesamtverein, kam es zu Spannungen. Die Fußballer spaltete die Frage, ob man weiterhin unter der Schirmherrschaft der Turner kicken oder sich dem Verband Süddeutscher Fußballvereine anschließen sollte.
Der Verband Süddeutscher Fußballvereine (ab 1914: Süddeutscher Fußball-Verband / SFV) war am 17. Oktober 1897 im Karlsruher Restaurant »Landsknecht« gegründet worden. Die dort versammelten Vereinsvertreter kamen aus Karlsruhe, Frankfurt, Hanau, Mannheim, Pforzheim und Heilbronn. Bayern und München waren indes nicht dabei, ein Manko für den jungen Verband und dessen ambitionierte Macher. Bereits 1898 wurde in Süddeutschland eine erste Landesmeisterschaft ausgespielt. Im Finale besiegte der Freiburger FC den Karlsruher FV mit 2:0.
Am 27. Februar 1900 fand eine Versammlung des MTV 1879 im Alt-münchener Gasthaus »Bäckerhöfl« an der Schäfflerstraße (unweit vom Marienplatz) statt, auf der die Anwesenden über ihr Verhältnis zum süddeutschen Verband zu entscheiden hatten. Als dort bekannt wurde, dass sich die Hauptversammlung gegen einen Beitritt zum Regionalverband der Balltreter ausgesprochen hatte, verließen elf Kicker aus Protest den Tagungsort. Die Rebellen zogen in das in der Fürstenstraße gelegene Gasthaus »Gisela« um und gründeten mit dem »Münchener Fußballclub ›Bayern‹« einen eigenständigen Fußballklub. Erster Vorsitzender wurde Franz John, Schriftführer Josef Pollack.
Klub der »Zuagroasten«
Der FC Bayern war, seinem Namen zum Trotze, alles andere als eine bayerische Veranstaltung. Seine Gründer waren ein buntes Gemisch aus Sachsen, Hanseaten und Preußen, darunter auch Juden. Der Klub sollte sich deshalb schon recht bald den Vorwurf einhandeln, ein Sammelbecken so genannter »Zuagroaster« zu sein.
Auch John und Pollack waren keine Einheimischen. Franz Adolph Louis John (1872-1952) war der Sohn eines Postangestellten. Johns Geburtsort hieß Pritzwalk und lag im Verwaltungsbezirk Potsdam. Mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder Georg zog John in das 9.000 Einwohner zählende Dorf Pankow am Rande Berlins, wo er sich dem am 18. September 1893 von Dr. Hermani, Leiter der damaligen Pankower »Höheren Knabenschule«, gegründeten VfB Pankow anschloss (heute: VfB Einheit Pankow). Georg John war von 1896 bis 1898 Vorsitzender des VfB, der im übrigen im Januar 1900 zu den Gründungsmitgliedern des DFB gehören sollte. Josef Pollack (1880-1958) war der Sohn des jüdischen Kaufmanns Edward Pollack. Pollack Junior war 1899 aus Freiburg nach München gekommen, wo er sich umgehend dem MTV 1879 anschloss. Zuvor hatte er beim Freiburger FC gekickt. Josef Pollack war auch auf dessen Gründungsversammlung am 17. Dezember 1897 im Freiburger Restaurant »Allgeier« anwesend gewesen, die Gustav Rudolf Manning zum ersten Präsidenten des neuen Klubs wählte.
Mit Gustav RudolfManning (1873-1953) verband den einige Jahre jüngeren Pollack nicht nur der Fußball, sondern auch die jüdische Herkunft. Manning war ein Sohn des aus Frankfurt/Main stammenden jüdischen Kaufmanns Gustav Wolfgang Mannheimer, der ein Unternehmen in der Londoner City besaß. Gustav Rudolf Manning wurde im Londoner Vorort Lewisham geboren. Während seines London-Aufenthaltes ließ Gustav Wolfgang Mannheimer den Familiennamen zu »Manning« »anglisieren«. Als die Mannings nach Deutschland zurückkehrten, ließen sie sich in Pankow nieder, dort, wo auch Franz John zu Hause war. Manning Senior wurde Spielwart des bereits erwähnten VfB, während Gustav Rudolf und sein älterer Bruder Friderich aktiv kickten. 1897 hatte das Medizinstudium Gustav Rudolf Manning nach Freiburg verschlagen. Im gleichen Jahr wurde Manning zum Schriftführer des Verbandes der Süddeutschen Fußballvereine gewählt. In dieser Funktion widmete er sich dem Aufbau des Verbandes in München, wo mit Franz John und Josef Pollack zwei gute Bekannte und Mitstreiter und somit Ansprechpartner für seine Pläne saßen.
Читать дальше