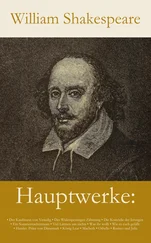Er kommt aber nicht. Er hat gerade seinen Arbeitsraptus, der sich etwa alle vierzehn Tage, drei Wochen wiederholt. Er sitzt mit Römer im Büro am Breitenbachplatz, zeichnet, entwirft, verwirft, verbessert. Es gibt Streit über jede Linie, über jede Treppenführung, über jedes Fenster vor allem, über jede Farbe. Sie haben immer zwei Meinungen, von denen Hammachers im Prinzip und Römers im einzelnen richtig ist.
Auch über die Frauen streiten sie sich nebenbei, weil Römer altgermanische Ansichten verficht, ohne ganz nach ihnen zu leben, und Hammacher sich zu keiner Meinung entschließen kann. Er meint nämlich, es gäbe für ihn keine Stellung zu den Dingen, sondern nur zu den Menschen. Dinglich reagiere er in der Architektur ab. Probleme erkenne er nicht an.
Er arbeitet von morgens Neun bis abends Zwölf. Danach trifft er sich mit Ellen im Café, sitzt eine Stunde mit ihr über Zeitungen oder wiegt den Kopf zu den Melodien der Kapelle, lächelt seine Frau an und erklärt, daß ihm das Leben gefällt. So und nicht anders. Am sechsten Tag wird er launisch. Am siebenten ist eine langweilige Gesellschaft beim Margarinedirektor, ein Gartenfest in einem weitläufigen Park, dessen Wege von Glühbirnenrabatten eingefaßt sind.
Mitten ins Fest fährt ein warmer Sturm, ein kalter Regen. Scharen von gelben Ahornblättern flüchten ins Dunkle.
Als Hammachers nach Hause fahren, ist es herbstlich kalt. Ellen muß seinen Mantel überziehen. Beim Aussteigen vor dem Haus sehen sie, daß die Grundmauern des Hauses vor dem Preußenpark schon aus dem Boden wachsen. Das Parterre ist beinahe fertig.
Sie sind beide unruhig und beklommen. Schließen die Tür zwischen den Zimmern. Liegen und hören den Herbstwind, der sogar in den Stadtstraßen noch Macht hat, den Herbstregen, der über die dünne Hauswand fließt, als liefe er über die Hand.
Um acht Uhr früh nach einer unruhigen Nacht, nach einem hastigen Frühstück, geht Hammacher statt in sein Atelier ins Kunstgewerbegeschäft von Prinz & Priester.
Er wird vom Lehrling Rüdwin mit Verbeugungen empfangen. Fräulein Schnee ist noch nicht da. Gut, er wird warten. Er setzt sich auf den Stuhl neben die Kasse. Er sitzt krumm, sein schwerer Wintermantel, den er zum erstenmal in diesem Jahr trägt, rutscht hoch und bauscht sich in großem Bogen um sein Kinn. Den steifen Hut hat er in den Nacken geschoben.
Er ist wütend. Was ist das? Was ist das? Er soll warten? Nein, er will doch nicht warten. Das hat er sich fest vorgenommen. Was macht er aber? Er wartet. Warum wartet er? Weil ihm ein kleines Mädchen eingefallen ist. Warum ist es ihm eingefallen? Weil das Leben langweilig ist und reizlos und unausgefüllt. Wird das besser werden durch Fräulein Schnee? Nein, es wird nicht besser werden durch Fräulein Schnee. Also!
Er schlägt knallend auf seine Mappe, so daß Rüdwin erschreckt hochfährt, springt auf und rennt zur Tür hinaus, um zehn Sekunden später mit Ira Schnee wieder einzutreten. Sein Gesicht glänzt wie sonniger Honig.
„Na ja“, sagt er, „na also, na guten Tag.“
Wenn Ira unterdes nicht soviel an ihn gedacht hätte, müßte sie ihn für verrückt halten. Aber so stürzt sie vergnügt in die Garderobe, den kleinen Wasch- und Ankleideraum vor dem W. C. der grau ist von der nahen Hausmauer und dunkel von der morgendlichen Arbeitsunlust der beiden Angestellten. Sie kämmt über die Haare, streicht schnell die Lippen himbeerfarben und himbeersüß und kommt lächelnd zurück. „Na ja“, antwortet sie, „na also. Da sind Sie ja.“
„Sie haben also an mich gedacht“, doziert Hammacher, und stößt sie mit dem Zeigefinger auf die Schulter.
„Ja, ich habe an Sie gedacht“, antwortet Ira ernst und nimmt den Zeigefinger weg. Sie möchte noch ein bißchen weibliche Schlauheit einlegen, ein Ritardando fraulicher Zurückhaltung. Sie ist ja eigentlich scheu, furchtsam. Es fällt ihr doch gar nicht leicht, sich einem Fremden anzuvertrauen oder (wie sagte man früher?) hinzugeben.
„Ja, ich habe an Sie gedacht“, wiederholt sie und es schießen ihr Tränen in die Augen. Sie ist so hilflos.
„Nur nicht so billig wegschenken“, hat die Kusine Dora von Pfeiffer gesagt, „wenigstens auf Preis achten, wenn schon nicht auf Tugend.“
Was ist nun wahr? Woran kann man sich halten? Ach, sie kann sich an kein Wort halten, an keine Moralvorschrift, an keine Regel, an keinen Menschen, an keine Erfahrung.
Sie hat die Hände auf die Hüften gelegt und streicht an sich herunter. So allein ist man. Rings herum einsam.
„Ich muß nun weg“, sagt Hammacher leise und zärtlich, „habe entsetzlich zu tun, wann sieht man sich?“
Ira zieht die Schultern hoch. Sie hat keine eigenen Worte. Kann immer nur Hammachers wiederholen.
„Wann sieht man sich?“ wiederholt sie, „heut abend?“
„Heute abend!“
„Bei Ira Schnee?“
„Bei Ira Schnee!“
Er verbeugt sich, küßt ihr die Hand. Sie verbeugt sich auch und wäre nicht Rüdwin, der ängstlich von der Leiter her die beiden beäugt, vielleicht würde sie dem Architekten die Maurerhand küssen.
Als Hammacher schon an der Tür ist, muß sie ihn nochmal zurückrufen.
„Warten Sie“, flüstert sie, „warten Sie, da ist doch noch ... ich habe da doch noch ... Sie können ja sonst gar nicht ...“
Sie läuft in die Garderobe, kramt in ihrem Täschchen. „Da ... nehmen ... Sie“, sagt sie und drückt ihm den Schlüssel in die Hand, den sie zehn Tage zuvor dem Freund abgenommen hat. „Er ist für die Hintertür. Sie müssen hinten heraufkommen. Ja leider. Es geht nicht anders.“
Rüdwin steigt schnell von der Leiter, schleicht auf knarrenden Sohlen ab. Sein Gesicht ist fahlgrün vor Eifersucht wie das eines Seekranken. Die beiden merken seinen Abgang nicht. Sie sehen sich an und lächeln. Es ist der einzig berauschende Augenblick dieser ganzen Begegnung.
Abends sitzt Ira wieder und wartet. Berta, die Köchin, glaubt daß sie sich mit dem früheren Freund verabredet hat. Es sieht im Zimmer auch genau so aus wie immer: Brötchen mit feingewiegtem Schinken stehen auf dem Tisch, zwei Teetassen, dieselbe halbe Flasche Asbach Uralt (sie ist noch nicht angebrochen), englische Zigaretten, eine Schale mit Weintrauben und Bananen, halb ertrunken unter roten Weinblättern und bunten Astern und sogar das Kleid ist das gleiche, ein beigefarbenes Nachmittagskleid, innen rosa, von oben bis unten zu knöpfen.
Um neun Uhr kommt Hammacher. Berta wird aufmerksam, die Schritte sind anders. Die Stimme ist nicht dieselbe, das Lachen ... na, der lacht ja von oben bis unten und wieder zurück, eine ganze Klaviatur. Berta ist ein bißchen böse. Sie hat keine großen moralischen Bedenken, aber kleine. So schnell darf das doch nicht gehen.
Obgleich sie todmüde ist, geht sie nicht schlafen. Der Wind weht Geruch von englischen Zigaretten ins Küchenfenster, Gesprächsfetzen. Was Männer eben so sagen. Dann Stille. Das Fenster wird geschlossen, der Vorhang vorgezogen. Es ist wirklich kalt. Berta holt sich das Tuch, setzt sich an den Küchentisch und wartet. Sie nickt ein und fährt um halb Zwölf hoch.
Die Tür nebenan hat sich bewegt, die Köchin schießt schlaftrunken in den Flur hinaus. Da steht Ira Schnee in ihrem braunen Abendcape mit dem Fuchskragen. Aber sie wird wohl nicht ausgehen. Denn sie trägt hellblaue Pantoffeln und keine Strümpfe. Und ein großer Mann hat den Arm um ihre Schultern gelegt, ein blonder Herr, ein schöner Herr, ein großer Herr im schwarzen Mantel.
„Guten Abend“, sagt Berta milder als sie gewollt hat.
„Guten Abend“, antwortet Hammacher und lacht freundlich.
„Das ist meine liebe Berta“, stellt Ira zitternd vor.
„So, das ist deine liebe Berta“, verbeugt sich Hammacher und reicht ihr die Hand. Wo er so fix die fünf Mark her hat, die er ihr in die Hand drückt, ist ein Rätsel. Aber jedenfalls hat er schnell und doppelt gesiegt.
Читать дальше