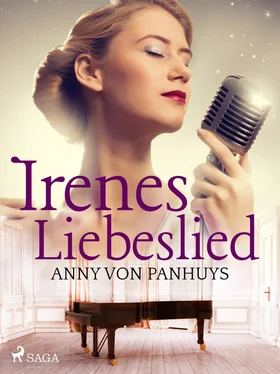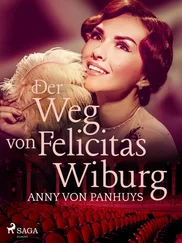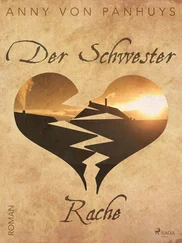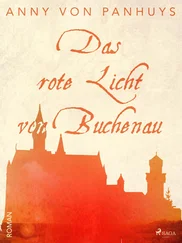Plötzlich sah sie vom Wald her eine in einen langen Mantel gehüllte Frauengestalt daherkommen. Soviel sie erkennen konnte, war es niemand von den Dienstboten. Sie wunderte sich, wer um diese Stunde noch nach Maxburg kam. Das nächste Dorf war mehr als dreißig Minuten entfernt, und es gehörte immerhin für ein weibliches Wesen Mut dazu, jetzt allein durch die einsame Landschaft zu gehen.
Die Frau blieb stehen, Irene sah es genau, ihre Gestalt verschwand dann hinter einer der ersten Föhren, nur ein schmaler, etwas dunkler Streifen bewies Irene, die Frau war noch da. Anscheinend wartete sie auf etwas.
Irene dachte, es wird die Liebste eines der Schloßangestellten sein, die ihren Schatz erwartet. Sie mußte lächeln. Da kam sie zufällig irgendeiner kleinen Liebesgeschichte auf die Spur, die noch dazu einen romantischen Anstrich hatte. Hätte sie nicht so gute Augen, würde sie die Frauensperson wohl überhaupt nicht bemerkt haben.
Irene vermutete, es würde nun jemand aus dem Hause kommen, zu der draußen Wartenden eilen. Doch niemand erschien, und es wurde dunkler und dunkler. Irene konnte nicht mehr unterscheiden, ob die Gestalt hinter dem Baum überhaupt noch da war.
Fast schien ihr alles eine Täuschung.
Vom See her strich ein kühler Hauch. Sie fröstelte, trat ins Zimmer zurück und schloß die Vorhänge.
Gleich darauf verbreitete das elektrische Licht weißlich ruhige Helle, und Irene vergaß, was ihr noch soeben romantisch erschienen. Sie setzte sich in einen alten, hochlehnigen Sessel, sann allerlei, und da sie sich müde fühlte, suchte sie bald ihr nebenan gelegenes Schlafzimmer auf. Es machte ihr jeden Abend aufs neue Vergnügen, das auf einer zweistufigen Erhöhung stehende wunderhübsch geschnitzte Bett zu besteigen, unter dessen schwerem, purpurdamastenem Himmel es sich so angenehm ruhte. Und wie immer schlief sie auch bald ein.
In ihren Traum aber schlich sich die Frauengestalt im dunklen Mantel, sie sah sie verschwinden hinter dem Föhrenstamm. Sie selbst stand auf dem Balkon, spähte angestrengt nach den von immer dichterer Dämmerung umwobenen Bäumen hinüber. Mit einem Male klang ein leises, wehes Weinen an ihr Ohr, kam aus der Richtung, wo die Fremde sich befand. Wie eintönig klagend das Weinen an ihr Ohr schlug, so trost- und hoffnungslos, schmerzlich und aufreizend und wehetuend, man hätte helfen mögen und trösten um jeden Preis.
Irene richtete sich jäh im Bett empor, lauschte, noch halb schlafbefangen, angestrengt und atemlos hinaus. Ganz starr war ihr Körper von gespanntem Lauschen. Und dann klopfte ihr Herz mit einem Male wie rasend. Das Weinen, das sie im Traum vernommen, war Wirklichkeit. Ein jammervoll trauriges Weinen drang an ihr Ohr durch die Stille der Nacht. Irgendwo im Schlosse weinte eine Frau.
Es klang nicht laut, aber es war Wirklichkeit.
Wer aber weinte so grenzenlos schmerzvoll in der Nacht, wer?
In diesem Stockwerk schliefen Littegarde und Herr von Kuffstein, aber deren Zimmer befanden sich ganz unten im Gang, wo er die Biegung nach dem linken Flügel machte, und wenn Frau Littegarde geweint hätte, würde man es hier kaum noch hören. Die Dienstboten schliefen fast alle im zweiten Stockwerk, bis auf ein paar, die im Erdgeschoß hausten, gewissermaßen Wachtposten versahen.
Immer noch hörte Irene das Weinen, aber es ward jetzt leiser und leiser.
Irene war seltsam zumute, ein Gefühl von Furcht lähmte ihr die Glieder, dennoch schüttelte sie das Gefühl ab. Irgendein Mitmensch war in Not, denn grundlos war solch wehes Weinen nicht, und da mußte sie sich überzeugen, ob sie Hilfe bringen könnte.
So erhob sie sich denn, warf einen Mantel über ihr langes Nachtgewand, schlüpfte in die Pantöffelchen und schloß, nachdem sie Licht gemacht, ihre Tür auf. Sehr leise tat sie es.
Nahe ihrer Tür befand sich ein Schalter der Flurbeleuchtung. Sie drehte ihn an, und das Licht von der Decke erhellte nun diesen Teil des Ganges.
Noch immer hörte Irene das Weinen, wenn auch nur noch sehr, sehr leise. Irene folgte der Richtung, woher es kam, und stand vor einer Tür still, die, soviel sie wußte, zu völlig unbewohnten Zimmern führte, zu Zimmern, die immer verschlossen gehalten wurden, wie die meisten hier im ersten Stock gelegenen Räume.
Ein leichter Schauer überrann Irene, denn ganz deutlich vernahm sie hinter der Tür noch ein letztes, krampfhaftes Aufschluchzen, hörte einen langen Seufzer, dem tiefe Stille folgte.
Irene legte das Ohr an die Türspalte, doch kein Laut, nicht das allerschwächste Geräusch verriet, daß jenseits des Holzes sich Leben regte.
Irene stand von Zweifeln befangen. Sollte und durfte sie an die Tür pochen, ihre Hilfe anbieten?
Wem Hilfe anbieten? Sie wußte ja gar nicht, wer die Weinende war.
Sollte sich Frau von Kuffstein in dem Zimmer befinden? Möglicherweise tat sie ihr gar keinen Gefallen, wenn sie sich meldete. Jemand, der heimlich in stiller Nacht weint, wähnt sich sicher unbelauscht, will ungehört und ungestört sein.
Noch schwankte Irene, was sie tun sollte, da vernahm sie ein entferntes Öffnen und Schließen einer Tür, nur matt und dennoch deutlich. Mit einem förmlichen Sprung war Irene wieder am Schalter und drehte das Licht blitzgeschwind aus. Der Knipser betätigte sich zum Glück geräuschlos, und Irene verschwand, mehr einer momentanen Eingebung als irgendeinem Nachdenken folgend, hinter einem schmalen, alten Schrank, der, etwas von der Wand abgerückt, gegenüber ihren Zimmern stand.
Kaum war sie verschwunden, kamen leichte tappende Schritte den Gang entlang, und Irene erkannte zu ihrer maßlosen Verwunderung Frau Littegarde von Kuffstein, die eine kleine Taschenlampe trug. Es mochte ungefähr ein Uhr sein, aber die Dame befand sich noch in derselben Kleidung, in der sie diesen Abend bei Tisch gesessen, und sie ging schnurstracks auf die Tür zu, hinter der Irene das Weinen vernommen.
Frau von Kuffstein war es also nicht, die geweint hatte.
Aber wer dann, um Himmels willen, wer war es dann?
Mit leichtem Knöchel, kaum vernehmbar, pochte Frau Littegarde an die Tür, die sich sofort wie von selbst öffnete. Gleich einem Spuk tauchte innen, hell beleuchtet von dem Scheinwerfer der Taschenlampe, ein todblasses, schönes Frauengesicht auf, von dichtem, schwerem Goldhaar umrahmt, zwei große und gramvolle Augen sah Irene, und dann war plötzlich alles verschlossen, totenstill und finster lag der Gang, und Irene eilte zurück in ihre Räume, riegelte sich ein, fürchtete sich plötzlich.
Wem gehörte das blasse, leidüberschattete, schöne Gesicht mit dem Goldhaar? Wer war sie, zu der Frau von Kuffstein mitten in der Nacht schlich, wer war sie, die in den unbewohnten Zimmern hauste?
Fröstelnd begab sich Irene wieder ins Bett, lag dann noch lange im Dunkeln wach. Draußen pfiff der Wind durch die hohen, alten Föhren, und es klang unendlich traurig. Aber das Weinen war verstummt.
Irene schlief mit dem Gedanken ein, es sei vielleicht gestern noch später, unerwarteter Besuch angelangt, als sie sich schon in ihr Zimmer begeben hatte. Beim Frühstück würde sie die fremde Dame kennenlernen.
Am andern Morgen lachte die Sonne durchs Fenster, gebärdete sich wie im Monat August, vergaß ihre Oktoberwürde. Irene erhob sich ein bißchen verschlafen und müde, das seltsame Erlebnis der Nacht hatte ihr nicht die rechte Ruhe gegönnt. Schnell wusch sie sich, kleidete sich an, und mit einem Gefühl von Neugier begab sie sich zum Frühstück hinunter ins Eßzimmer. Gleich nach ihr trat Herr von Kuffstein ein, kurz darauf seine Frau. Beide begrüßten die junge Hausgenossin wie allmorgendlich, und dann trug ein Mädchen Kaffee, Tee und Zubrot auf, ebenfalls wie immer, doch es erschien niemand weiter, und man erwartete auch niemanden, denn das Ehepaar begann zu essen, plauderte Gleichgültiges, und Irene begriff kaum noch, was sie in der Nacht gesehen und gehört. Gleich nach dem Frühstück eilte sie wieder nach oben, und als sie an der Tür vorbeikam, hinter der sie nächtens das Weinen vernommen, drückte sie auf die Klinke, doch die Tür öffnete sich nicht.
Читать дальше