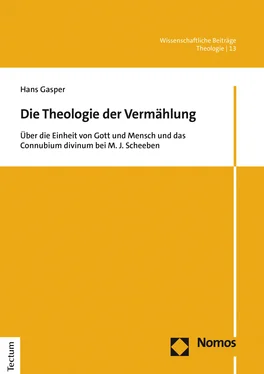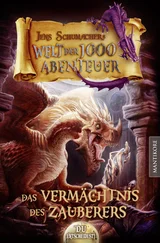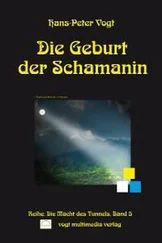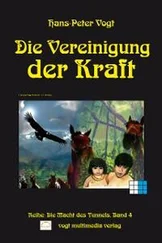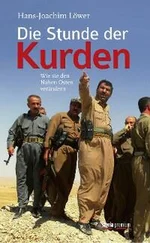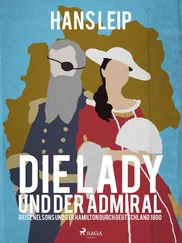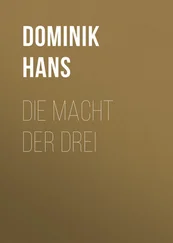Matthias Joseph Scheeben wurde am 1. März 1835 in Meckenheim in der Voreifel, ca. 20 km entfernt von Bonn, geboren. Sein Vater Wilhelm Scheeben (1792–1870) war wie Scheebens Großvater und Urgroßvater Hufschmied und man mag vielleicht in der Hartnäckigkeit und keine Mühe scheuenden Arbeit Scheebens, vorzüglich seiner Dogmatik, etwas von diesem Erbe spüren. 35Die Mutter Susanna, geb. Lützenkirchen (1806–1872), stammte aus der Nähe von Düren. Früh verwaist kam sie durch Vermittlung ihres Vetters, des Meckenheimer Oberpfarrers Peter Josef Clemens (1793–1872), nach Meckenheim und heiratete dort 1834 den in erster Ehe verwitweten Vater Scheebens. Clemens wurde der Patenonkel des erstgeborenen Matthias Joseph und ihm verdankt sich eine frühe Förderung des offensichtlich hochbegabten Kindes. Clemens hatte als Dechant des Dekanats Rheinbach (1833–1838) heftige Auseinandersetzungen mit einer Mehrheit von durch Georg Hermes in Bonn geprägten Pfarrern, die 1838 seine Wiederwahl als Dechant verhinderten. 36Scheeben erfuhr so möglicherweise schon von seinem Patenonkel und Förderer etwas über eine jener theologischen Strömungen des 19. Jahrhunderts, die mit »großer geistiger Kraft«, aber in zu großer Abhängigkeit von der »protestantischen Zeitphilosophie« und ohne Kenntnis der kirchlichen Tradition, so Scheeben, einen von ihm abgelehnten Weg gegangen waren (vgl. D I n 1112). Clemens unterrichtete sein Patenkind in Mathematik und alten Sprachen, so dass Scheeben, nach Besuch der Meckenheiner »Elementarschule« und des Progymnasiums im nahen Münstereifel, mit 17 Jahren am Kölner Marzellengymnasium, dem früheren Jesuitengymnasium (bis 1773), »Tricoronatum«, heute Dreikönigsgymnasium (jetzt nicht mehr in der Marzellenstrasse) das Abitur machte. Scheeben war damit bereits für kurze Zeit in jener Stadt und auch jener Strasse, die von 1860 an für fast 30 Jahre sein Lebensmittelpunkt sein sollte, in der Marzellenstrasse in Köln, unweit des Doms, mit dessen Fertigstellung in jenen Jahren begonnen wurde.
Unmittelbar nach dem Abitur 1852 wurde Scheeben zum Studium nach Rom geschickt, war Alumne des Germanicum und Student am Collegium Romanum. Es war ein Rom nach dem Sturm und vor dem Sturm. Während der Revolution in Rom und der dann etablierten Römischen Republik (1848–49) floh Papst Pius IX nach Gaëta und kehrte erst 1850 nach Rom zurück, die letzten zwei Jahrzehnte des Kirchenstaats. Auch Scheebens Lehrer der sog. »Römischen Schule«, Giovanni Perrone und Carlo Passaglia, hatten Rom verlassen müssen und waren nach England gegangen, was auch zur, für Perrone erneuten, Begegnung mit John Henry Newman (1801–1890) führte. Vor dem Sturm heißt, dass der Kirchenstaat, vor allem in den 60er Jahren, also nach Scheebens Zeit in Rom, allmählich vom sich ausbreitenden Königreich Italien stranguliert wurde, bis zu seinem Ende 1870. Wegen seiner Haltung zur weltlichen Macht des Papstes, ähnlich der Rosminis, musste Scheebens Lehrer Passaglia Rom verlassen und lebte fortan, suspendiert und exkommuniziert bis zu seinem Tod in Turin (s. zum Ganzen u. Römische Schule). Bereits in Rom muss sich Scheeben ein umfassendes theologisches Wissen angeeignet haben. 37Dies wurde auch befördert durch seine Aufgaben als Bibliothekar des Germanicum, wo er u.a. auch für Einstellung neuerer deutscher Theologie Sorge trug (z.B. Möhler, Kuhn, Staudenmaier, Berlage). 38Im Jahre 1854 war Scheeben Zeuge der Dogmatisierung der Immaculata Conceptio, an deren Vorbereitung seine römischen Lehrer maßgeblichen Anteil hatten. Kerkvoorde nennt unter den Ereignissen, die in Rom Scheeben besonders beeindruckt haben werden, an erster Stelle »die Definition des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis am 8. Dezember 1854.« Er weist auf die lebenslange tiefe Verehrung Mariens durch Scheeben hin. 39Ihr habe er sein erstes Buch geweiht (consacra) und ihr einen wichtigen Platz in seiner Dogmatik reserviert. 40Scheeben wurde am 18. Dezember 1858 durch Kardinal Patrizi zum Priester geweiht und feierte seine erste Hl. Messe in der Christnacht 1858, d.h. nach damaligem Usus die erste Messe in der Frühe des Weihnachtstages, in Santa Maria Maggiore.
Als Doktor der Philosophie und Theologie kehrt Scheeben Juli 1859 nach Deutschland zurück. In seinen Briefen ganz besonders der ersten 10 Jahre nach Rom an den Rektor des Germanicums P. August de Lacroix, vor allem den Spiritual P. Franz Xaver Huber (1801–1871) sowie an das Kolleg insgesamt erfahren wir einiges über Scheeben, seine Sicht der Dinge, seine Pläne, seine Lebhaftigkeit und immer wieder auch seine labile Gesundheit. Sein Vater erwartet ihn in Remagen mit dem 1853 geborenen, »noch niegesehenen (sic!) Brüderchen Heinrich.« 41Die Schilderung der (teils nur beabsichtigten) Besuche auf dem Weg dorthin sagt etwas über das Zusammengehörigkeitsgefühl der »Römer«, »Würzburger« und der »Mainzer«. 42Die lebhafte Art, in der Scheeben eine Wallfahrt nach Kevelaer schildert, zeigt nicht nur seine Absicht, »mit Maria wie mein Priestertum, so auch den Eintritt in die Welt zu beginnen«, es wird auch etwas davon deutlich, dass die Rede vom »stets heiteren Rheinländer« nicht aus der Luft gegriffen ist. 43In dem sehr ergiebigen Festschriftbeitrag von Johannes Hertkens aus dem Jahr 1892 wird nicht nur Scheebens geistliche und menschliche Lauterkeit bezeugt, sein Eifer für die Wissenschaft und seine Sorge um das Heil der Menschen, sondern dort liest man auch, er sei »eine echt rheinische Frohnatur« gewesen, habe einen »ausgeprägt gemütlichen, humoristischen Zug« gehabt, er »scherzte und lachte gern«. 44
Am 25. August 1859 wird Scheeben Rektor an der Klosterkirche der Salvatorianerinnen in Münstereifel, seine Kusine Ursula Scheeben (1818–1909) war dort Oberin, und Religionslehrer an deren Lehranstalt. 45Bereits April 1860 wird er zunächst Repentent, dann Professor am Erzbischöflichen Priesterseminar in der Marzellenstrasse in Köln, dem ehemaligen Kolleg der Jesuiten, heute Generalvikariat. Er nimmt an den Sitzungen des Kölner Provinzialkonzils (1860) teil und wirft sich gleich auf die Arbeit.
Vor allem seine frühen Arbeiten finden einen Niederschlag in den Briefen. Von Johann Baptist Heinrich (1816–1891), einem der Protagonisten des »Mainzer Kreises«, angeregt, schreibt er seinen ersten größeren Aufsatz 1860 über das Übernatürliche für den »Katholik«. 46Dieser dient ihm zugleich als eine Art ihn nicht befriedigender Fingerübung für »Natur und Gnade«. Er habe diese Schrift noch einmal zurückgezogen, denn die Rückmeldung auf seinen Artikel habe ihm gezeigt,
»daß meine Sprache, wenn auch richtig, so doch zu fremdartig für die Deutschen sei. Urteilsfähige Männer, die den Verfasser nicht kannten, glaubten ihn von einem Ausländer oder einem Jesuiten, der noch nicht in die deutsche Bildung eingeschlossen sei.« 47
Damit wird etwas für Scheeben Bezeichnendes sichtbar. In der Sache steht er zu seinem Artikel, ist er Partei, aber er möchte, dass die verhandelte Sache nicht schon deshalb chancenlos ist, weil sie einem bestimmten Lager zugeordnet wird. So erscheint »Natur und Gnade« erst 1861. Mit Freude und einem gewissen Stolz weist er zugleich auf die bald erscheinenden »Marienblüthen« hin. 48Mehrfach wird in den Briefen die Sorge erkennbar, durch unnötige Schärfe oder provokative Aktionen Fronten aufzubauen oder zu verhärten, so im Umgang mit Döllinger oder mit Blick auf die damals sehr kämpferische Zeitschrift der italienischen Jesuiten »La Civiltà Cattolica«. Hier empfiehlt er einen auch Döllinger tangierenden Artikel »con pace« zu schreiben. 49Seine Bemerkungen zu Kuhn zeigen beide Seiten. Er kritisiert Kuhn deutlich, lobt ihn aber ebenso. 50Scheeben steht zwar grundsätzlich auf der Seite der »Römer« und »Neuscholastiker«, versucht aber die Motive der »deutschen Theologie« aufzugreifen und eigene Lösungen zu finden (s. folgendes Kapitel).
Читать дальше