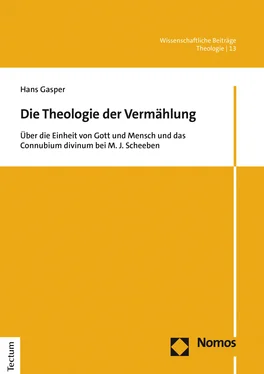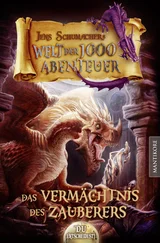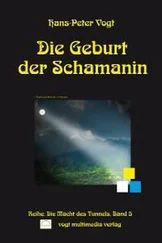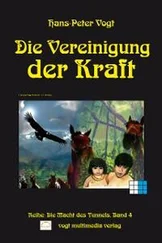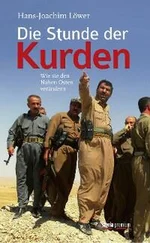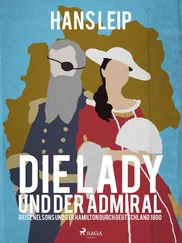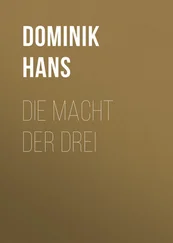Hans Gasper - Die Theologie der Vermählung
Здесь есть возможность читать онлайн «Hans Gasper - Die Theologie der Vermählung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Theologie der Vermählung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Theologie der Vermählung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Theologie der Vermählung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die Theologie der Vermählung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Theologie der Vermählung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nur an zwei Stellen übrigens kommt Scheeben in seinen Briefen auf Motive seiner Vermählungstheologie zu sprechen. Er verteidigt, dass er in den »Mysterien« von der »Brautstellung der Vernunft« gesprochen habe. Die Väter hätten dies »unzählige Male« von der menschlichen Natur gesagt, deren Teil doch die Vernunft sei.
»Viel höher wird die Vernunft gehoben, wenn ich sie Bräutigam (sic!) der ewigen Weisheit sein lasse.« 88
In einem der Briefe an Herder spricht er, wie eben erwähnt, von Maria als der »mater gratiae«. In der Dogmatik ist, jedoch mit Blick auf den Heiligen Geist, die Rede von der »gratia mater« bzw. der »maternitas gratiae«. (D VI n 28) 89Natürlich wird man diese Bemerkung in einem Brief nicht auf die dogmatische Goldwage legen dürfen, sie ist aber, wie sich zeigen wird, signifikant für den Zusammenhang der Mütterlichkeit des Heiligen Geistes sowie der Gnade und der Mütterlichkeit der Gottesmutter.
Als Scheeben mit 53 Jahren starb, lag hinter ihm ein überaus arbeitsames Leben. Die detailliierte Bibliographie ist ein beredtes Zeugnis. 90Neben den Hauptwerken stehen zahlreiche Artikel in Zeitschriften, teils von ihm herausgegeben (Periodische Blätter, Pastoralblatt), 36 Artikel für das »Kirchenlexikon«, kleinere Texte, Bearbeitungen oder Gelegenheitsarbeiten (z.B. die Herausgabe der »Hauspostille« von Goffine). Schön ein Beitrag des langjährigen Chefredakteurs der »Kölnische (n) Volkszeitung« (heute Kölnische Rundschau), Hermann Cardauns (1847–1925), zum Arbeitszimmer Scheebens im Kölner Priesterseminar in der Marzellenstrasse: »ein großes, niedriges Zimmer. Ein Arbeitstisch, vor einem alten Sopha, ein zweiter Tisch mit Büchern beladen, Büchergestelle an allen Wänden, Bücher auf einem Lesepult, auf Stühlen und Fensterbänken …« 91Scheeben bezeichnete sein Arbeitszimmer als seine Schmiede, entsprechend dem Beruf des Vaters. Mit Schnütgen, Kölner Domkapitular, Sammler mittelalterlicher Kunst, Namensgeber des Schnütgen-Museums, dem Privatgelehrten von Thimus, dem wie Thimus Zentrumspolitiker Reichensperger, Domkapellmeister Koenen gehörte Cardauns zum Kölner Freundeskreis von Scheeben. 92
In allen Nachrufen wird Scheebens universale Gelehrsamkeit gerühmt, zugleich seine Frömmigkeit – Scheeben, den Rosenkranz in der Hand hat sich offensichtlich nachhaltig der Erinnerung eingeprägt 93– seine Tätigkeit als Beichtvater in St. Mariä Himmelfahrt, der alten Jesuitenkirche, seine menschlich offene Art, die es auch gelassen hinnahm, dass die Alumnen des Priesterseminars mit seinen Vorlesungen oft wenig anzufangen wussten. Von seinem Humor war schon die Rede, bezeichnend ist seine Hilfsbereitschaft, so hat Scheeben Honorare. dafür verwandt, in Not geratene Familienangehörige zu versorgen. 94Scheeben starb am 21. Juli 1888 im St. Vinzenzhospital, dort, wo heute das Maternushaus steht, an einer Lungenentzündung. An seinem Sterbebett stand ein kleines Altärchen mit einer Nachbildung des Kölner Gnadenbildes aus der Kupfergasse. 95Scheebens Grabmal auf dem Friedhof Melaten trägt die Inschrift: Matthias Joseph Scheeben: integritate vitae, doctrina, scriptis eximius. 96
2.2. Theologiegeschichtliche Einordnung
Zur theologiegeschichtlichen und geistesgeschichtlichen Zuordnung sind besonders die Arbeiten von Eugen Paul, Karl-Heinz Minz, Wolfgang W. Müller und Christoph Binninger unverzichtbar. 97
2.2.1 Erster Überblick
Wer aus Kindheit oder Jugend noch die erste Station der Fronleichnamsprozession im Ohr hat – ja, im Ohr –, den Anfang des Matthäusevangeliums, auf Latein natürlich, das geheimnisvolle immer wieder wiederholte »Abraham genuit Isaac, Isaac autem genuit Judam …«, um so geheimnisvoller, je weniger man es schon verstand, der wird Freude haben an der theologischen Einordnung Scheebens durch Yves Congar: »Möhler genuit Passaglia, Passaglia genuit Schrader; Passaglia et Schrader genuerunt Scheeben et Franzelin.« 98Damit weiß man schon etwas über Scheebens theologische Herkunft. Carlo Passaglia (1812–1887), sein Schüler, später Kollege und enger Mitarbeiter und Freund Clemens Schrader (1820–1875), der spätere Kardinal Johann Baptist Franzelin (1816–1886), hinzuzunehmen wäre noch Giovanni Perrone (1794–1876), der Gründervater der sog. »Römischen Schule«, Jesuiten alle, Lehrer und Schüler am »Collegium Romanum«. Dort studierte Scheeben, von 1852–1859 in Rom als Alumne des Collegium Germanicum et Hungaricum und Studierender am Collegium Romanum. Vielfach wird Scheeben heute der Traditionslinie der »Römischen Schule« zugeordnet. 99Wieweit das zutrifft, wird gleich zu fragen sein. Mit der »Römischen Schule« kommt eine weitere Traditionslinie in den Blick, die sog. »Tübinger Schule«, und vor allem deren wahrscheinlich größter Theologe, Johann Adam Möhler (1796–1835). Der Blick wird noch einmal etwas geweitet durch zwei große Namen französischer Provenienz, die für die »Römische Schule«, ganz besonders für Passaglia und Schrader wichtig waren, aber darüber hinaus auch für Scheeben, der Jesuit Denis Pétau, latinisiert Dionysius Petavius (1583–1652), und der Oratorianer Louis Thomassin (1619–1695). 100In seiner wohl wichtigsten ekklesiologischen Arbeit »De Ecclesia« nennt Passaglia diese beiden sowie Möhler als Zeugen einer Einwohnung des Heiligen Geistes, er spricht von »splendidissima testimonia«. Passaglia bedient sich dabei genau der Denkfigur, die sich später auch bei Scheeben findet, Verbindung von inhärenter Form und Quasi-Information. 101Petavius und Thomassin werden in Scheebens Theologiegeschichte entsprechend gewürdigt. 102Und mit dem Oratorianer Thomassin kommt auch der spätere Kardinal Pierre de Berulle (1575–1629) in den Blick, Gründer des Oratoriums in Frankreich, als Begründer der sog. »École française (de spiritualité)«, Vertreter einer weiteren für Scheeben wichtigen Tradition. Er würdigt ihn unter der Rubrik »Mystische Theologen.« 103Vertreter der »Mystischen Theologie« sind ein wesentlicher Strang in Scheebens Theologie (Scheeben als »Mystiker« der Neuscholastik, A. Eröss). Dazu später. 104
Mit den hier und von den hier Genannten ausgehend lässt sich schon ein Gutteil der für Scheeben wichtigen theologischen Einflüsse und Themenfelder erschließen. Auch die für Scheeben ganz wichtige Mariologie ist über den Kontext der »Römischen Tradition« erreichbar, vor allem über die maßgeblich an der Vorgeschichte der Dogmatisierung der Immaculata Conceptio beteiligten Perrone und ganz besonders Carlo Passaglia. Wie schon früher erwähnt fand die Dogmatisierung 1854 während Scheebens Zeit in Rom statt. Perrone und vor allem Franzelin gehören zur unmittelbaren Vorgeschichte des 1. Vatikanischen Konzils (1869/70). Das Konzil, seine Vorgeschichte, seine Entscheidungen, nicht zuletzt die beiden Papstdogmen und die Auseinandersetzungen darum, sowie die bittere Nachgeschichte des Kulturkampfes sind ein wichtiger Fixpunkt in Scheebens theologischer Biographie. Mit dem Konzil ist ein weiterer wichtiger Konzilstheologe zu nennen, wichtig auch für Scheeben und ihm ebenfalls von Rom vertraut, Josef Kleutgen (1811–1883), Jesuit auch er. Mit Kleutgen kommt jener Traditionsstrang in den Blick, mit dem Scheeben oft und am stärksten identifiziert wurde, die Scholastik bzw. die Neuscholastik. Noch Hans Urs von Balthasar schreibt in seinem schönen Essay: Scheeben, »der aus Rom den Schulthomismus heimbrachte«, was einen etwas einseitigen Blick auf Scheebens (neu) scholastische Lehrstücke insinuiert. 105Natürlich gehören sie auch zu Scheebens geistigem Gepäck, aber sie machen nur einen Teil aus bzw. sind bei Scheeben anders sortiert. 106
2.2.2 Römische Schule
Bleiben wir noch etwas bei den genannten Traditionssträngen. Zunächst die »Römische Schule«. 107Der Begriff stammt wohl von dem um die »Römische Schule« wie um die Scheeben-Forschung hochverdienten Aachener Theologen Heribert Schauf (1910–1988). 108In der Diskussion ist, wieweit man sich bei dieser Etikettierung auf die oben Genannten vier, Perrone, Passaglia, Schrader und Franzelin, beschränken solle, oder ob man auch deren Schüler miteinbeziehen sollte. Dann wird auch immer Scheeben genannt. 109Schauf ging es um Dreierlei: Er wollte die Leistung der Hauptvertreter der »Römischen Schule« zu Bewusstsein bringen, nicht zuletzt die Bedeutung Passaglias. In der Frage der Einwohnung des Heiligen Geistes wollte Schauf herausstellen, wieviel die »Schüler«, er nennt Hugo Hurter (1832–1914), Joseph Hergenröther (1824–1890), Johann Baptist Renninger (1829–1892), Ferdinand Alois Stentrup (1831–1898), Scheeben und Franz Hettinger (1819–1890), alle »Römer«, hier vor allem Passaglia verdanken. Damit wollte er u.a. an die Adresse des Scheeben-Bewunderers Martin Grabmann zeigen, dass auch Scheeben nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern in einer wichtigen Traditionslinie steht. 110Es empfiehlt sich wohl pragmatisch zu unterscheiden zwischen der »Römischen Schule« im engeren Sinn und denen, die ihre Schüler waren und von ihnen wichtige Impulse erfahren haben, aber wie Scheeben keine »Schule« im eigentlichen Sinn weitergeführt haben. Ich beschränke mich hier auf die vier oben Genannten. 111Und unter ihnen bilden den harten Kern Passaglia vor allem und sein fast alter Ego, jedenfalls in der Zeit ihres gemeinsamen Wirkens am Collegio Romano, Schrader. Perrone hat ein eigenes Profil und ebenso Franzelin. Perrone habe, so Walter Kasper, mehr die Voraussetzungen für den mit der »Römischen Schule« verbundenen Neuanfang geschaffen. Er sei mehr der »traditionellen, apologetisch und – wenigstens was die äußere Form der Darstellung angeht – scholastisch bestimmten, positiven Theologie« beizuzählen. Er habe aber neuen Fragen gegenüber eine »große Aufgeschlossenheit« gezeigt, verwertete weitgehend »die positiven Neuansätze der Theologie seiner Zeit« – hier ist besonders Johann Adam Möhler zu nennen, er war auch befreundet mit John Henry Newman – »so daß seine Schüler ohne seine Vorarbeit nicht zu denken sind und ihm entscheidende Impulse verdanken.« 112Scheeben schreibt über ihn und seine »Prälectiones«, die eigentlich nur die Kontroverstheologie enthielten, sie besäßen »das große Verdienst und die Ehre … bei ihrer großen Verbreitung fast in der ganzen Welt, das kirchliche Bewußtsein geweckt und die Luft gereinigt zu haben.« (D I n 1116). Scheeben hat hier sicher besonders die kritische Auseinandersetzung mit Georg Hermes (1775–1831) im Blick. Scheeben erwähnt an dieser Stelle auch den Letzten der hier genannten Theologen und sein Werk, »die in einzelnen Traktaten erscheinende Theologie des zu Rom dozierenden deutschen (sic!, H.G.) Jesuiten Franzelin … welche weit mehr durchgearbeitet und zugleich spekulativer ist als die von Perrone.« (ebd.) 113Walter Kasper: »Franzelins Werke verbinden die positive Theologie mit der systematischen Durchdringung. Hier ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber Passaglia/Schrader ersichtlich. In der positiven Theologie verwendet Franzelin die Schrift und die Väter kritischer, während er der philosophischen Durchdringung einen größeren Raum einräumt als Passaglia.« 114Er habe Möhler, Drey, Denzinger, Hettinger, Hergenröther und Döllinger benutzt und es seien ihm sowohl die Väter als auch die nachtridentinische Theologie vertraut gewesen. 115– Solches könnte man, nebenbei gesagt, auch von Scheeben sagen. Dies gelte vor allem von seinen »klassisch zu nennenden Traktaten »De divina Traditione et Scriptura« und »Theses de Ecclesia Christi«, worin »die Gedanken seiner Lehrer Passaglia und Schrader nachgewirkt und zugleich einen abschließenden klassischen Ausdruck gefunden« hätten. 116Wegen seiner Verdienste nicht zuletzt als einer der maßgeblichen Konzilstheologen wurde er 1876 zum Kardinal erhoben.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Theologie der Vermählung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Theologie der Vermählung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Theologie der Vermählung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.