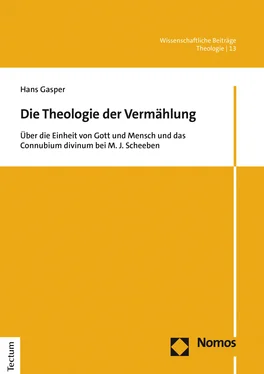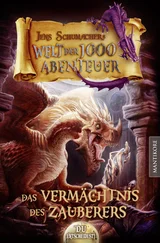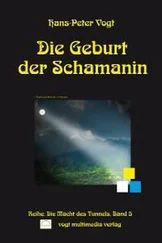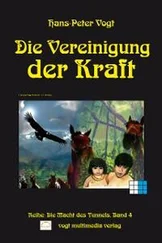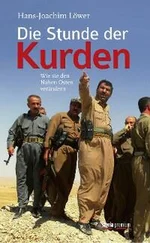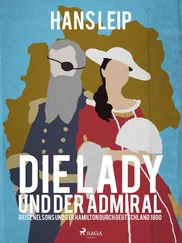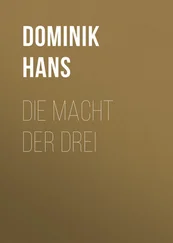Hans Gasper - Die Theologie der Vermählung
Здесь есть возможность читать онлайн «Hans Gasper - Die Theologie der Vermählung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Theologie der Vermählung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Theologie der Vermählung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Theologie der Vermählung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die Theologie der Vermählung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Theologie der Vermählung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Wie arbeitsreich diese ersten Jahre sind, zeigen die Hinweise auf die beginnenden Lehrverpflichtungen und seine ersten Arbeiten. Ganz offensichtlich ist ein besonderer Favorit dabei Nieremberg, der Ausgangspunkt eines eigenen Werks, die »Herrlichkeiten«. 51Neben Nieremberg ist ein Hinweis noch aus der Zeit in Münstereifel auf den Hoheliedkommentar des Jesuiten Ludovico de Ponte (Luis de la Puente. s. folgendes Kapitel) aufschlussreich. Er habe ihn bei seinem Onkel gefunden, d.h. bei Pfarrer Clemens, und er habe ihm schon »beim Predigen gute Dienste geleistet«. 52Scheeben publiziert sozusagen ständig, neben ausführlichen Beiträgen für den »Katholik«, meist Vorstufen für seine »Mysterien«, neben kleineren Gelegenheitsarbeiten die »Marienblüthen« (1860) und dem »Casini« (1862), natürlich vor allem »Natur und Gnade« (1861) und »Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade« (1862). 53Dieses Werk mit insgesamt vier Auflagen bis 1885 lag Scheeben besonders am Herzen und war sein erstes bei Herder erschienenes Buch. Von 1861 bis 1863 als Beiträge im »Katholik« vorbereitet erschienen 1865 »Die Mysterien des Christentums«, zusammen mit der ab 1874 erscheinenden Dogmatik ohne Zweifel Scheebens Hauptwerk. 54Hier findet sich, vor dem Hintergrund der emphatischen Gnadentheologie von »Natur und Gnade« und den »Herrlichkeiten«, seine Sicht des »nexus mysteriorum«: Trinitarisierung, Christozentrik und besonders wichtig angesichts der nicht vollendeten Dogmatik seine weit nach vorn weisende Lehre von der Eucharistie und seine sakramental begründete Ekklesiologie. 55Die Motive der »Vermählungstheologie« sind alle präsent, die Systematisierung findet in der Dogmatik statt.
In gewisser Hinsicht schließt mit den »Mysterien« die erste Tätigkeits- und Publikationsphase Scheebens. Die Teilnahme 1863 an der unter der Ägide Döllingers stehende »Münchner Gelehrtenversammlung«, auf der Scheeben mit weiteren sieben prominenten Theologen gegen Döllinger zur Opposition gehörte, war ein Vorgeschmack auf die Auseinandersetzungen um das 1. Vatikanische Konzil (1869–1870). 56Bemerkenswert, wie Scheeben auch hier dafür wirbt, die Dinge nicht unnötig anzuheizen (gemeint sind die Münchner Nuntiatur und die Civiltà Cattolica) 57Mit der Enzyklika »Quanta cura« von 1864 und vor allem dem »Syllabus errorum« im Anhang und den beginnenden Vorbereitungen für das Konzil verschärft sich der Ton. 58Scheeben beteiligt sich an einer Publikation zur Enzyklika und zum Syllabus. 59
Zu den beginnenden Auseinandersetzungen um das Konzil findet sich nichts in den Briefen, aber seit 1869 ist Scheeben publizistisch aktiv. In den Jahren 1869–1871 veröffentlicht er drei umfangreiche Bände »Das ökumenische Concil«, mit zumeist von ihm selbst geschriebenen Beiträgen. 60Ab 1872–1882 wird dies in der Reihe »Periodische Blätter« fortgesetzt, auch hier mit einer großen Zahl, oft nicht gezeichneter Beiträge Scheebens. 61Wir erleben hier einen durchaus kämpferischen Scheeben, gegen die Gegner der Papstdogmen, die entstehende altkatholische Bewegung, später, im »Kulturkampf«, gegen den die Kirche bekämpfenden Staat und dessen Allmachtsansprüche, den preußischen vor allem und dann das neue Kaiserreich und immer gegen den politischen und weltanschaulichen Liberalismus. Wie später ausgeführt wird, ist Scheeben ein engagierter Verfechter der Papstdogmen. 62Dies zeigte sich bereits vor 1870 in den entsprechenden Ausführungen der »Mysterien«. 63Sowohl in den beiden dogmatischen Entscheidungen des Konzils wie in der Definition der Unbefleckten Empfängnis von 1854 sieht Scheeben die »›Hauptheilmittel‹ gegen die ›Grundirrtümer unserer Zeit, den Naturalismus samt dem Rationalismus und Liberalismus‹«, so Pottmeyer, das führt ihn zur »scharfe(n) antiliberale(n) Akzentuierung« des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes. 64
Zwei große Themen bestimmen Scheebens Wirken fortan, der sogenannte »Kulturkampf« seit 1871 und in seinen Ausläufern über Scheebens Tod im Jahr 1888 hinausgehend, und die bereits seit den 60er Jahren mit Benjamin Herder angedachte Dogmatik, die in den 70er Jahren Gestalt gewinnt und bei Scheebens Tod noch nicht vollendet ist. Zum Kulturkampf hier nur ein paar Eckdaten. 65
Der Kulturkampf hatte zwei wesentliche Komponenten, die sich aber immer wieder überschnitten, die staatlich-politische und die gesellschaftlich-kulturelle. Beiden Aspekten gemeinsam war, dass die Katholiken politisch und kulturell als Fremdkörper angesehen wurden, besonders in Preußen, das nach 1866 und dem Ausscheiden Österreichs aus dem Deutschen Bund die dominante Größe in Deutschland wurde und nach 1870/71 mit der Etablierung des Kaiserreichs mit dem preußischen König den Kaiser des neuen Reiches stellte. In den Papstdogmen sah vor allem Bismarck eine von den deutschen Katholiken drohende Gefahr für die deutsche Souveränität. Zudem wurden die Katholiken in weiten Kreisen der protestantischen und liberalen Eliten Preußens und auch des Reiches als kulturell inferior angesehen, ein sozusagen zurückgebliebenes mittelalterliches und vormodernes Residuum. Mit einer ganzen Reihe die geistliche, kulturelle und auch finanzielle Eigenständigkeit der katholischen Kirche beschneidenden Gesetze wurde versucht, die Katholiken unter Kontrolle zu bringen. Sie betrafen die Ehegerichtsbarkeit, die Schulaufsicht, die Vermögensverwaltung und wirkten sich mit Predigtkontrolle (Kanzelparagraph), Besetzung von Pfarrstellen und Bistümern, Verboten und Ausweisung von Ordensgemeinschaften aus bis ins kirchlich-gottesdienstliche Leben. So wurden, um nur ein paar Zahlen zu nennen, 296 Ordensniederlassungen mit ca. 4.000 Mitgliedern aufgehoben und ein Viertel der Pfarreien Preußens war 1881 unbesetzt. Jesuiten, Redemptoristen und Sacre Coeur Schwestern mussten Deutschland verlassen. »Viele Geistliche erhielten hohe Geld- und Haftstrafen, keiner der elf preußischen Bischöfe blieb davon verschont.« 66
Das betraf natürlich das Rheinland, preußisch seit dem Wiener Kongress (1814/1815), hart und damit auch den Kölner Diözesanpriester und Seminarprofessor Scheeben. Paul Melchers (1813–1895), Kölner Erzbischof seit 1866, lebte, nachdem er von März bis Oktober 1874 eine Haftstrafe im Kölner Gefängnis Klingelpütz verbüßt hatte, seit Ende 1875 im Exil in den Niederlanden. 1875 wurden durch staatliches Verbot das Seminar und der Seminarbetrieb eingestellt und erst Oktober 1886, weniger als zwei Jahre vor Scheebens Tod, wieder eröffnet. 67Verteidigte und interpretierte Scheeben in den Schriften zum Konzil vornehmlich dessen Entscheidungen, so nahm er in den »Periodischen Blättern« wiederholt Stellung zu den politischen und sozialen Verhältnissen und Geschehnissen sowie deren geistigen Hintergründen. Wichtig ist hier besonders, allerdings schon zur Zeit des allmählichen Abklingens der heißen Phase des Kulturkampfes, Scheebens umfangreicher Beitrag über das christliche Autoritätsprinzip. 68
1874 erscheint der erste Band der Dogmatik, 1887 der letzte aus Scheebens Hand. Wenigstens die Zeit der Veröffentlichung ist nahezu deckungsgleich mit der für Scheeben und für Köln besonders einschneidenden Phase der Schließung des Priesterseminars. Über einige Aspekte der Arbeit sind wir durch den Briefwechsel mit Benjamin Herder gut informiert. Die Bekanntschaft geht zurück auf eine Begegnung September 1861 im belgischen Badeort Ostende, wo Scheeben zu einer vierwöchigen Erholung war. 69Obwohl sie sich danach nur noch selten gesehen haben, hielten Scheeben und Herder Kontakt miteinander, waren Freunde. Dies bezeugt auch Albert Maria Weiß OP (1844–1925), Herausgeber der »Herrlichkeiten« nach Scheebens Tod und partiell auch deren Bearbeiter. 70Der »umfangreiche Briefwechsel« um die drei bei Herder erschienenen Werke Scheebens, »Herrlichkeiten«, »Mysterien« und schließlich die Dogmatik erstreckt sich über die Zeit von 1861 bis 1888, beider Todesjahr, also über 27 Jahre. 711867 taucht zum ersten Mal der Gedanke an eine Dogmatik auf. Herder greift dies auf und 1868 schreibt Scheeben, nach Vorüberlegungen und Vorstudien lege er nun »mit Gott den ersten Stein«. 72Bemerkenswert ist, wie reflektiert Scheeben seine Arbeit unter schon vorhandenen Werken platziert. Berlage ist zu weitschweifig, Kuhn hat nur den Anfang und verliert sich in Weitschweifigkeiten, »Kleutgen ist zu sehr mit Polemik durchwebt, eben die Flüssigmachung der von ihm aufgehäuften Schätze sollte ein Hauptzweck sein.« 73Es kommen dann die Auseinandersetzungen ums Konzil und mit Döllinger dazwischen, dann die »Periodischen Blätter«, schließlich der Tod der Mutter. Es durchzieht den Briefwechsel, dass immer auch andere Aufgaben anliegen. Dann ein weiteres Charakteristikum, immer wieder Umarbeiten. 74»Drei- bis viermal, ja selbst sechsmal werden einzelne Abschnitte immer wieder gestaltet und umgestaltet.« 75Plötzlich wächst dann Konkurrenz, die Dogmatik von J. B. Heinrich vom »Mainzer Kreis« geht rasch voran, aber »Heinrich ist viel zu breit.« 76Endlich ist 1873 die erste Abteilung fertig. 77Immer glaubt Scheeben, nun rascher voranzukommen, aber die Gnadenlehre macht Schwierigkeiten, »wo ich dieselben längst überwunden zu haben glaubte.« Ähnlich bei der Christologie, sie hat »mich wider Erwarten am meisten Arbeit gekostet, ist aber auch etwas ganz Anderes geworden, als ich anfangs geahnt.« 78Dann vermehrt sich häufende Krankheiten, Probleme mit den Augen, später Gicht, Scheeben kann kaum mehr leserlich schreiben. 79Die Mariologie beschäftigt ihn sehr und er beklagt, »wie wenig sie in wissenschaftlichen Büchern zu ihrem Recht kommt, und wie deshalb in Erbauungsbüchern entweder in die Luft gebaut wird, oder aber das an sich Richtige bloß als fromme Meinung oder Phantasie angesehen wird.« 80Zum Schluss noch einmal die Gnadenlehre: »Helfen Sie mir also beten, zur hl. Mutter Gottes als der Mater gratiae, daß der Traktat der gratia Christi mir ebenso von statten geht und ebenso gut ausfällt wie die Mariologie.« Natürlich teilweise schon wieder zwei- bis dreimal überarbeitet. 81Scheeben spricht hier von Buch VI, vielleicht der großartigste Teil seiner Dogmatik. Er sieht sich hier »in der delikatesten und zugleich praktisch so unendlich wichtigen Partie der Dogmatik, worüber die Theologen so viel hin und her gestritten.« Er habe nicht gedacht, »so viel Schwierigkeiten zu finden oder sie leicht umschiffen zu können; aber immer wieder bin ich hängen geblieben.« 82Zwei Projekte tauchen noch auf, das der »Sphärenharmonie« (nach v. Thimus) und die Zweitauflage der »Mysterien«. Auf das erste mag sich Herder nicht einlassen, er möchte, dass die Dogmatik fertig wird. Aber es liegt Scheeben sehr am Herzen. Ohne Zweifel begegnen wir hier einem zentralen Anliegen Scheebens: Bereits die Schöpfung, die »Natur«, ist Abbild der Herrlichkeit Gottes. 83Er hofft, mit der Hilfe seines Freundes, des Domkapellmeisters Koenen, hier etwas zu machen, dass »die Weissagung von Leibniz über eine höhere heilige Verwendung der mathematischen Wissenschaften zum Lobe Gottes erfüllen« hilft. 84Er hat dazu schließlich einen großen Beitrag für den »Literarischen Handweiser« verfasst. 85Schließlich die Zweitauflage der »Mysterien«, an der Herder viel liegt, obwohl nicht gerade ein Verkaufserfolg. Inzwischen mehren sich die Krankheiten, Scheeben macht eine Kur bei Pfarrer Kneipp in Wörishofen. Er reist sogar nach England, damit, nach schlechten Erfahrungen mit der Übersetzung ins Französische, die englische Übersetzung ordentlich wird. 86In seinem letzten Brief vom 18. Juni 1888 teilt Scheeben Herder mit, »daß er bereits den größten Teil für die zweite Auflage der Mysterien schicken könne, falls der Druck sofort beginnen solle. Sonst wolle er lieber warten bis das Ganze fertig sei.« 87Einen Monat später, am 21. Juli 1888 ist Scheeben gestorben, Benjamin Herder am 10. November 1888.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Theologie der Vermählung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Theologie der Vermählung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Theologie der Vermählung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.