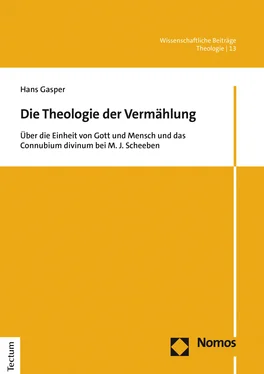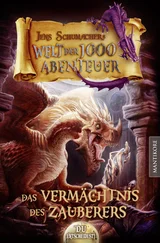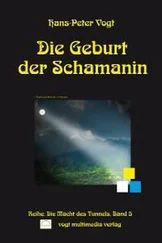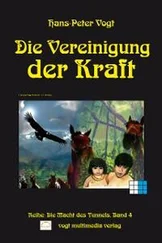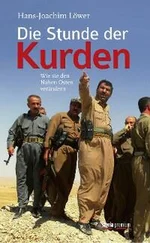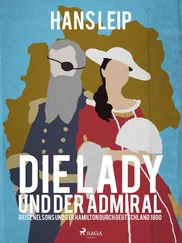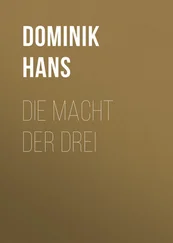Einen ganz eigenen Stellenwert haben Passaglia und Schrader, bei dem man immer hinzufügen muss, während seiner engen Zusammenarbeit mit Passaglia. Beide, vor allem jedoch Passaglia, haben eigentlich das Profil der »Römischen Schule« geprägt. Beider Nachgeschichte ist verdunkelt, bei Schrader durch seine antiliberale Verengung nach der Trennung von Passaglia, bei Passaglia ungleich stärker durch seinen Weg aus dem Orden und seine kirchliche Zensurierung nach dem geheimen Verlassen Roms und seinem auch publizistischen Einsatz zu Gunsten der Einigung Italiens (Suspendierung, wegen Letzterem die Exkommunikation). Dies implizierte die Aufgabe des Kirchenstaates, wobei nach der Auffassung von Passaglia zugleich ein Ausgleich zwischen Papst und dem vereinigten Italien möglich war. Diese Nachgeschichte hat lange verdeckt, dass Passaglia nach Kasper »zweifellos der genialste Theologe der Römische Schule« war und mit Antonio Rosmini (1797–1855) zu den bedeutendsten italienischen Theologen des 19. Jahrhunderts gehört. 117Pikanterweise hat sich Passaglia in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts an den gegen Rosmini gerichteten Polemiken beteiligt, dies aber in den 80er Jahren revoziert und sich etwa der Thomas-Interpretation Rosminis angeschlossen. 118Schon die frühen Arbeiten von Schauf erwecken den Eindruck, unter der Ägide von P. Sebastian Tromp (1889–1975) die theologische Rehabilitierung Passaglias zu verfolgen. Zum theologischen Programm greift Schauf nicht nur auf die zusammen mit Schrader, aber wohl überwiegend 1857 von Passaglia verfasste Präfatio zum »Opus de theologicis dogmatibus« des Petavius zurück, sondern auch auf die Turiner Schrift von 1880 »Della dottrina di S. Tommaso secondo l’Enciclica di Leone XIII. 119Der Rehabilitierung eines großen Theologen dient ohne Zweifel auch die bei Peter Walter verfasste Schrift über die Ekklesiologie Passaglias von Gianluca Carlin, die, wenn auch auf Italienisch, aber in einem deutschen Verlag und mit einer deutschen Zusammenfassung, erstmals in Deutschland eine etwas ausführlichere Biographie Passaglias enthält. 120
In jener Präfatio haben Passaglia und Schrader ein umfangreiches Programm aufgelegt, das beginnend mit der Schrift, den Vätern, zumal den Griechen, wie man vor allem bei Passaglia hinzufügen muss, alle wichtigen Glaubenszeugnisse incl. Liturgie, Märtyrerakten, bischöfliche und päpstliche Verlautbarungen umfasst. Bei allem Respekt vor der Bedeutung des hl. Thomas von Aquin wird eine bevorzugte oder gar exklusive Bindung an den Thomismus zurückgewiesen. 121Gegenstand der Theologie ist die Offenbarung, Höhepunkte sind die scientia trinitatis und incarnationis. 122Eine große Rolle in der Theologie der »Römischen Schule« spielt schließlich die Bedeutung der Präsenz und des Wirkens des Heiligen Geistes in der Kirche und im Leben der Glaubenden. Dies zeigt vor allem der wesentliche Beitrag von Passaglia und Schrader zur Frage der Einwohnung des Heiligen Geistes und »De Ecclesia« von Passaglia. 123So steht die Wiederentdeckung der Kirche als »mystischer Leib Christi« in der von Congar genannten Generationenfolge von Möhler über die »Römische Schule« bis Scheeben. Congar stellt sein oben genanntes Kapitel unter das Stichwort einer Wiederentdeckung oder Wiederherstellung der sakramentalen Dimension von Kirche. 124
Wichtig, gerade auch im Blick auf Scheeben, ist die Beteiligung besonders von Passaglia an der Vorbereitung des Dogmas von der Immaculata Conceptio Mariens und der päpstlichen Bulle »Ineffabilis Deus« von 1854. Sie war sozusagen ein Paradigma für die Tauglichkeit der gewählten theologischen Methode. Scheeben war 1854 in Rom, worauf Kerkvoorde nachdrücklich hinweist. Auf die Frage, welche Personen und Geschehnisse den jungen Scheeben in Rom beeindruckt haben mögen, nennt er an erster Stelle die Definition des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis Mariens und verweist auf die lebenslange tiefe Verehrung Mariens durch Scheeben, welcher er einen wichtigen Platz in seiner Dogmatik reserviert habe. 125
2.2.3 Neuscholastik
Es sind also für Scheebens Theologie ganz zentrale Elemente, die er in der Theologie seiner römischen Lehrer antraf und die in seinem Werk wirksam wurden. Er hat das Werk von Passaglia sehr geschätzt. Er nahm aber Anstoß an einem gewissen Starkult um ihn. 126Nach Kerkvoorde hätten neben Passaglia wohl Kleutgen und mehr noch sein Werk den größten Einfluss auf Scheeben gehabt. 127Damit kommt eine wichtige Gestalt der Theologie des 19. Jahrhunderts und bei der Restauration der Neuscholastik in den Blick, nicht zuletzt für den deutschen Sprachraum und auch für Scheeeben, Joseph Kleutgen. Seine beiden Hauptwerke über »Die Theologie der Vorzeit« (1853–1870 bzw. 1867–1874) und »Die Philosophie der Vorzeit« (1860–1863 bzw. 1878) waren zu ihrer Zeit epochal. 128Das gilt ganz unabhängig davon, wie man sie heute würdigt. Kleutgen hat ganz wesentlich zum allgemeinen Durchbruch der Neuscholastik bzw. des Neuthomismus beigetragen, wie er dann in der Enzyklika Papst Leo XIII. »Aeterni Patris« von 1879 verbindlich gemacht wurde. Ob Kleutgen der Verfasser der Enzyklika ist, wird diskutiert, aber sie entsprach ganz seinem Denken und schuf auf jeden Fall freie Bahn für das von Kleutgen propagierte Verständnis der Scholastik. 129Kleutgen war auch Konzilstheologe, und er hat maßgeblichen Anteil an den beiden Konstitutionen des Konzils, »Dei Filius« über das Verhältnis von Glaube und Vernunft und »Pastor Aeternus« mit den Dogmen über den Jurisdiktionsprimat und die Unfehlbarkeit des Papstes. 130
Ohne Zweifel muss Kleutgen als einer der maßgeblichen Theologen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelten, unabhängig von seiner philosophisch-theologischen Orientierung, unabhängig auch von seiner persönlichen Integrität. 131Das gilt auch für sein Wirken als Konzilstheologe, dessen Entscheidungen, wie auch immer im Einzelnen vorbereitet und zustande gekommen, letztlich nicht mehr Kleutgens Theologie, sondern eben Entscheidungen des Konzils waren. Kleutgens zu seiner Zeit wirkmächtiges philosophisches und theologisches Wirken und Werk wird heute eher kritisch angesehen. Das gilt für sein Wirken in der Index-Kongregation (1850–62) und seine Beteiligung an der Verurteilung von Theologen wie Anton Günther (1783–1863) und Jakob Frohschammer (1821–1893), sein Wirken als Konzilstheologe, das gilt aber vor allem und grundlegend für das von ihm maßgeblich beförderte Bild der Scholastik und des Thomismus, das inzwischen ganz erhebliche Korrekturen erfahren hat. Seine »Scholastik« wird heute als Konstrukt angesehen, das dem historischen Thomas und der Pluralität der Scholastik nicht gerecht wird. Kleutgen gilt zudem heute auch als maßgeblicher Repräsentant jener kirchlichen Epoche, die Hans Urs von Balthasar in der ihm gelegentlich eigenen rhetorischen Zuspitzung im »Antirömischen Affekt« sehr bissig beschrieben hat. 132Kerkvoorde schreibt, er habe sich »en bloc« dem modernen Denken widersetzt und es »condamnée sans pitié«. 133Das charakterisiert wohl beides gut, Person wie Intention.
Vor der Frage, ob und wie Scheeben von Kleutgen beeinflusst wurde, noch eine Anmerkung: Kleutgen war nie Scheebens Lehrer in Theologie und Philosophie. Er war vor Scheebens Zeit in Rom und danach Rhetoriklehrer am Germanicum (1847–1850 und 1863–1869), Professor für »geistliche Beredsamkeit«, zugleich dort auch Beichtvater. 134Auf die Frage, in welcher Weise Scheeben von Kleutgen beeinflusst wurde, gibt Kerkvoorde ein differenziertes Urteil. Er nennt das Studium der Väter und der Scholastik, also das, was bei Kleutgen Philosophie und Theologie der Vorzeit hieß, die Front gegen die theologischen »Abweichungen« und den Einfluss der zeitgenössischen Philosophie. Auch die Wahl der deutschen Sprache für seine Dogmatik wie Kleutgen für seine beiden Hauptwerke rechnet Kerkvoorde dazu. 135Ohne Zweifel hatte Scheeben Anteil an der neuscholastischen Renaissance der Theologie, rezipierend wie aktiv. Der von der Natur handelnde Teil von »Natur und Gnade« (31–60) ist ein beredtes Zeugnis. Die Linie zwischen Natur und Gnade scharf zu ziehen, war Scheeben mit Kleutgen und im Rekurs auf Kleutgen ein zentrales Anliegen. 136In seinem ersten wissenschaftlichen Aufsatz, bezeichnenderweise in »Der Katholik«, Organ des »Mainzer Kreises« und der dort vertretenen Neuscholastik, rühmt er Kleutgen für seine diesbezüglichen Bemühungen (ÜN 16, Anm. 4). 137Und er beklagt an gleicher Stelle, dass Kleutgen Hirscher und Hermes so einlässlich behandelt habe. 138Auch das verbindet Scheeben mit Kleutgen, die Frontstellung gegen Teile der »deutschen Theologie« und deren Ungenügen in der Behandlung des Übernatürlichen und der Gnade. Darum geht es Scheeben, um die Abwehr einer Naturalisierung des Übernatürlichen und der Gnade. 139Mit Kleutgen sieht er in der Vernachlässigung, ja Geringschätzung der großen Tradition der Kirche einen Hauptgrund für die Mängel der Theologie in Deutschland. (ÜN 5 f.) Wie Kleutgen sieht er im Rückgang auf die »Theologie der Vorzeit« das entscheidende Heilmittel:
Читать дальше