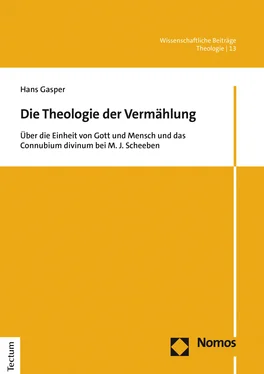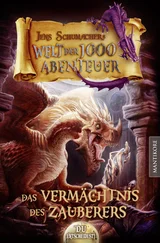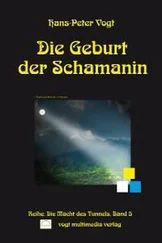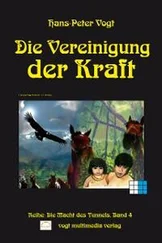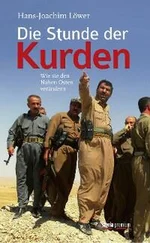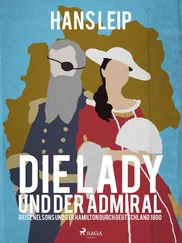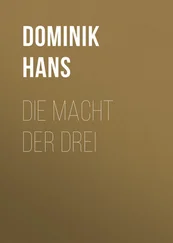»Die jungfräuliche Mutter goß, wie die Kirche sagt, das ewige Licht in die Welt aus; sie gebar den Sohn Gottes in der menschlichen Natur und sie empfing ihn in ihrem Schoße. Hier (in der Gnade, H.G.) soll der Sohn Gottes nicht in der physischen Einheit der Person, sondern in moralischer Einheit der Person, durch ein reelles Bild seines göttlichen Lichtes und eine reelle Partizipation seines göttlichen Lebens in der menschlichen Natur wiedergeboren werden.« (NG 195)
Das ist, wie man sieht, noch ganz im Bann der geschaffenen Gnade, noch vor den Revisionen in der Inhabitationsfrage seit den »Mysterien«. Offener und gleichbleibend in allen von ihm verantworteten Ausgaben der »Herrlichkeiten der göttlichen Gnade« schreibt Scheeben, dass »der Heiland durch … (die, H.G.) Gnade uns fast seiner eigenen Mutter gleichsetzt:«
»Denn durch die Gnade werden wir in wahrhaft wunderbarer Weise der Mutter Gottes ähnlich … selbst ihre Mutterschaft ahmen wir in uns beim Empfange der Gnade nach. Derselbe Heilige Geist, der in den Schoß Mariä herabstieg, um ihr eine himmlische Fruchtbarkeit zu verleihen, steigt auch in unsere Seele herab, um den Sohn Gottes in ihr geistigerweise zu zeugen.« (H 52)
Das will diese Arbeit an den einzelnen Teilstücken von Scheebens Theologie zeigen und belegen.
Damit ist so etwas wie der Fluchtpunkt der gesamten Vermählungstheologie und der Theologie des »Connubium divinum« und auch der ganzen Theologie Scheebens benannt. Dominiert dabei zunächst der Aspekt der Genese, »Vermählung« als Prozess, so folgt daraus als Abschluss die Vollendung der Einheit von Gott und Mensch. Diese wird immer wieder dargestellt in einem von Alexander von Hales und Bonaventura übernommenen Ternar: Durch die Gnade wird der Mensch Kind des Vaters, Braut (und Leib, wie man hinzufügen muss) des Sohnes bzw. Christi und Tempel des Heiligen Geistes. Es ist dies die Vollendung der Vermählung. Zumal von den griechischen Kirchenvätern übernommene Begriffe wie Vergöttlichung, Vereinigung und Verähnlichung, Verklärung, dazu ein entsprechendes Bildprogramm (Feuer, Erleuchtung, Salbung u.a.m.) orchestrieren dies, oft unterstrichen mit dem braut- und vermählungstheologischen locus classicus 1 Kor 6,17: Qui autem adhaeret Domino unus Spiritus est. Wer aber dem Herrn anhängt, ist Ein Geist mit Ihm. 21Da diese Mitteilung der vergöttlichenden Herrlichkeit auch das leibliche Sein des Menschen und darüber die ganze Schöpfung einbezieht, muss man der Vollständigkeit halber sagen: Ist Ein Leib und Ein Geist mit Ihm (Drittes Eucharistisches Hochgebet). Dazu gehört dann 1 Kor 6,19, wonach der Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist.
Um noch einmal zu den Anfangsfeststellungen zurückzukehren: Vor seinen größeren und seinen wissenschaftlichen Arbeiten steht bei Scheeben das Büchlein »Marienblüthen«, eine über 200 Seiten starke Sammlung marianischer Texte, Gedichte, Lieder, Gebete und kompakt theologische, zugleich panegyrische Texte von Kirchenvätern. Die Kirchenvätertexte reflektieren die »Unbefleckte Empfängnis«. 22Das Chronogramm der vorangestellten lateinischen Fürbitte zeigt das Jahr 1854, das Jahr der Dogmatisierung der Unbefleckten Empfängnis Mariens. Scheeben war zu der Zeit in Rom. Der Hinweis auf die Mariologie im Schlusskapitel von »Natur und Gnade« hat also programmatische Bedeutung. 23Wie Maria den Sohn, so empfängt die Natur die Gnade durch eine »Zeugung« in ihrem »Schoß«, wird so Gott anvermählt und befähigt zur »Geburt« des Lebens der Gnade, ja, zu einer Geburt des Sohnes in der Seele. 24
1.2 Aufbau, Struktur und Problemzonen der Arbeit
Bei der Beschäftigung mit Scheeben gibt es drei Schwierigkeiten. Zum einen die der Sache zwar durchaus angemessene, aber zugleich schwierig-sperrige Sprache Scheebens, zumal in der Dogmatik. Ferner war und ist Scheeben zwar ohne Zweifel theologisch einer der ganz Großen, aber seit seiner ersten Veröffentlichung 1860 sind fast 160 Jahre vergangen, zwei Weltkriege, der Weg in die globalisierte »Eine Welt«, nicht zuletzt folgte dem großen kirchlichen Ereignis zu Lebzeiten Scheebens, dem Ersten Vatikanischen Konzil (1869–1870), das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965). Scheebens theologische Welt ist in ganz vieler Hinsicht nicht mehr die unsrige. Das gilt drittens nicht zuletzt von seiner Vermählungstheologie. Nicht nur, dass sie in ihrer Art einzigartig ist, macht ihre Beurteilung schwierig – ich weise hier nur auf die sponsal-mütterliche Gestalt seiner Pneumatologie hin, für die es in dieser Form kaum Vorbilder gibt – auch sein Verständnis des Verhältnisses von Mann und Frau bereitet einige Probleme, um es ganz zurückhaltend zu sagen. Ein androzentrisches Frauenbild des 19. Jahrhunderts, bevor auch nur eine Ahnung weiblicher Emanzipation das Innere der Kirche erreichte, ist integraler Teil seiner Vermählungstheologie. Wer um die Komplexität des heutigen Diskurses zur »Querelle des Femmes« weiß, ist ständig in der Versuchung, angesichts von Scheebens Frauenbild aufzugeben. – Ich komme auf all das im Verlauf der Arbeit zu sprechen und greife dies und das Thema von Scheebens theologischer Ungleichzeitigkeit mit uns auch am Schluss der Arbeit noch einmal auf.
Zum Aufbau der Arbeit: Gerahmt durch einen Einleitungsteil, zu dem auch die biographische und theologiegeschichtliche Zuordnung gehört, und einen resümierenden Schlussteil, hat die Arbeit zwei Schwerpunkte. Es gibt zunächst eine umfangreiche Hinführung. Sie schreitet die zentralen Themen und Motive von Scheebens Theologie ab, beginnend mit seiner Theozentrik der Vergöttlichung, und führt zur Vermählungstheologie als Ausgangs- und Zielpunkt. Dann kommt zweitens, beginnend mit der Trinitätstheologie, ein Durchgang durch fast alle Traktate. Dabei soll gezeigt werden, wie diese vermählungstheologisch gestaltet sind. Ausgeklammert sind allein Scheebens Theologie der Sünde, zumal der Erbsünde, des peccatum originale, und seine großartige Theologie des Opfers. Erstere, weil sie zwar wichtig ist, aber nicht direkt Teil der Vermählungstheologie ist, Letztere, weil sie zwar einen Kulminationspunkt von Scheebens Theologie darstellt, aber so gewichtig ist, dass eine einlässliche Darstellung den ohnedies schon arg strapazierten Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Ich komme auf dieses Thema mehrfach zurück. 25
Der zweifache Versuch, das Ganze darzustellen, wenn auch in unterschiedlicher Perspektive, führt unvermeidlich zu Wiederholungen und Redundanzen. Nachdem dieser Ansatz einmal gewählt, wäre ein erneuter Umbau der Arbeit sehr zeitaufwendig geworden, mit zudem zweifelhaften Erfolg. Hier liegt nämlich ein Dilemma der Lektüre und der Interpretation von Scheebens Werk. Norbert Hoffmann schreibt in seiner vorzüglichen Arbeit über Scheeben, es gehe bei Scheeben immer »vom Ganzen her und zum Ganzen hin.« 26Das heißt auch, man versteht, worum es jeweils geht, nur oder angemessen, wenn man das Ganze im Blick hat. Um zwei Beispiele zu geben: Das Modell »Autoritätsglaube«, schon erwähnt, versteht man erst, wenn man das Ganze verstanden hat, wenn einem klar geworden ist, worauf Scheeben mit diesem Begriff hinaus will: Die Gemeinschaft mit dem sich mitteilenden Gott. Scheebens Gotteslehre in ihrem Teil »De Deo uno«, traditionell gesprochen, versteht man erst recht, wenn einem klar wird, dass die gesamte Gotteslehre so disponiert ist, dass sie »organisch« in die Lehre von Gott dem Dreifaltigen transponiert werden kann, fast hineinwächst. Was hier auf vergleichsweise kleinem Raum stattfindet, im Rahmen der überschaubaren Glaubensanalyse oder im Rahmen eines ebenfalls noch relativ gut überschaubaren ganzen Traktats gilt weithin für das Gesamtwerk. Es gibt Passagen im Frühwerk, etwa die erwähnte Parallelisierung der »Vermählung von Natur und Gnade« (1860) und der Menschwerdung ex Maria virgine, die so erst mehr als 20 Jahre später im entsprechenden Band der Dogmatik eingelöst werden (1882) und hier ihre volle Bedeutung bekommen. Noch einmal verkompliziert sich das Ganze in der Frage nach dem Verhältnis der »Mysterien des Christentums« (1865) zur Dogmatik (1874–1887). In den »Mysterien« bewegt sich Scheeben viel unmittelbarer in der Konkretheit des »nexus mysteriorum«, d.h. vor allem der Christozentrik des Ganzen als in der Dogmatik, wo der Christologie erstmal eine sozusagen a-christologische, will sagen prälapsarische Gnadenlehre vorgeschaltet wird, die jedoch durchgängig mit neutestamentlichem Material arbeitet und folgerichtig erst nach der Christologie ihren zutreffenden Platz bekommt. Die »Mysterien« standen jedoch vor einer Zweitauflage, die auf Grund von Scheebens Tod und wohl auch des Todes seines Verlegerfreundes Benjamin Herder (beide 1888) nicht mehr erschien. Diese Zweitauflage, soweit sie bei Scheeben vorlag und die die Vorlage zur Ausgabe in den »Gesammelten Schriften« bildet, ist mit einigen Ausnahmen, die aber keinerlei grundsätzlichen Richtungswechsel erkennen lassen, identisch mit der Erstauflage. Wieweit können also die »Mysterien«, mehr oder minder gänzlich die Auflage von 1865, zur Interpretation der Dogmatik herangezogen werden?
Читать дальше