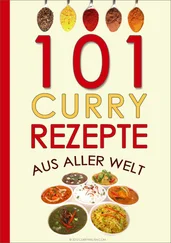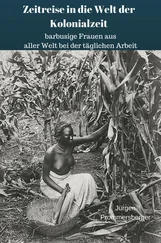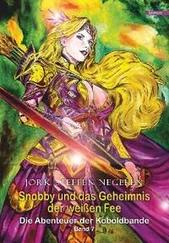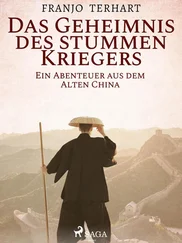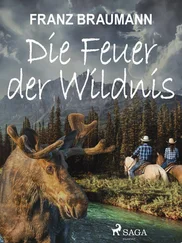Diesmal zischte ein Pfeilhagel um ihn nieder – jeder einzelne hätte, ihn treffen können! Das war die letzte Warnung! Er trat nach rückwärts, aber er wandte den versteckten Schützen nicht den Rücken zu. Er fühlte, daß diesmal auch sein Herz klopfte, aber er winkte lachend mit den Händen. „Vender, bem – verkaufen, gut!“ rief er noch einmal den abweisenden Indianern zu.
Als er hinter der Krümmung Bernd mit dem Gewehr geduckt im Anschlag stehen sah, zischte er ihn an: „Bist du verrückt? Du hättest mein Tod sein können! Wahrscheinlich haben sie auch dich bereits entdeckt!“
Bernd senkte betroffen die Waffe. „Was sollte ich sonst tun?“
„Nichts – warten, bis sie kommen!“
Enrico zuckte die Schultern. „Wir sind in ihrer Hand – ohne die Möglichkeit, in einem Boot oder sonstwie zu verschwinden!“
„Du bleibst auf dieser Praia?“ fragte Bernd entsetzt.
„Ich will den Besitzer des Kesselchens sehen!“
Sie brannten ein Feuer an, fingen das Abendessen und taten so, als lebten sie noch immer allein an dem Fluß, der nicht einmal auf der Landkarte zu finden war. Sie wußten, daß jeder ihrer Handgriffe beobachtet wurde. Aber ihre Waffen lagen nun verborgen; sie saßen am niedersinkenden Feuer und streckten sich dann in der warmen Grube im Sand aus.
Keiner schlief in dieser Nacht. Erst gegen Morgen fielen ihnen die Augen zu.
Als Bernd Hoyer erwachte, saß jemand fünf Schritte neben ihrem Lager – ein bekleideter Mensch –, ein Weißer!
Er setzte sich auf. „Woher kommen Sie, Senhor?“
Der Mann schien erschöpft, blaß – wie ein Malariakranker. Er lächelte jetzt. „Ich wundere mich ebenso über Sie, Senhor, Ihren ruhigen Mut! Ohne mich wären Sie wahrscheinlich tot!“
Enrico hörte Gemurmel. Am Morgen war er stets schwer wachzukriegen. Er blinzelte, rieb sich die Augen. Er starrte hinüber.
„Senhor Parkins!“
Der weiße Besucher erhob sich ebenfalls. „Sie kennen mich? Für die Welt draußen müßte ich längst tot sein!“
Branco stellte sich vor, vollendet, wie es nur ein Brasilianer aus Rio fertigbringt. Er nannte auch Bernds Namen. „Wir suchten Sie, Senhor Parkins!“
Als Parkins aufstand, sah man, wie die abgenutzten Kleider an seinem mageren Körper schlotterten. „Das ist ein Wunder – nach einem Jahr werde ich noch gefunden!“ flüsterte er.
„Man suchte Sie damals sogar mit Flugzeugen und Motorbooten an den großen Strömen entlang. Man mobilisierte den Indianer-Schutzdienst, die Missionsstationen – wo steckten Sie diese ganze Zeit, Senhor Parkins?“
Der englische Forscher hob nachlässig den Arm. „Immer dort hinten bei den Cahambas. Sie meiden jeden Kontakt mit den Weißen. Dieser Fluß fehlt auf jeder Karte – wer sollte hier eindringen?“
„Wir wären vielleicht sofort weitergegangen, hätte mich nicht das Kochkesselchen festgehalten – es gehört Ihnen?“
Parkins nickte. Die Suchenden erfuhren, daß Parkins krank und von den Cavantes-Trägern verlassen an diesen Fluß gekommen war. Als ihn die Cahambas entdeckten, gab er sich als Doktor aus, der alle Wunden und Krankheiten heilen könne. Man nahm ihm darauf alles ab und behielt ihn bei sich. Er hatte mit Wundheilungen Glück. Eine schwere Infektion brachte ihn selbst vor zwei Monaten an den Rand des Todes. Er wurde gepflegt, seither ist er nicht mehr in Gefahr. Doch die Indianer wollen nicht, daß sie ihr guter Medizinmann verläßt. – Er zuckte die Schultern. „Ich war auch zu schwach, um zu fliehen!“
Enrico nickte verstehend. „Und was halten die Cahambas von uns?“
„Sie wollten euch vertreiben, aber nicht töten, wenn ihr sofort weitergezogen wäret. Ihre heimlichen Unterhaltungen machten mich aufmerksam – dann behauptete ich rasch, Ihr seid gekommen, mir Medizinen und Verbandzeug nachzuliefern. Da schickten sie mich zu euch – packt bitte einiges aus, damit meine Behauptung zutrifft!“
Es war eine sonderbare Situation – drei weiße Männer, die unter den vielen beobachtenden Augen der unsichtbaren Cahambas Kopfschmerz- und Abführtabletten aus einer Hand in die andere reichten, Verbandmittel und Penicillin-Ampullen auf den weißen Sand stapelten.
„Sie dürfen mich nicht bis zum Lager der Cahambas begleiten, Senhores – das mußte ich dem Ältesten versprechen. Sie wollen für immer verborgen bleiben und nichts mit den fremden Weißen zu tun haben.“
„Sie kommen nicht mit uns?“ fragte Enrico fassungslos.
Parkins zuckte die Schultern. „Ich würde es noch nicht schaffen, sieben oder zehn Tage, vielleicht noch länger zu Fuß unterwegs zu sein. Vielleicht ließen sie mich fort, wenn ich verspräche, wieder zurückzukommen. Die Cahambas vertrauen mir, und ich konnte ihr Leben studieren. Ich will bei ihnen bleiben – vorläufig.“
Enrico Branco atmete tief und erregt. „Ich sehe das ein; wir besitzen weder ein Boot noch ein Flugzeug. Wir haben uns nur an diesen Fluß verirrt, und Sie retteten uns das Leben. Aber wir kommen wieder – bald!“
Mac Parkins lächelte nachsichtig. „Erst müssen sie selbst aus der Wildnis des Sertao kommen. Es ist mir unbekannt, was Sie auf Ihrer Wanderung noch erwartet. Nach meiner Berechnung mündet unser Rio irgendwo in den Araguay. Viele Tagereisen weit liegen seine Ufer unbewohnt; sie sollten sich ein Floß bauen, später! Und übereilen Sie nicht meine Rettung – ich lebe im Schutz der Cahambas.“
Sie trennten sich. Enrico Branco und Bernd Hoyer wanderten weiter, ohne einen einzigen Cahamba-Indianer gesehen zu haben.
Zwei Monate später landete ein Hubschrauber der brasilianischen Luftwaffe mitten im Lager der Cahambas. Es gab einige Pfeilschüsse, und die entsetzten Cahambas tauchten im Dschungel unter. Mac Parkins tat es sehr leid, nicht von der ganzen Sippe freundlichen Abschied nehmen zu können. Er kehrte über Rio nach London zurück.
Die zwei Jäger hatten die erste Sattelhöhe des Gebirgszuges zwischen dem oberen Jenissei und dem Kemtschik-Fluß im Altaigebirge erreicht. Ein kalter Oststurm brauste um die steinübersäten Hänge, auf denen ein undurchdringliches Gewirr von niederen Bergerlen, von kniehohem Rosmarin, Thymian und Lavendel wucherte. Aus der Tiefe des Tales hatten diese Höhen völlig kahl ausgesehen – nun aber konnten die Jäger Michel Prank und Peter Semling nur schrittweise vorwärtskommen. „Vor uns liegt ein unübersichtliches Hochplateau statt des erwarteten Gebirgskammes!“ stellte Peter Semling enttäuscht fest. „Wir werden den Kemtschik-Fluß heute nicht mehr erreichen.“
„Was tut es?“ Sein Begleiter zuckte mit den Schultern. „Wir tragen Zelt und Schlafsack mit uns und haben schon mehr Nächte in der Wildnis überstanden!“
Die zwei Männer sprachen deutsch! Wie waren sie in die Wildnis des sibirischen Altaigebirges gekommen? Als sich bei dem letzten großen Krieg die Deutschen der Wolga genähert hatten, waren die zwei Millionen Wolgadeutschen nach Sibirien deportiert und in der unendlichen Weite dieses Riesenlandes verstreut angesiedelt worden – in Kasachstan, auf dem Ust-Urt-Plateau und am Oberlauf des Jenissei. In der damals noch „Autonomen Republik Tannu-Tuwa“ hatte man in den fruchtbaren Talsteppen einige zehntausend Bauern in riesigen Kolchosen festgesetzt. Peter Semling und Michel Prank hatten dies alles noch als Kinder erlebt – jetzt standen sie als Jäger auf Zobel, Nerz und Kabarga beim „Staatlichen Pelzmonopol“ im Dienst. Längst hieß nun ihre neue Heimat „Tuwinisches Autonomes Gebiet“.
Soweit das Auge reichte, wogte die grüne Taiga Welle an Welle bis in wolkenverhangene Fernen. „Wir werden einige Tage zu wandern haben, bis wir zu unseren Bauern am Kemtschik absteigen können“, brummte Peter Semling. „Irgendwo soll ein alter Goldsuchersteig über dieses abflußlose Hochland führen. Wenn wir den finden, sind die Schwierigkeiten halb so schlimm.“
Читать дальше