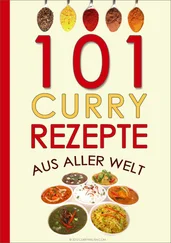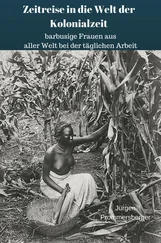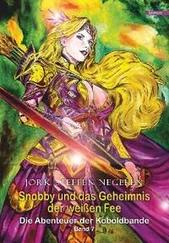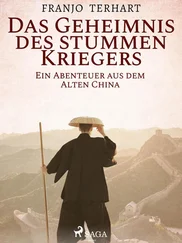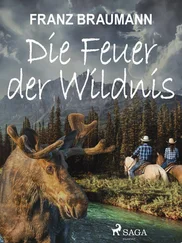„Sie sammeln Holz fürs Kochfeuer.“
„So weit fort?“ Bernd konnte sie nirgends sehen. Er horchte.
Da kamen sie erregt zurück. „Dort drüben sind Spuren zu sehen, Senhors. Indios sind in der Nähe; vielleicht haben sie uns bereits entdeckt! Die Cavantes sind gefährlich – töten jeden Weißen!“
Enrico war aufgesprungen. „Was? So bald hätte ich sie nicht erwartet!“ Er fuhr mit der Hand durch die Luft. „Ich kenne ihren Dialekt und muß sie finden. Wir sind keine landgierigen Estancieros, die die Indios mit gemeinsten Mitteln vernichten. Sobald ich mit ihnen spreche, sind wir Freunde!“
Torro zischte haßvoll: „Diese Wilden sind keine Menschen! Sie stehlen Vieh und sind heute noch Menschenfresser!“
Enrico schüttelte verächtlich den Kopf. „Das ist die Propaganda eurer reichen Herren – und ihr Armen plappert sie nach!“
Er befahl Camario, ihn zu führen. Es war nur ein Zufall, daß sie nicht sofort auf die Spuren in der sandigen Mulde gestoßen waren. Von hier schien ein Pfad zu einem noch unsichtbaren Wasser zu führen. Es war jetzt fast dunkel – Enrico konnte die Spuren von fünf oder sechs Erwachsenen feststellen. Wie alt die Spuren waren, ließ sich nicht schätzen. „Vielleicht kommen sie wieder!“ sagte der Forscher später. „Sie müßten auch Parkins gesehen haben!“
Aus den Augen der Caboclos sprach die nackte Angst, während sie vor dem kleinen Feuer saßen. Sie wickelten sich bald abseits in ihre Ponchos und flüsterten erregt miteinander.
„Sollen wir wachen?“ fragte Bernd. Auch ihm war unbehaglich.
„Indios schlafen in der Nacht!“ lachte Enrico. „Sind sie Christen, meiden sie uns aus Furcht; sonst fürchten sie den großen Vater der Nacht. Außerdem sind diese Cavantes längst weit weg!“
Sie krochen in das schmale Zweimannzelt und schliefen unbehelligt die ganze Nacht hindurch.
Bernd erwachte als erster. Durch den Spalt im Zeltverschluß fiel ein Streifen Sonne. Ihrem Winkel nach stand sie schon ziemlich lange am Himmel. Er horchte; auch die Caboclos regten sich noch nicht. Faule Bande! dachte er zuerst. Aber vielleicht waren sie bereits fort – auf der Suche nach Wasser? Leise, um Enrico nicht zu wecken, schob er sich ins Freie.
Größter Frieden ringsum! Die Asche des abendlichen Feuers lag kalt; kein gesammeltes Brennholz – nicht einmal die Dose mit Farinhamehl stand daneben. Und drüben das niedergedrückte Graslager der Caboclos war verlassen – leer.
Leer? Ein unheimlicher Verdacht überfiel ihn. Er lief hinüber, rief: „Hallo, Camario, Torro – wo steckt ihr?“
Enrico schob gähnend den Kopf aus dem Zelt. „Wo werden sie sein? Sie sind zum Wasser gegangen! Alle haben wir Durst!“
„Die Wassertasche liegt noch dort!“ stellte Bernd fest.
Enrico stand mit einem Satz auf den Beinen.
„Dann sind sie…“
„Fort – getürmt vor den Cavantes!“
Enrico und Bernd blickten sich fragend an. Sollte dies das Ende der Suchfahrt nach Mac Parkins sein? Was blieb ihnen noch für eine Wahl, nachdem sie keine Träger, kein Koch, keine Bootbauer, keine Meister des Pfadschlagens im Dschungel mehr begleiteten? Denn einholen oder gar zur Umkehr zwingen ließen sich die Geflüchteten sicher nicht mehr!
Enricos Gesicht verhärtete sich. „Wir geben nicht auf!“
„Ich gehe mit!“ Bernd fand nicht mehr Worte in dieser Situation, die, an der dunklen Zukunft gemessen, ernst genug erschien.
„Hallo, Enrico, auf! Wach schnell auf!“
Als der Forscher herumfuhr, kniete Bernd gebückt neben ihm und starrte verstört in die Richtung der Lagune, die sie nach acht Tagen völlig erschöpft entdeckt hatten. Hätten sie den flachen Wassertümpel verfehlt, wäre wohl bald die Sonne zum letztenmal über die zwei Lebenden im trockenen Sertao heraufgestiegen. So aber hatten sie getrunken und wieder getrunken und wegen der Moskitoplage am Wasser ihr Zelt etwas abseits im dichten Dorngebüsch aufgestellt.
„Hörst du sie – jetzt wieder!“ flüsterte Bernd.
Von irgendwoher außerhalb der Lagune kam ein Gekreisch wie von den großen Aras im Dschungel des Rio Culuene. Der Lärm näherte sich – einzelne Rufe – menschliche Stimmen!
Bernd hatte nach dem Gewehr gegriffen. Enrico fiel ihm in den Arm. „Was fällt dir ein – wir müssen ihnen unsere friedliche Absicht beweisen!“
Das dichte Blätterwerk jenseits der Wasserstelle schob sich auseinander. Ein Kopf erschien, ein zweiter – bald wimmelte die Lagune von Indianern.
Eine ganze Sippe schien sich auf dem Jagdzug zu befinden; die Männer trugen Speere und Bogen als Waffen mit sich. Die Frauen schleppten in geflochtenen Bastmatten ihre Säuglinge auf dem Rücken. Es war nicht zu erkennen, ob das Volk nur Wasser schöpfte oder sich häuslich niederlassen wollte.
Die Cavantes fühlten sich völlig unter sich und ungefährdet, sonst wären sie nicht ohne Erkundung an die Lagune gekommen. Sie hatten keinen Blick für die Umgebung. Selbst das Zelt war ihnen entgangen. Sie schnatterten mit unverständlichen Lauten.
Die zwei Lauschenden kauerten noch immer im offenen Zelt hinter dem Gitter der dornigen Büsche. Enrico horchte angestrengt, um einige Worte zu verstehen. Er hatte jahrelang Indianer-Idiome studiert und seine Doktorarbeit über sie geschrieben.
In diesem Augenblick wurde es drüben still. Einige Indios beugten sich nieder – sie hatten die Abdrücke von Schuhen entdeckt!
„Raggat, raggat!“ verstand Enrico aus dem Geschnatter.
„Jetzt aber auf und hinaus!“ drängte Enrico Branco.
Es war bereits die höchste Zeit. Die Cavantes formierten sich hinter einer Phalanx von Speeren und starrten auf das Zelt, aus dem eben Enrico geschnellt war. Er stand ohne Waffen und winkte mit beiden Händen. „Amigos – amigos! Freunde, Freunde sind wir!“
Die Cavantes starrten verblüfft auf den Weißen. Ein einzelner „Großer“ im Sertao? Da schlüpfte auch Bernd aus dem Zelt – das weckte ihr Mißtrauen von neuem.
Enrico wußte, daß es rasch handeln hieß, um den Überraschungsmoment auszunutzen. Wie gut, daß er stets in der Tasche eine Schachtel mit Nadeln und Klammern mit sich trug, wie es ihm der amerikanische Missionar am Rio Cujaba geraten hatte. Er trat aus dem Dickicht und hielt sie den Indios entgegen. „Ich vertausche das alles – was gebt ihr mir?“
Die Kinder und Frauen waren wie ein Blitz verschwunden. Die Männer zögerten noch – kletterten noch mehr „Große“ aus dem Zelt? Bekleidete Weiße schienen ihnen nicht mehr fremd, nur gefährlich zu sein.
Enrico hatte sich inzwischen den vorderen Cavantes genähert. „Amigos, amigos – bem, bem!“ versuchte er beruhigend einige portugiesische Wörter anzubringen. „Ich suchte euch schon lange, fragen will ich euch etwas – perguntar!“
Ein alter Cavante, der ein paar Fetzen Kattun am Leib trug, wies auf ein Kreuz an einem Lederstreifen um den Hals. „Missao?“ fragte er. „Missao, bem – gut!“
Er hielt Enrico für einen Mann der Mission – nicht des oft gefürchteten Indianer-Schutzdienstes –, das erleichterte die Sache. Branco ließ sich auf dem Sand nieder und bedeutete auch Bernd, es zu tun. Es konnte ihr Tod sein – ein Stoß aus zehn Speeren – vorbei! Aber Enrico wagte es – und überzeugte! Die erhobenen Speere sanken nieder, der alte Indio folgte seinem Beispiel.
Bernd verstand kein Wort von der Unterhaltung, die jetzt begann. Ab und zu ließ Enrico eine Erklärung fallen: „Sie haben Mac Parkins gesehen – als Doktor bot er sich an –, er muß es gewesen sein! Nein – er ging nicht dorthin, sondern dahin!“
Viele redeten jetzt durcheinander, fragten, forderten – der Fremde, der vor einem Jahr vorbeigekommen war, interessierte sie nicht lange. Sie wollten Geschenke – kaufen – tauschen!
Enrico Branco wußte aus seinem Indianerstudium, daß es gefährlich war, unzivilisierten Indianern Geschenke zu verteilen. Sie wollten mehr, immer mehr, ihr Besitzhunger erwachte – und wenn es keine Geschenke mehr gab, rissen sie dem wehrlos ausgelieferten Weißen oder Caboclo die Kleider vom Leib; und wenn sie ihn nicht gar töteten, ließen sie ihn ausgeplündert liegen.
Читать дальше