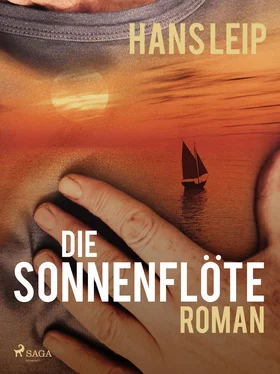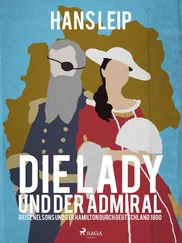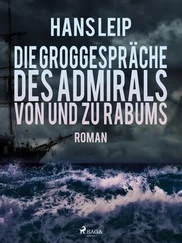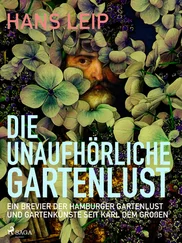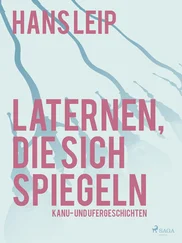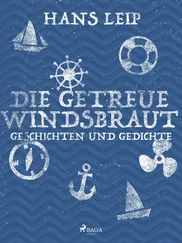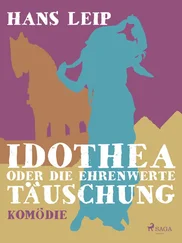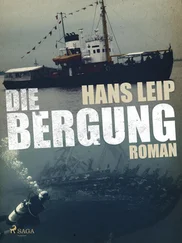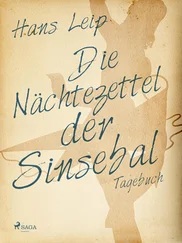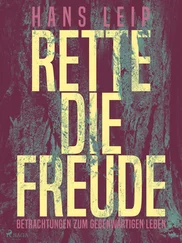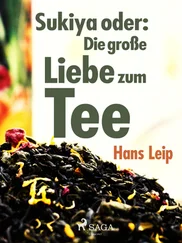Tidemunt summte noch immer vor sich hin in der zehrenden Lust, so rechtzeitig einzugreifen. Er sah zur Seite Reihen ungetümer Rammstampfer aufgefahren, modern, wie er sie selber noch nie gesehen, und sie hatten begonnen, ofendicke, turmlange Föhrenstämme senkrecht in den entblößten Grund zu stoßen als Unterlage für die bislang in dieser Linie geplanten Kaimauern. Tidemunt lachte polternd und sprang ab; denn der Deich war erreicht, und dahinter erstreckten sich, groß wie ein Dorf, die Arbeiterbaracken und Werk- und Lagerschuppen rings um den breiten Turm des Umformer-Kraftwerkes. Ganz vorn stand bescheiden die Bauhütte. Von ihr strahlten die Kabel und Leitungen zu jeder einzelnen Maschine ins Gelände, und alles und jedes wurde von hier sichtbar an der Leine gehalten. Doch war Vorsorge getroffen, die einzelnen Baugruppen auch funktelefonisch zu erreichen, und davon ließ Tidemunt sofort Gebrauch machen. Und mit einem Schlage war der wilde nächtliche Lärm zum Schweigen gebracht. Der Bauführer hatte sich gerade für ein paar Stunden aufs Ohr werfen wollen in der Gewißheit, alles laufe nach Vorschrift am Schnürchen. Jetzt mußte er erleben, wie die sauberen Plantafeln mit den Trassen der Ausschachtungen und Aufschüttungen rasch und erstaunlich umgezeichnet wurden, indes eine Kanne Kaffee aus der Kantine hereinschwang und die niedrige Bude sich mit dem blauen Qualm der Corona füllte und mit dem schnaufigen Gesumme des Oberbaurats, daraus der Bauführer nur immer die gleichen drei Töne heraushörte in so unablässiger Wiederholung, daß er, völlig eingelullt, ohne Gegenrede alles hinnahm. Tidemunt sah ihm an, wie einige Bedenken wegen der kurzfristigen Kontrakte der beauftragten Firmen ihn bedrängten. Er beruhigte ihn vollends mit einem großartigen „Na, watt denn? Denn man to, Herr Inschenör!“ Und das war die Geländeformel für das büroliche „Also? Sodann!“
Ja, dieser Tidemunt! Summend wogte er von dannen, unangreifbar, selbst unter perfidesten Fachkollegen unwiderlegbar. Wie selbstherrlich stand er da! Ein Turm auf dem Deich in der Wandlung der Zeit, von keiner Brandung erreicht, die Brandung und die Wandlung überschauend und regelnd.
Hochbefriedigt knurrte er vor sich hin, als er nun sah, wie das unheimliche Heer der Greifer und Rammer sich keuchend auf Raupenketten in Marsch setzte, seiner Anordnung gemäß, und schwerfällig, aber genau in die neue Staffelung einschwenkte.
Schon graute der Tag. Das Licht der Tiefstrahler zog sich zusammen und war nur noch Lampe. Darunter hin erkannte man das Blankeneser Ufer aufhügelnd, zart von Aufstehfenstern durchlöchert. Im Osten aber fern ragten die Türme der Stadt; sie griffen wie bläuliche Finger ins Gewölk, das grau und bärtig den Morgen hintanzuhalten suchte. Tidemunts Lachen dröhnte über die Wiesen und vermischte sich dem wieder auflebenden Arbeitslärm.
Schon schwangen die am weitesten nach Westen vorgezogenen Greifer ihre Krallenrüssel in Gras und Kraut und schonten nicht Busch noch Zaun. Kiebitze flogen klagend auf und Enten, die im Grabenschilf genächtigt, und Kaninchen stoben davon, die unter einer Korbweide gewohnt. Kühe, die nachts auf der Koppel geblieben, drängten furchtsam brüllend dem Heckgatter zu.
Tidemunt sah, daß es Zeit sei, die Sachlage kraft seiner Eigenmächtigkeit vollends zu klären. Er stiefelte gewaltig zu den betroffenen Bauernhöfen hinüber und setzte sich mit dem ersten Morgenstrahl neben die Frühstücksnäpfe, legte die Unumgänglichkeit dar, deutete Unliebsamkeiten an, erfand Vorschriften, Zwangsgesetze, bezeichnete sie als ungerecht, aber unumstößlich, bot die vorbeugende großzügige Hand und nannte Summen, die jene, welche zu den bisherigen Landkäufen bewilligt waren, wesentlich übertrafen.
Sein Blut war diesem Boden entsprossen. Hier war seine Sprache daheim. Hier verstand man ihn, hier bedurfte es keiner behördlichen Formulare und Verhandlungen, die nur geschaffen scheinen, den Menschen zu verdrießen. Das übliche Mißtrauen wandelte sich langsam in ein schmunzelndes Entgegenkommen. Zuletzt waren die fünf, die es anging, beisammen. Er lud die Fuhre ins Gemeindebüro.
Indes nun der Anwalt den Wortlaut der Urkunden in die Maschine diktierte — seine Schreibhilfe sah aus wie Fräulein Macke — und jedermann froh war, daß hier ohne die gewöhnlichen Schwierigkeiten etwas geschah, und eine zufriedene Heiterkeit die verwetterten Bauerngesichter beseelte, saß Tidemunt, behaglich vor sich hinsummend, am Fenster.
Wie zufällig ließ er den Blick durch die gestärkten Spitzengardinen ins Freie gleiten. Da sah er ein seltsames Paar die Dorfstraße heraufkommen, einen Mann und ein Mädchen. Der Mann war lang und dürr und in seemännischer Kleidung, rotbärtig und einarmig und blies im langsamen Daherwandern auf einer kurzen dikken Tonflöte.
Zu vernehmen war nichts; das Geklapper der Schreibmaschine übertönte alles. Das Mädchen wirkte neben dem Langen überaus zierlich; Tidemunt dachte, es sei ein Kind. Er sah aber bald, es war wie eine Nonne gekleidet, in Schwarz und Weiß, aber Rock und Haube und Schleier waren fast gleichmäßig von grauem Staube überzogen. Das Gesicht unterschied er nicht deutlich, er sah nur, daß es sehr schmal und ein wenig bräunlich sei.
Auf einmal hörte er auch die Flöte, weiche, schwermütige Okarinatöne. Es waren nur drei Töne, die sich immer wiederholten, und waren die gleichen, die er die ganze Zeit vor sich hingesummt, seit er die Barkasse gen Böwerder gesteuert. Und nun wußte er auch, woher er sich dieses kleinen Themas entsann. Es hallte nicht nach aus den hastigen Geigenschreien von jenem Abend des Abschieds. Das Hauskonzert, darin sie erklungen, stieg in seiner Erinnerung auf, das letzte vor manchem Jahr, da seine Frau noch den Mut aufgebracht hatte, sich aus ihrer wachsenden Scheu herauszuwagen und die enge Dachwohnung mit erlesener Gesellschaft und schöner Musik zu weiten. Das Brahmssche Streichquartett in a-moll war es, und sie hatte einleitend auf das Hauptmotiv hingewiesen, auf die elegisch sich wechselvoll verzweigenden drei Töne F, A, E, die der dreizackige Leitstern des Komponisten gewesen, übernommen von seinem Freunde, dem Geiger Joachim. Die Bedeutung dieser drei Töne liege in der persönlichen Auslegung ihrer Bezeichnung als Anfangsbuchstaben für drei schwerwiegende Worte — so hatte sie gesagt —, für die drei Worte „Frei, aber einsam“. Ein Motto, fordernd und verzichtend zugleich, stolz und gnadenlos, ein rechtes Künstlerwort, das künstlerische Schicksal kennzeichnend.
Tidemunt sah sich behaglich im Hintergrund in einen Sessel gestreckt. Er hatte, als sie so wohllautend und geschickt ihren kleinen Vortrag hielt, ein angenehmes Gefühl von Besitz und Zugehörigkeit gehabt, überschattet nun von einem anderen Erlebnis in jenem gleichen Sessel, das in damals noch nicht vorgeahntem Zusammenhange damit stand. Frei aber einsam ...
Es war eine Ankündigung gewesen, er hatte es nicht erfaßt gehabt, er war so sehr ihrer sicher gewesen, so sicher wie seiner selbst. Wohl hatte er das fern Bedrohende nicht überhört, das Ausgeliefertsein, aber er hatte es einzig auf sich selber bezogen, auf frühe Versuchungen, aus denen er sich in die klare Zucht und Geborgenheit technischer Belange und des Staatsdienstes rechtzeitig abgesetzt. Frei? Nein, nicht frei, sondern aufs vernünftigste gebunden, beruflich wie menschlich. Und er war dessen froh gewesen. Einsam? Das schon eher, beruflich bestimmt, auch ohne rechte Freunde — bis auf die sonderlich schwebende Freundschaft des Stadtbaumeisters —, aber menschlich nicht einsam, sondern der lieben Sprecherin und Musikantin aufs innigste verbündet. Wie denn auch sie es nicht nötig hatte, frei und einsam zu sein.
„Frei und einsam?“ Es hieß „frei, aber einsam“. Hatte sie es nicht ausgesprochen? Ach, es kehrte sich um, es hieß „einsam, aber frei“. War es so? War es wirklich so mit ihr? Und wie nun war es mit ihm?
Читать дальше