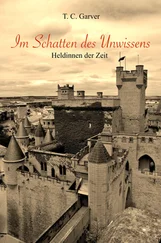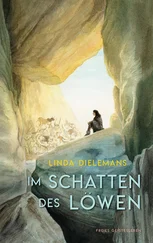„Es dauert noch etwas, Orsolya. Wir kommen gleich.“
Die Haushälterin blickte skeptisch zum Gebäudeeingang.
„Wir kommen wirklich gleich. Wir unterhalten uns nur gerade so gut.“
Die ältere Dame wunderte sich, aber drehte um und schimpfte:
„Als wenn wir keinen schöneren Platz zum Reden hätten als den muffigen Bau da. Aber gut …“
Máriska schloss die Stalltür und wandte sich Máté zu. Dieser saß auf einem Strohballen und blickte verlegen zu Boden. Sie kniete sich vor ihn.
„Was ist denn los mit dir? Haben wir etwas falsch gemacht? Habe ich etwas falsch gemacht?“, fragte sie in einem herzzerreißenden Tonfall.
Bekümmert schüttelte er den Kopf und hauchte mit belegter Stimme:
„Nein, du hast nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, du bist eine wundervolle Schwester. Ihr alle habt mich sehr glücklich gemacht.“
Sie setzte sich neben ihn, nahm dabei den schmelzenden Schneeball aus seinen Händen und umgriff seine kalten, nassen Finger.
„Versprich mir, dass du nie wieder an so was denken wirst. Bitte!“
Máté zuckte mit den Schultern und hauchte:
„Ich würde gerne allein sein.“
Máriska sagte traurig, aber entschlossen:
„Nein, den Wunsch kann ich dir jetzt gerade nicht erfüllen. Was ich gesehen habe, hat mich tief ins Herz getroffen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre nur ein paar Sekunden später hereingekommen …“
Sie hielt sich ihre Hände vors Gesicht und weinte bitterlich. Schuldbewusst nahm er sie in den Arm.
„Bitte beruhige dich, ich hatte den Gedanken fast schon wieder verworfen. Wirklich, ich schwöre es dir, weil ich an dich und Orsolya gedacht habe und daran, was ich euch vielleicht damit antue …“
„Vielleicht?“, schluchzte sie empört und starrte ihn dabei an.
„Vielleicht ist nicht das richtige Wort, Máté. Für mich wäre eine Welt zusammengebrochen und zwar sicher. Ich habe dich vor kurzem erst zurückerhalten, und ich liebe dich. Ich habe mich so nach meinem Bruder gesehnt. Nach all der verlorenen Zeit zu wissen, dass es dich gibt, aber du nicht herkommst, Geheimnisse hast, ich an deinem Leben nicht teilhaben darf – das war schrecklich für mich. Ich war so glücklich, als ich wusste, dass du wieder nach Hause kommen würdest und sich das alles nun ändern würde. Was ist so Schlimmes passiert? Vertraust du mir nicht?“
Er atmete tief durch und sagte beschämt:
„Es tut mir leid. Ich sagte doch, ich habe den Gedanken doch schon verworfen gehabt. Ich … ich vertraue dir, aber ich trage etwas wirklich Schlimmes in mir. Ein Geheimnis, eine Last; und jeder, der davon erfährt, wird ungewollt ein Teil von mir. Ich weiß nicht, ob ich dir das zumuten möchte. Ich habe Angst …“
Er zögerte weiterzureden. Die Gräfin lehnte sich an seine Schulter und führte ihre flache Hand auf seine Handinnenfläche. Ihre Finger hakte sie zwischen seine, dann nahm sie einen langen Strohhalm und legte ihn in besonderer Weise in Schlingen dazwischen.
„Verbunden auf ewig und für alle Zeit. Egal was kommt, wir sind bereit. Geknüpft, um zu halten, was in Treue versprochen, …“
„ … wird auch in Angst und Leid niemals gebrochen.“
„Ich habe es nie vergessen.“
„Ich habe mich gerade wieder daran erinnert.“
„Na, immerhin.“
Sie knotete eine Schleife an das Ende des Strohhalms.
„Lass mich teilhaben an deinem Geheimnis. Wir werden einen Weg finden, denn daran glaube ich solange, bis ich von etwas anderem überzeugt werde, und vorher löse ich den Knoten nicht wieder auf. Ich würde dir alles anvertrauen, wenn mich etwas belasten würde. Das Problem verschwindet nicht, aber man ist nicht mehr alleine damit.“
Eindringlich hing sein Blick an seiner Schwester, die ihre Nase ungeniert in den Rock schnäuzte und dann mit Stroh säuberte.
„Vielleicht sollten wir es verschieben, nicht dass Ervin gleich in den Stall kommt …“
„Der sitzt beim Nachmittagskaffee bei Orsolya. Sie wird ihn schon aufhalten, weil sie ja weiß, dass wir etwas zu bereden haben.“
Er stockte und umfasste liebevoll ihre zusammengebundenen Hände. Dann schaute er sie mit einem verzweifelten Ausdruck an.
„Ich trage eine schwere Last, die mich langsam erdrückt. Mit niemandem kann ich darüber reden. Solltest du wünschen, dass ich euer Haus sofort verlasse, wenn du die Wahrheit über mich erfahren hast, bin ich dir nicht böse.“
„Das werde ich nicht“, erwiderte sie beunruhigt.
Er zog das Strohgeflecht aus den Fingern, rutschte mit gesenktem Haupt vor ihr auf die Knie und flüsterte:
„Ich bin die Bestie von Wien.“
Dieser Satz kam nicht nur unerwartet, sondern sie zweifelte daran, ihn richtig verstanden zu haben.
„Was meinst du denn damit?“
Verzweifelt sah er sie an. Máriska schüttelte den Kopf und meinte:
„Wie kommst du denn auf so etwas?“
„Ich bin die Bestie von Wien und habe das Unheil nach Ungarn gebracht“, wiederholte er klar und deutlich.
Ihr fehlten die Worte. Eindringlich sprach er weiter:
„Ich habe heute Nacht zugeschlagen. Du musst mir glauben, denn ich bin derjenige, der unfassbares Leid über Familien gebracht hat. Es wurde von mir auf grauenhafte Weise gemordet und daran gehe ich zugrunde!“
Máriskas Gedanken waren mit dieser Nachricht überfordert, und so saß sie nur verstört und stumm da. Sie hatte mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Ungläubig strich sie ihm über den Kopf und fragte irritiert:
„Aber wieso solltest du das tun? Du bist so ein lieber und sensibler Mensch. Was bringt dich dazu …“
„Ich bin ein Werwolf“, unterbrach er seine Schwester weinend und vergrub sein Gesicht in ihrem Schoß, während er seine Finger verkrampft in den Stoff ihres Kleides krallte.
Máriska konnte nicht klar denken. Was hatte das alles zu bedeuten? Sie atmete tief durch und versuchte, die abstruse Aussage erst einmal nicht ganz ernst zu nehmen. Dennoch konnte sie sich seiner Verzweiflung nicht entziehen. So nahm sie ihn fest in die Arme, tupfte seine Tränen weg und ließ ihn weinen. Sie wehrte sich gegen das, was sie gehört hatte, und versuchte, etwas Sinnhaftes daraus zu machen. Vielleicht waren es Medikamente, die er einnahm und die seinen Geist verwirrten. Sie hatte gespürt, dass ihn von Anfang an etwas bedrückte. Es musste sich um seine Krankheit handeln, die ihn quälte. Vielleicht war er sogar verrückt oder drogenabhängig. Sie erinnerte sich an die seltsamen Bilder, die er gemalt hatte. Sorge und Ratlosigkeit machten sich in ihrem Kopf breit, denn gleichzeitig wurde ihr bewusst, dass es viele Geheimnisse gab. Aber dass er ein Werwolf sein sollte, schien ihr abwegig. Während sie ihn im Arm hielt, verirrten sich ihre Gedanken in die Zeit, als sie immer eine Antwort für ihn parat gehabt hatte, ihn trösten oder ihm jegliche Angst vor den täglichen Dingen des Lebens nehmen konnte. Jetzt hielt sie ihn wieder im Arm, aber seine Traurigkeit und Verlorenheit waren so unendlich groß, dass auch sie sich darin verlor. Sie musste herausfinden, was ihn bewog, so etwas von sich zu denken.
Nach einiger Zeit hatte er sich beruhigt und setzte sich wieder auf den Strohballen.
„Erzähle mir alles, auch wenn es gerade nicht leichtfällt, das zu glauben, was du gesagt hast. Wie kann ich dir helfen? Sollen wir zu einem Arzt gehen?“
Enttäuscht schluchzte er:
„Hast du mir zugehört? Ich bin ein Werwolf, eine Bestie. Ich zerreiße Menschen! Ich beiße ihnen sogar manchmal den Kopf ab!“
Er konnte an ihrem Blick erkennen, dass sie es nicht glauben wollte. Er schubste sie von sich, stand auf und wendete sich von ihr ab.
„Ach, vergiss es. Ich habe gedacht, hier finde ich jemanden, der mir zuhört, der mir glaubt und mich verstehen würde in meiner Not.“
Читать дальше