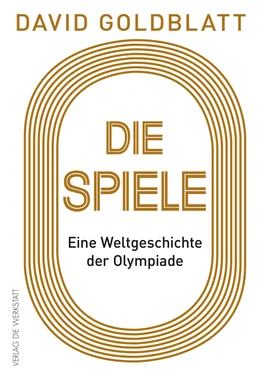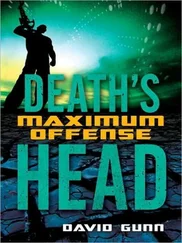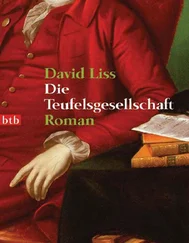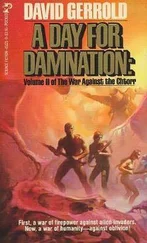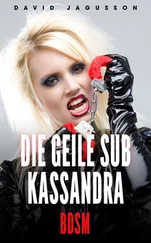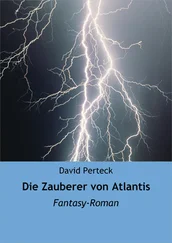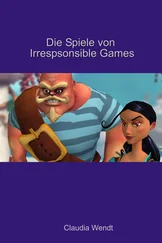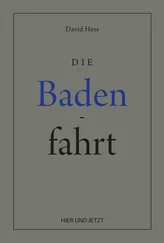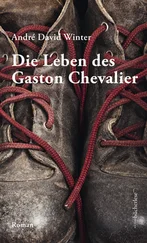*Colonel William Leake, ein erfahrener Militärkartograf, wurde von der britischen Regierung im Zusammenhang mit dem Schattenkrieg, den sie in der Region gegen die Franzosen führten, beauftragt, Albanien und die Peloponnes zu vermessen. 1805 erreichte er Olympia und unternahm eine umfassende und genaue Untersuchung der Stätte, deren Ergebnisse jedoch erst 1830 in seinen Travels in the Morea veröffentlicht wurden.
DREI
Europas Klassizisten und Gelehrte hatten die schriftlichen Aufzeichnungen über die antiken Spiele bewahrt und interpretiert, Archäologen und Altertumsforscher Olympia erforscht und ausgegraben, Literatur, Presse und Zirkus die Idee der Olympischen Spiele am Leben erhalten. Keiner von ihnen war jedoch auf den Gedanken gekommen, selber Spiele auszurichten oder die Kultur des antiken Sports mit den neuen Turn- und Leibeserziehungsbewegungen in Europa zu verknüpfen. Tatsächlich hatte es seit Robert Dovers Cotswold Games Mitte des 17. Jahrhunderts keine »Olympischen« Sportfeste mehr gegeben. Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde diese Idee in Deutschland, Frankreich und Schweden erstmals wieder aufgenommen. Doch die erfolgreichsten und einflussreichsten Bewegungen zur Wiederbelebung der Olympischen Spiele und diejenigen, die Coubertins eigene Vision nachhaltig prägten, entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien und Griechenland. Dort war die Idee der Olympischen Spiele an mächtige gesellschaftliche Kräfte gebunden: im britischen Königreich das Aufkommen der Sportethik und moralischen Tugenden des modernen Sports, in der noch jungen griechischen Republik das Nationalgefühl.
Auch in Frankreich wurde den Spielen neues Leben eingehaucht, jedoch mit ganz anderen politischen Vorzeichen. Dort wurde die Wiederbelebung von Charles-Gilbert Romme vorangetrieben, einem der führenden politischen Köpfe der Französischen Revolution. Mitglied des Nationalkonvents und Anhänger von Robespierre, war Rommes wichtigster Beitrag die Schaffung eines neuen, rationalisierten Revolutionskalenders, der jeglicher royalistischer und religiöser Bezüge entledigt war und die Dezimalisierung nutzte, die mit dem neuen metrischen System eingeführt wurde. Fünf zusätzliche Tage wurden ergänzt, um ihn ans Sonnenjahr anzupassen, und alle vier Jahre gab es einen Schalttag. Romme glaubte, der Schalttag wäre eine schöne Gelegenheit, um öffentliche Feste und Spiele zu veranstalten: »Wir schlagen vor, dies die französische Olympiade zu nennen und das letzte Jahr das Olympische Jahr.« 1Der Vorschlag fand großen Anklang unter Republikanern aller Couleur. Pierre Daunou forderte: »Lasst Frankreich diese herrlichen Festlichkeiten als die eigenen übernehmen. Es ist an der Zeit, diese heilsame Erfindung wiederzubeleben: Versammelt dort die Ausübungen von allen Spielen, Musik, Tanz, Laufen, Ringen.« 1793 sprach Georges Danton, damals Leiter des ersten Wohlfahrtsausschusses, vor dem Nationalkonvent: »Eingedenk der Olympischen Spiele, beantrage ich, dass der Konvent das Marsfeld für nationale Spiele zur Verfügung stellt.«
Danton würde bald seinen Posten und dann seinen Kopf verlieren, aber die Idee von Spielen auf dem Marsfeld lebte fort. 1796 veranstaltete Paris die Olympiade de la République (Republikanische Olympiade), ein Volksfest mit Sport und Wettkämpfen, das Hunderttausende Zuschauer anlockte. Le Monitor berichtete, dass »sie den jungen Spartanern glichen, die, in der Arena der Olympischen Spiele geschart, der versammelten griechischen Bevölkerung ein leuchtendes Beispiel der Sitten der Nation gaben«. Geboten wurden »Spiele, Rennen, Übungen voller Bewegung und Pracht«. Herolde, die im republikanischen Rot, Weiß und Blau gekleidet waren, kündigten die Wettbewerbe an; Militärkapellen begleiteten die Rennen. Ein Pariser Metzger gewann den Ringkampf, der Langstreckenlauf ging an einen Sergeant-Major. Die Sieger wurden mit Lorbeer gekränzt, bekamen in Frankreich gefertigte Güter wie Pistolen, Säbel, Vasen und Uhren und hielten eine Parade vor der Menge ab. Zwei weitere olympische Feste wurden durchgeführt, und 1798 gab es sogar Forderungen, die Spiele, ebenso wie die Revolution, ins benachbarte Ausland zu tragen. Aber 1799 kam Napoleon an die Macht, und für Spiele war keine Zeit mehr, bis Coubertin fast ein Jahrhundert später auf den Plan trat und eine seriöse und tragfähige olympische Erneuerungsbewegung anstieß.
Das viktorianische Großbritannien war die dominante Macht der Epoche und gleichzeitig Erfinder und Verbreiter zahlloser moderner Sportarten. Außerdem war man der Schmelztiegel der modernen Sportethik, die Leibeserziehung als ein wesentliches Element der emotionalen, moralischen und intellektuellen Entwicklung ihrer Elite betrachtete. Die Briten scheinen deshalb als der logische Katalysator für die Erneuerung der Spiele. Es waren aber nicht die von aristokratischen Sportsmännern und Klassizisten wimmelnden Privatschulen oder Universitäten wie Oxford und Cambridge, die die olympische Idee aufnahmen, sondern Dr. William Penny Brookes, ein Arzt und Friedensrichter aus dem kleinen Marktstädtchen Much Wenlock in Shropshire. 21850 rief er, als Unterabteilung der Much Wenlock Agricultural Reading Society, die Wenlock Olympian Class ins Leben, deren Ziel im Eröffnungsprotokoll dargelegt wurde: »Die Förderung der moralischen, körperlichen und intellektuellen Vervollkommnung der Bewohner der Stadt … mittels der Ermunterung zu Betätigungen im Freien und der jährlichen Verleihung von Preisen bei Volksversammlungen für Geschick in sportlicher Übung und industriellen Fertigkeiten«.
Noch im gleichen Jahr wurden die ersten Wenlock Olympian Games ausgetragen (und werden es, außer während der Weltkriege, bis heute). Überaus vielseitig, waren die Spiele eine Mischung aus ländlichem Volksfest und Schulsporttag. Die Teilnehmer waren Profis und Amateure, Männer und Frauen, Einheimische und Auswärtige, es gab Veranstaltungen für Jung und Alt. Auf dem Programm standen Cricket, Fußball, Bogenschießen, Hindernis- und andere Läufe, mit beträchtlichen Geldpreisen für die professionelle Variante der Wettkämpfe. Daneben gab es Rennen mit verbundenen Augen, Schubkarrenrennen und Sackhüpfen, Eselreiten, Blinde Kuh und, ganz besonders beliebt, das pseudomittelalterliche Ringreiten. Als die Spiele immer größeren Anklang fanden, ergänzte Brookes sie um Prozessionen und prunkvolle Umzüge, Gedichtwettbewerbe, Schießen, Radfahren und einen Pentathlon mit wechselnden Disziplinen.
Abgesehen von der einen oder anderen klassischen Referenz wie dieser, hatten die Spiele von Much Wenlock nur einen sehr losen Bezug zu ihren olympischen Vorläufern. Die Bezeichnung »Olympian« sollte lediglich ein für die viktorianische Zeit typisches soziales Unterfangen veredeln, das Bürgerstolz und Mäzenatentum, sinnvolle Freizeitgestaltung und Unterhaltung sowie Brookes aufrichtig empfundene Sorge um das Wohlergehen der armen Landbevölkerung und der urbanen Arbeiterklasse miteinander verknüpfte. 1860 wandte sich Brookes an die Bürgermeister von fünf Gemeinden in der Gegend und schlug vor, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam die Shropshire Olympian Games auszurichten. Diese wurden in den folgenden vier Jahren ausgetragen und lockten bis zu 15.000 Zuschauer an, bis die Spiele 1864 in Shrewsbury von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht wurden und mangelnder bürgerlicher Enthusiasmus das Ende der Shropshire Olympian Games bedeutete.
Über mangelnden bürgerlichen Enthusiasmus konnte sich der Liverpool Athletic Club nicht beklagen, der 1862 mit dem ausdrücklichen Ziel gegründet wurde, den Amateursport und die ritterlichen Tugenden des Fairplay zu fördern und sowohl die niederen Stände als auch die im Sitzen arbeitenden Skeptiker des Bürgertums von den Vorzügen der Leibeserziehung zu überzeugen. 3Die treibenden Kräfte des Klubs waren Charles Melly und John Hulley. Melly, der am Rugby College studiert hatte, einer Bastion der Sportethik, war ein umtriebiger Philanthrop, der die Stadt mit Trinkbrunnen, neuen Parks und Grünanlagen beschenkte und Sportanlagen bauen ließ. John Hulley war ein extravaganter, selbsternannter »Gymnasiarch« mit Hang zu ausgefallener Garderobe, der immensen Enthusiasmus für die moralischen und körperlichen Segen der sportlichen Betätigung hegte. Beide stimmten Juvenals inzwischen wohlbekanntem Motto mens sana in corpore sano zu – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – und nutzten es im Juni 1862 als Überschrift für eine Anzeige, mit der sie in der Liverpool Daily Post für ihr »Grand Olympic Festival« warben. Anders als in Much Wenlock gab es keine Geldpreise und Startplätze für Profis, sondern stattdessen Silber- und Bronzemedaillen für »gentlemen amateurs« und entsprechend gesalzene Ticketpreise. Die betuchte Klientel ergötzte sich an Hindernisrennen, Turnen, Fechten (mit Säbel und Schwert), Ringen und Boxen, Laufen, Springen und Cricketball-Wurf. »Das Komitee wird keine Mühen scheuen …, um ein Festival auszurichten, das sich seines unsterblichen Titels würdig erweist«, hieß es.
Читать дальше