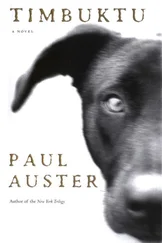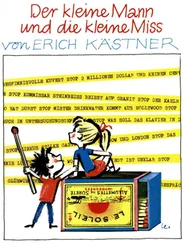Der Job des lonesome riders war streckenweise unkommod. Krieg, Erdbeben, Hochwasser, Ebola. Aber ich war gern Frontschwein. Die Chefs ließen mich meistens in Ruhe, und ich brauchte mich beim Schreiben auch nicht dem Zwang der Spiegel -Masche zu unterwerfen.
Journalisten hängen sich gern Weltkarten mit farbigen Pinnnadeln über den Schreibtisch. Die Nadeln markieren die Orte ihres Wirkens. Ich hatte nie eine solche Karte. Wenn ich eine besessen hätte, wäre sie schön bunt gewesen. Ich habe mal überschlagen: Von 53 afrikanischen Staaten habe ich 42 besucht, viele davon mehrfach, außerdem Nordamerika kreuz und quer, auch die Arktis und die Antarktis. In Europa habe ich alle Hauptstädte erlebt, mit Ausnahme von Minsk und Vilnius. Nur in Asien und Lateinamerika hätte meine Pinnkarte ein paar große weiße Flecken gehabt.
Der Mond und der Orbit fehlen mir auch in meiner Erlebnissammlung. Ich habe 1985 versucht, die Lücke zu schließen, und bei der NASA einen Antrag auf Teilnahme an einem Trip ins All gestellt. Die Antwort der NASA-Presseabteilung war unverbindlich. Man sehe keine Möglichkeit, mir meinen Wunsch zu erfüllen, jedenfalls »for the time being«. Man werde es mich wissen lassen, wann es so weit sei. Es wurde nichts draus, obwohl ich in Abständen von zwei bis drei Jahren nachhakte. Und irgendwann war ich auch zu alt für die Raumfahrt. Ich glaube, der Spiegel hätte das Unternehmen sowieso nicht bezahlen können.
Die summarische Aufzählung der besuchten Orte sagt natürlich nichts über den Horizont des Reisenden. Deshalb soll sie hier auch nicht vertieft werden. Alte Flugkapitäne und Stewardessen sind mehr herumgekommen als ich. Trotzdem sind sie vermutlich in Geografie auch nicht besser.
Warum reist der Mensch?
Auch ohne berufliche Verpflichtung wäre ich nie der Sesshaftigkeit erlegen. Es ging mir wie Ismael in Melvilles Moby Dick . Er hat seinen Reisetrieb so erklärt: »Immer wenn ich merke, dass ich um den Mund herum grimmig werde, immer wenn in meiner Seele nasser, nieseliger November herrscht, ist es höchste Zeit für mich, sobald ich kann, auf See zu kommen.« Ich brauchte, um aufzubrechen, noch nicht mal den nassen November.
Manchmal musste ich meine Zielkoordinaten im Flug ändern. Oder im Taxi. Wie nach dem Ausbruch der Ebola-Seuche in Zaire. Ich war auf dem Weg zum Hamburger Flughafen, um nach Zürich zu fliegen und eine Geschichte über heroinabhängige Banker und Broker zu recherchieren. Unterwegs rief das Auslandssekretariat im Taxi an. Ich solle nach Brüssel und von da nach Kinshasa fliegen, um die Ebola-Szene zu covern. Das Visum für Zaire sei in Brüssel hinterlegt. Am nächsten Morgen um sechs landete ich in Kinshasa.
Natürlich lässt mit den Jahren die Lust am Vagabundieren nach. Erst war für mich das Reisen »der Mai, der alles neu macht«, wie Thomas Mann schrieb. Zum Schluss war es nur noch schöner Eskapismus. Trotzdem genieße ich die Zigeunerei noch heute.
Peter Scholl-Latour reiste im Alter von 83 Jahren noch nach Ost-Timor. Er hatte den Ehrgeiz, auf seiner Pinnkarte alle Länder der Erde zu besetzen. Ost-Timor war das einzige Land, das er noch nicht besucht hatte.
Damit kein Missverständnis entsteht, ich habe mit diesem Buch keine Memoiren geschrieben, ich habe nur meine Erinnerungen aufgeschrieben. Memoiren werden im Allgemeinen von bedeutenden Personen der Zeitgeschichte verfasst, deren Bücher sich nicht durch Lust- oder Wissensgewinn bei den Lesern legitimieren müssen. Dies Buch soll Spaß machen. Es soll auch einen Eindruck davon vermitteln, wie Europas größtes und erfolgreichstes Nachrichtenmagazin und seine Crew ticken. Wer daraus lernen will, der mag es versuchen.
Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Es lässt die kleinen Gedanken durchfallen und hält die großen zurück. Was freilich keine Gewähr dafür ist, dass nicht auch mal etwas Kleingeistiges darin hängen bleibt.
Es war nicht allzu schwer, das Material für dieses Buch zu beschaffen. Ich hatte gute Quellen, die mir dabei halfen, meine Vergangenheit zu entblättern. Die drei besten waren mein Gedächtnis, die Spiegel -Dokumentation, in der alle meine Geschichten archiviert sind, und der Schuhkarton im Heizungskeller, in dem ich die alten Notizblöcke und Terminkalender verwahre.
Aus diesem Buch lernt man nicht, wie man ein guter Journalist wird. Denn dafür gibt es keine Regeln. Denen, die es interessiert, gebe ich hilfsweise einen Tipp: Am besten, man macht es wie Lutz Mükke aus Leipzig. Er kam im Frühjahr 2003 in mein Büro und sagte, er habe in Leipzig bei Professor Michael Haller Journalismus studiert und müsse jetzt für seinen Abschluss eine selbst recherchierte und geschriebene große Geschichte abliefern, sein Meisterstück sozusagen.
Mein Freund Christoph Maria Fröhder, Beisitzer der Interessenvereinigung Netzwerk-Recherche e.V. und grauer Terrier vom Dienst beim ARD-Fernsehen, hatte Lutz geraten, mich zu besuchen. Ich sei des Schreibens und des Zeitungmachens nicht ganz unkundig und würde ihm sicher gern mit Rat zur Seite stehen, wenn er das für nützlich hielte.
Lutz Mükke hatte sich ein verwegenes Thema ausgesucht. Er wollte darüber berichten, dass Äthiopien ein entwicklungspolitischer Trümmerhaufen sei und dort im großen Stil westliche Steuergelder verschwendet würden, weil es den flächendeckenden Hunger, von dem uns das Fernsehen und Karlheinz Böhm erzählten, in dieser Weise gar nicht gebe.
Ich war erschüttert über so viel jugendlichen Unverstand. »Ja, wo wollen Sie die Story denn verkaufen?«, habe ich ihn gefragt. »Das ist doch für den deutschen Zeitgeist ein Tritt in die Magengrube, das druckt doch keiner.« Lutz lächelte das Lächeln des Wissenden und verabschiedete sich.
Sechs Wochen lang habe ich von Lutz Mükke nichts gehört. Dann erschien in der Zeit ein sechsseitiges Dossier über Äthiopien: »Der inszenierte Hunger – von Lutz Mükke«. Eine tolle Geschichte.
Ich habe gleich in Leipzig angerufen: »Glückwunsch, Bruder«, habe ich gesagt. »Ich wollte Ihnen nur noch einen guten Rat nachreichen: Nehmen Sie die Ratschläge der alten Säcke nicht so ernst.«
»Feldmarschall Idi Amin, wie ich vermute«
»Finden Sie Idi Amin«, sagte Spiegel -Auslandsressortleiter Dieter Wild. Er holte einen Apfel aus seinem Pfeffer-und-Salz-Jackett, biss hinein und lächelte.
Ich lächelte zurück. Wild sollte nicht merken, dass ich weiche Knie hatte. Aber natürlich merkte er es doch. Er war ein gescheiter Kerl und ließ sich nicht täuschen.
Wild erklärte, er weise mich mit großem Ernst darauf hin, dass das Unternehmen auf der Basis absoluter Freiwilligkeit zu erfolgen habe. »Wir nehmen es Ihnen nicht übel, wenn es Ihnen zu gefährlich ist.« Schon die Formulierung war ein Stich in mein Pfadfinderherz. Ich und Angst. Er konnte sich darauf verlassen, dass ich den Auftrag nicht zurückweisen würde. Außerdem hatte ich ja selbst die Idee gehabt, den gestrauchelten Revolverpotentaten Idi Amin Dada aus Uganda im Exil in Tripolis zu suchen.
Warum lässt sich ein Journalist auf solche delikaten Extratouren ein?
Ich war meiner Reputation verpflichtet. Weil ich ein paarmal in Amins Residenz auf dem Kololo-Berg in Uganda zu Gast gewesen war und auch weil ich ein Buch über ihn geschrieben hatte, das sich ganz gut verkauft hatte, war ich beim Spiegel der Amin-Experte.
BBC hatte gemeldet, Big Daddy, wie er bei seinen Fans genannt wurde, sei nach seinem Sturz mit dem größeren Teil seiner Familie von Uganda nach Libyen geflüchtet, um sich dort unter den Schutz von Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi zu begeben. Es war nicht mehr als eine Vermutung. Keiner hatte ihn gesehen. Doch der bewohnbare Teil von Libyen ist nicht besonders groß. Wenn er wirklich da war, musste man mit ein bisschen Glück seine Spur aufnehmen können. Und im Übrigen war es auch dann eine gute Geschichte, wenn ich ihn nicht fand.
Читать дальше