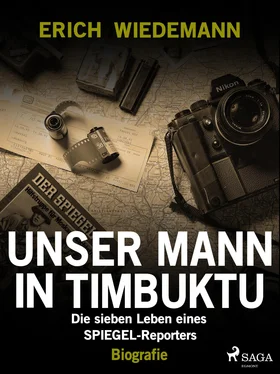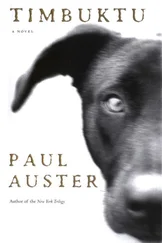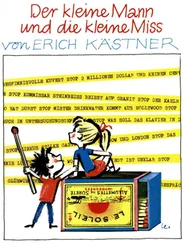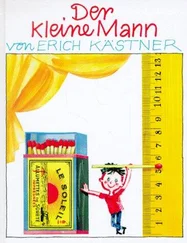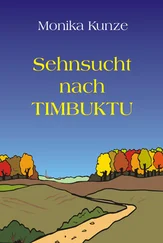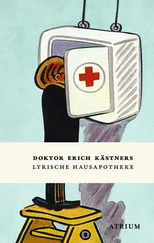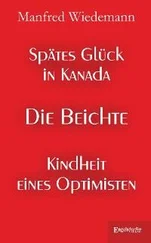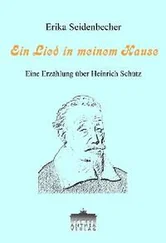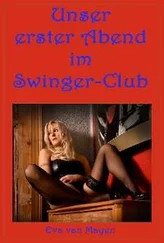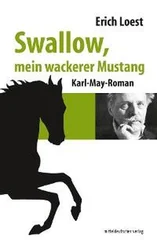Viele Reporter glauben, dass sie Literatur schaffen, wenn sie Zeitungsgeschichten schreiben. Dem ist nicht so. Von Ex- Spiegel -Verlagsleiter Hans-Detlef Becker ist der Ausspruch überliefert, eine Zeitung sei ein Nachrichtenträger und kein Lunapark. Er wollte damit sagen: Die Schönheit der Sätze ist erwünscht, aber sie darf nicht das Faktische dominieren. Ein guter Reporter muss beschreiben können, wie eine Spülmaschine oder ein Atomkraftwerk funktioniert. Wobei nicht jeder, der das kann, schon ein guter Reporter ist.
Früher mussten sich Zeitungsvolontäre einen Zettel mit den berühmten sechs Ws unter die Glasplatte auf ihrem Schreibtisch legen: Wer, Was, Wann, Wo, Wie, Warum. Kein nachrichtlicher Bericht ging ins Blatt, in dem diese sechs Fragen nicht beantwortet wurden. Und zwar nach Möglichkeit in der oben genannten Reihenfolge. Heute wird das Gott sei Dank nicht mehr so eng gesehen.
Meine interessantesten Geschichten waren nicht die erfolgreichsten. Und umgekehrt. Die zwei Jahrhundertschurken Idi Amin und Josef Mengele, die ich suchte, habe ich nicht gefunden. Das Bernsteinzimmer, dem ich monatelang nachspürte, auch nicht. Die Geschichten, wie ich mein Ziel nicht erreichte, fanden trotzdem ihr Publikum.
Das Copyright auf den Titel dieses Buches haben eigentlich die damaligen Kollegen der Hamburger Spiegel -Auslandsredaktion. Sie nannten mich »Unser Mann in Timbuktu«, obwohl ich nur zweimal dort gewesen war.
Timbuktu, die legendäre Oasenstadt in Mali am Südrand der Sahara, steht für die Wunder und Mysterien des schwarzen Kontinents. Sie ist nicht typisch für Afrika. Denn dazu ist sie zu schön. Der Stadtkern besteht aus 5000 Würfeln, die aus Lehm gebrannt sind. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert war diese Lehmagglomeration nach Kairo das zweitwichtigste Zentrum der islamischen Kultur in Afrika.
In der Bibliothek und in der Universität von Timbuktu lagern tausend Jahre alte Handschriften und Episteln. Norwegische und französische Bibliothekare kämpfen gegen deren Verfall. Doch der größte Teil der Bestände ist nicht zu retten.
Irgendwann wird die Sahara Timbuktu begraben. Von Norden her arbeitet sich die Wüste immer tiefer in die Stadt hinein. Ganze Straßenzüge sind bereits versandet. Weil Timbuktu wirtschaftlich keine Zukunft hat, ziehen die Menschen weg, und nur noch Sand wird Zurückbleiben.
Bei meinen zweiten Besuch anlässlich des Festival au desert, das jährlich im Herbst in Timbuktu stattfindet, war ich zu einem Leseabend ins Haus eines Archivars von der Sankoré-Bibliothek eingeladen. Eine junge Frau las aus Schriften des arabischen Reisenden Ibn Batuta aus dem 14. Jahrhundert. Ich bekam die Verführungskraft der arabischen Poesie zu spüren. Obwohl ich kein Wort verstand, war ich verzaubert, allein von der Melodie der Wörter.
Ich hätte gern einmal einen Spiegel -Artikel über die schöne Stadt geschrieben. Aber in all den Jahren ist es mir nie gelungen, eine Timbuktu-Geschichte ins Blatt zu kriegen. Kein Sex, kein Elend, kein Krieg, kein Doping – wer will eine Geschichte über eine Stadt lesen, die nur schön ist?
Ich hatte viele gute Jahre beim Spiegel , obwohl in dem grauen Betonhaus am Hamburger Sandtorkai gewöhnlich im Team gearbeitet wird und ich immer ein notorischer Solist war. Deshalb singe ich aber keine Oden an die Freude, beim Spiegel gearbeitet zu haben. Er und ich, wir sind einander nichts schuldig. Er hat mich ordentlich bezahlt, und ich habe ihm ordentliche Geschichten dafür geliefert. Die Arbeitsbedingungen waren gut. Doch unsere Beziehung war nicht das, was man eine Herzensangelegenheit nennt.
Ich wollte das auch gar nicht. Nestwärme kann leicht beklemmend werden. Weil viele das so ähnlich empfinden, schließen Spiegel -Redakteure auch nicht so schnell Freundschaft miteinander. Wirklich freundschaftlich verbunden war ich in all den Jahren nur dreien. Rudolf Augstein hat gelehrt: »Ein Journalist kann keine dauerhaften Freundschaften haben.« Keine Freunde, hätte ich nicht gesagt, aber nicht viele.
Als ich 25 Jahre beim Spiegel war, erschien Personalchef Eike Mahlstedt mit einem teuren Blumenstrauß in meinem Büro. Ich bedankte mich, und dann fragte er: »Wie lange wollen Sie denn eigentlich noch bleiben?« Für mich hörte es sich so an wie: »Merken Sie eigentlich nicht, dass Sie hier eine Planstelle blockieren? Machen Sie doch endlich Platz.« Ich antwortete: »Sehen Sie in meiner Personalakte nach. Da steht es drin, wie lange ich bleibe.« Nämlich bis zum »Ende des Monats, in dem Sie das 65. Lebensjahr erreichen«. Und so ist es geschehen.
Der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Frank Schirrmacher schrieb in seinem Buch Das Methusalem-Komplott: »Man wird vernehmbar über unsere Überzähligkeit diskutieren, über Euthanasie, über die letzten teuren Wochen in den Krankenhäusern.« Panikträume eines Angstpredigers? Ich glaube, dass die düsteren Prophezeiungen nicht übertrieben sind.
Im Umgang von Alten und Jungen gilt auch beim Spiegel das altersdarwinistische Grundmuster: Ein Reporter, der sich in den letzten fünf Jahren vor seiner Pensionierung noch um den Nachweis bemüht, dass er sein Geld wert ist, zeigt dadurch, dass er dem Altersstarrsinn verfallen ist. Widerspruch unterstreicht den Eindruck der Uneinsichtigkeit. Es ist so wie mit dem Teufel im Mittelalter. Wer ihn leugnete, bewies dadurch, dass er von ihm besessen war.
Die Gerontologen predigen den Mut zur Endlichkeit. In meinem Heimatort in der Lüneburger Heide haben wir einen praktischen Arzt, der mit Ende siebzig noch gebrochene Knochen schient und EKGs erstellt. Und in der Woche, nachdem sie mich relegiert hatten, wurden in Stockholm die Namen der Nobelpreisträger 2007 bekannt gegeben. Sieben der zehn Preisträger waren älter als ich, einer sogar 25 Jahre. Es gibt fast nichts, was ich in Amerika für besser halte als in Europa. Aber dass es dort ein Gesetz gegen Altersdiskriminierung gibt, das finde ich gut.
Anderen erging es nicht besser als mir. Einer hatte immer ein handschriftliches Vermächtnis von Rudolf Augstein in der Brieftasche. Darauf stand: »Der Redakteur Soundso darf so lange beim Spiegel arbeiten, wie er will.«
Mein Abschied nach 32 Jahren vollzog sich ohne Beigabe von rituellem Zierat. Ich verzichtete auf die übliche Feier, überwies stattdessen 500 Euro an Amnesty International und heftete die Quittung ans schwarze Brett.
Von den Kollegen erhielt der Verrentete trotzdem das obligate Abschiedsgeschenk: ein Spiegel -Cover mit einem Foto-Cluster und einer passenden Schlagzeüe. Meine lautete: »Wiedemann – drei Jahrzehnte auf der Suche nach der Wahrheit«. Auf einem Bild lag der Laureat hinter einem schweren MG in der Wüste von Nevada, das zweite zeigte ihn untertage in England mit Streikbrechern. Auf dem dritten stand er breitbeinig und mit verschränkten Armen vor dem Haupteingang der Moskauer Prawda . Für den, der es nicht weiß: »Prawda« ist russisch und heißt »Wahrheit«.
Als ich in den Ruhestand ging, ließ ich im Stehsatz vier Reportagen zurück, die nicht mehr gedruckt wurden, obwohl sie bei meinem Abgang alle nicht älter als drei Monate waren. Für die teuerste davon, eine Reportage über die Elefantenschwemme im südlichen Afrika, hatte der Spiegel rund 5000 Euro für Spesen ausgegeben.
Samstag, der 29. September 2007. Meinen letzten Arbeitstag verbrachte ich in Oslo. Es war ein goldener Herbsttag. Die Sonne schien in Strömen, die Frauen trugen luftige Jungmädchenkleider. Zu schön für Ultimo. Meine Stimmung war schlecht. Fast alles, was ich an diesem Tag tat, tat ich zum letzten Mal.
Vormittags um zehn führte ich ein Interview mit zwei exilburmesischen Radioaktivisten, die beim Aufstand der Mönche in Rangun per Internet eine Nachrichtenbrücke von Burma zum Rest der Welt geschlagen hatten. Danach ging ich mit dem Fotografen, der mich begleitete, in dessen Wohnung und schrieb meinen Text auf seinem Apple. Um zwei war die Geschichte fertig, meine letzte Spiegel -Geschichte in 32 Jahren. Dann ging ich zu McDonald’s und kaufte mir einen Double Cheeseburger und eine Cola. Das Menü war so teuer wie ein Mittagessen mit drei Gängen und einem Glas Riesling im Block House in Hamburg. Während ich den Burger mampfte, rief die Dokumentation auf meinem Mobiltelefon an und teilte mir mit, dass ich den Namen des Ministerpräsidenten falsch geschrieben hätte und dass es nicht »birmanisch«, sondern »burmesisch« heiße. Ich war mit den Korrekturen einverstanden.
Читать дальше