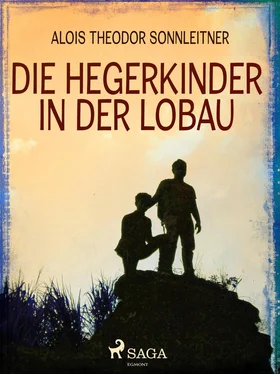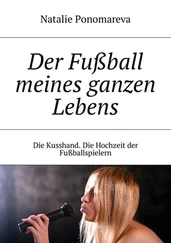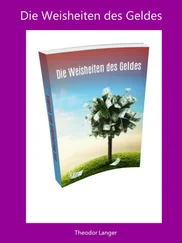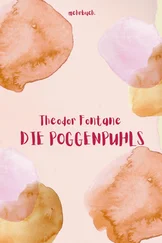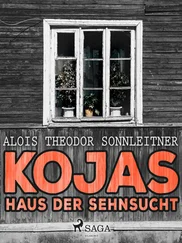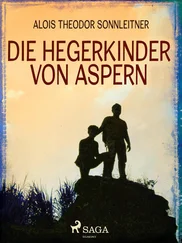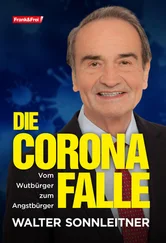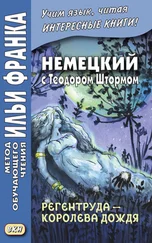Bald waren die vier Kinder aneinander gewöhnt und fühlten sich als Geschwister, als wär’ es immer so gewesen. Es zeigte sich aber, wie grundverschieden die beiden Gaminger waren. Der grössere und jüngere der beiden, der blonde Sepperl, schloss sich mehr an Liesel an, half ihr in der Küche und beim Spielen mit der Puppe und liess sich von ihr zum Stricken und Häkeln abrichten. Der kleinere, um ein Jahr ältere, dunkelhaarige Franzel aber wurde der Arbeits- und Spielgenoss Bertels, mit dem er die Stall- und Hausarbeiten erledigte und in der gewonnenen Musse die neue Heimat durchstreifte. Das Wasser hatte sich vom Auwald und von den Wiesen fast ganz in seine schilfumbuschten Rinnsale zurückgezogen. Nur der staubgraue Überzug von Ton, denes auf Gräsern und Baumrinden zurückgelassen hatte, verriet, wie weit die Überschwemmung gegangen war. Die grauen Wiesen machten einen trostlosen Eindruck. Franzel sagte es dem Pflegebruder unverhohlen, dass ihn die neue Umgebung anödete. Immer wieder verglich er das Auland mit seinem geliebten Gamsgebirge. Hier der fahle Rasen, in dem nur vereinzelt verblühte Schneeglöckchen standen, von Primeln und Leberblümchen keine Spur! Graurindige, kahle Bäume und alles flach, alles eben. Dort im Gamsgebirg fichtenbegrünte Berghöhen, darüber von Schneebändern gestreifte Steinwände, mit gleissenden Firnfeldern bedeckte Hochgipfel und Bergrücken; als Riese unter den Bergen der breite Ötscher, der „Hetscherlberg“ mit seinen geheimnisvollen Höhlen, dem Geldloch, dem Taubenloch, der Eishöhle. Hier Sumpfland und stille, schilfdurchsetzte Wasser, dort murmelnde, rauschende Bäche mit springenden Forellen. Die Erlaf gischtete zwischen den felsigen Tormäuern und Stierwaschmäuern. Und zur Erlaf rieselten plaudernde Quellbäche nieder, ungezählte! In die Erlaf ergoss sich die Treffling als weissstäubender Wassersturz. Ihr eilte die Lassing zu, die mit Getös von turmhoher Felsenkante hinunterdonnerte. Im Moose des Bergwaldbodens wuchsen grossblumige Schneerosen, die schon zu Weihnachten ihre Knospen durch den Schnee bohrten und dann lange fortblühten, erst blendend weiss, dann rötlich und zuletzt gar grünlich. Die sonnigen Steinhalden waren schon zu Ostern rot von blühenden Heideln und blutroten Schlüsselblümchen; und auf den Rasenbändern der Felswände sprosste das gelbe Petergstam, die Goldprimel, eine Verwandte der Schlüsselblumen, von denen sie sich durch die fleischigen ganzrandigen Blätter, die mehligen Blütenschäfte und durch ihren Duft unterscheidet; die Leute nannten sie „Gamsveigerl“, weil sie gar so lieb duftet; unten am Waldesrand gab es Leberblümchen, die meisten dunkelblau; auf der Gaminger Schlossleiten waren auch rote und weisse. Und hoch droben im Gefels standen äsende Gemsen, die einen Steinhagel niederprasseln machten, wenn sie flüchtig hinwegsetzten über die Geröllhalden.
Wenn das Heimweh den Franzel so recht packte, suchte er den Bruder auf und stimmte mit ihm eines der Alpenlieder an, die sie in der Gaminger Schule gesungen hatten: das Holzknechtlied oder die Hahnbalz, ’s Almlüfterl oder den Almfrieden1 . Franzel sang die erste, Sepperl die zweite Stimme; leise begannen sie das Lied, liessen die Töne anschwellen und in stiller Wehmut verklingen:
Pedergstam, fein wia Gold,
Blüaht schon fruah unterm Schnee
Almrausch und Enzian
Drobn auf der Höh;
Edlweiss, Sternderl feins,
Bist’ leicht vom Himmel g’fall’n?
Bist unter d’Blüamerln doh
’s schönste von alln.
Hoch auf’n Felsenzock
’s Gamserl so lusti springt,
Und von meim Juchazer
’s Echo verklingt.
Und wann i furt muass bleibn.
Packt mi fest ’s Hoamweh an,
Halt mi mit aller G’walt,
Möcht’ glei davon!
Die vier letzten Zeilen hatten sich die Brüder eigenmächtig angepasst, wie sie’s jetzt fühlten. Anders hatten sie’s in der Schule gelernt; jetzt waren sie fort aus der Heimat; aber dem Heimweh waren sie nicht entgangen. Immer wieder war es Franzel, der von Gaming zu reden anfing wie von einer schöneren Welt.
Bertel beschlich ein Gefühl der Beschämung, wenn er Franzel die Herrlichkeiten seines Gamsgebirgs so rühmen und die geliebte Lobau schmähen hörte. Und er suchte sein Prahlen zu übertrumpfen.
Aber soviel er ihm auch von den rotgoldig und kupferig befiederten Fasanen erzählte oder gar von den Königsfasanen mit meterlangen Stossfedern, von den Rudeln der Rehe in den Stadlauer Auen, von den vielen Hirschen auf der grossen Insel Lobau, von den Kolonien der Fischreiher, der Krähen und Kormorane hoch oben in den alten Silberpappeln des Rohrwörth1 , er vermochte das Heimweh des Gebirglers nicht zu bannen, weil ihn der noch durchnässte Boden daran hinderte, den Franzel dorthin zu führen, wo das Wild seine Wohngebietehatte. Da zeigte er zunächst dem unzufriedenen Vetter in der Dammböschung die vielen mit Steinen verkeilten Kaninchenlöcher, aus denen der Vater mit Hilfe der zahmen Frettchen oft die „Künigl“ herausgetrieben hatte, und machte ihm Hoffnung auf die Teilnahme an der Jagd auf dieses Kleinwild, von dem der Heger unverrechnet abschiessen durfte, soviel er wollte. Dann zeigte er ihm von der Dammhöhe aus die Türme des Schlosses Kaiser-Ebersdorf, von dem aus Napoleon im Neunerjahr die Schiffsbrücke über die grosse Donau nach der Lobau-Insel geschlagen hatte, jene Schiffsbrücke, auf der das Franzosenheer vom rechten aufs linke Donau-Ufer hinübermarschiert war. Er erzählte ihm, dass die Österreicher die Brücke in Brand gesetzt hätten, und zwar durch brennende Schiffsmühlen, die sie stromabwärts treiben liessen. Aber, nachdem Napoleon sie hätte wiederherstellen lassen, wär’ die Donau arg angeschwollen und hätte die Brücke durch schwimmende Eismassen vernichtet.
Eines Tags gingen die Knaben stromaufwärts, immer auf der Dammhöhe, von der aus der Blick frei war über die grosse Wasserfläche. Noch war das Inundationsgebiet1 überflutet und einzelne Weidensträucher, die auf dem Schotterland wuchsen, wippten im ziehenden Wasser. Franzel, der zwar schon den ruhigen Erlaf-See, aber noch nie so viel strömende Flut gesehen hatte, machte grosse Augen.
Seine Blicke wanderten über die splitterige Wasserfläche hinüber nach dem ungeheuren Häusermeer der Wienerstadt mit dem Stephansturm und der Rotunde. Und als er den Leopolds-, den Kahlenberg und den Bisamberg erspähte, da rief er aus: Jöi, da san ja aa Berg!“ Er liess einen Jodler steigen, der weithin hallte über Wässer und Auen. Der Jauchzer des Bergbuben war auch im Buschwirtshaus des Roten Hiasels vernommen worden. Da kam Hiasel, der Bub des Wirtes, auf den Damm. Der Hegerbertel winkte ihn herbei. Hiasel und Franzel gefielen einander. Hiasel zeigte dem Neuen den Holzschuppen beim Haus, dessen Bretter von einer alten Schiffsmühle herrührten, die in der Franzosenzeit am Wasser gestanden war. Dann übernahm er die Führung ins noch feuchte Auland.
So rückten die drei Jungen nordwärts vor, bis sie zu dem vom Hochwasser zerstörten und erst am Vortage wiederhergestellten Stege kamen, der über die Alte Naufahrt auf den Grossen Biberhaufen führte. Auf dem Stege standen sie stille. Hiasel erspähte einen armlangen Hecht, der regungslos im seichten Wasser der Strömung entgegenstand, auf die kleineren Fische lauernd, die sich ahnungslos vor ihm herumtrieben, weil er einem im Wasser schwebenden Holzknüttel glich, der graugrün war von Schlamm und Algen. Hiasel winkte den beiden Kameraden, sie sollten stille sein, streifte seine Schuhe und Strümpfe ab und schob die Beinkleider bis über die Knie hinauf. Er stieg leise hinter dem Hecht ins Wasser. Dass es noch kalt war, kümmerte ihn nicht. Behutsam bewegte er sich vorwärts, um ja nicht durch eine Welle des Hechtes Aufmerksamkeit von den belauerten Fischen abzulenken. So unmerklich setzte er Fuss vor Fuss, dass die Jungfische ahnungslos um seine nackten Beine herumschwammen; er zuckte auch nicht, wenn sie neugierig an seine Haut stiessen. Als er so nahe hinter dem Hechte stand, dass er die von der wedelnden Schwanzflosse erzeugten Wellen an seinen Schienbeinen spürte, senkte er leise seine Hände ins Wasser, als wollte er den Hecht beim Schwanze packen. Mit angehaltenem Atem folgten Bertels und Franzels Augen den schleichenden Bewegungen Hiasels. Jetzt hing der Erfolg vom glücklichen Griffe ab. Hiasel hatte Geduld und Selbstbeherrschung. Langsam, ganz langsam rückten seine Hände zu beiden Seiten des Fisches vor, ihn beinahe, aber doch gar nicht berührend. Erst als er seine Daumen neben den Kiemendeckeln des Fisches sah, die sich beim Atmen bewegten, griff er herzhaft zu. Beide Daumen bohrte er ihm unter die Kiemendeckel und schloss die Finger um die Kehle. Mit jähem Ruck hob er den zappelnden Fisch aus dem Wasser, drückte ihn mit der Linken gegen einen Stein, hob mit der Rechten einen Kiesel auf und tötete den Hecht durch einen Schlag auf den Kopf.
Читать дальше