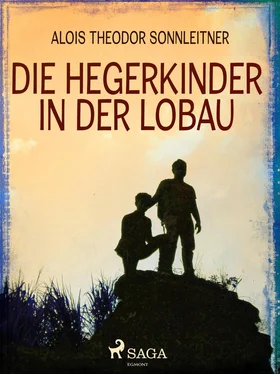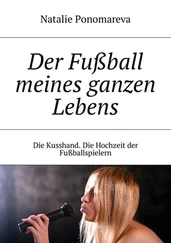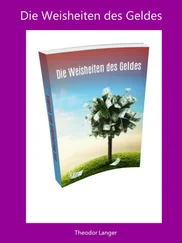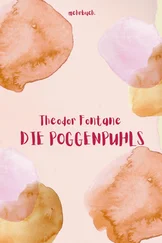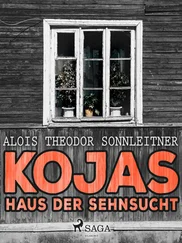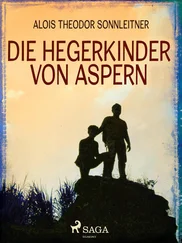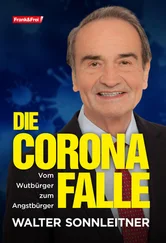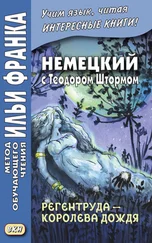Schneller als er aufgestiegen war, glitt und rutschte er am Stamme hinab, dass sich Stücke der abgestorbenen Rinde ablösten und das Wurmmehl den in die Höhe starrenden Kameraden in die Augen stäubte. — Als er unten stand, atmete er tief und heftig. Seine Knie waren blutig verschrammt. Die Finger beider Hände, unter deren Nägeln das Blut hervorsickerte, steckte er in den Mund und lachte Hiasel an. Der war sprachlos vor Staunen. Bertel aber sprach vor sich hin: „Dass’s so was gibt?“ Und jetzt fand auch Hiasel den Ausdruck für seine Anerkennung: „Bist halt ein Steiger, ja.“ Der Gebirgler war mit der Lobau ausgesöhnt.
Als er und Bertel sich bei der Schenke von Hiasel verabschieden wollten, enteilte dieser ins Haus und rief ihnen von der Schwelle aus zu: „Wart’ts a wengerl.“ — Und im Nu war er wieder da. Den Hecht, den er bisher getragen hatte, reichte er dem neuen Freund: „Da hast, Steiger, i gib dir’n; der Vater hat’s erlaubt.“ Da nahm der so Beschenkte einen der weichfilzigen Blumensterne, die er hinter der Hutschnur stecken hatte, und reichte ihn dem Hiasel: „Heb’ das Edelweiss gut auf, es is vom Hetscherlberg.“
Auf dem Heimweg musterte Franzel an der Nordseite des Regulierungsdammes wieder die vielen Löcher, welche von den wilden Kaninchen darein gegraben worden waren. Voreilig versprach ihm Bertel, der Vater werde ihm, dem Franzel, erlauben, dass er sie abschiesse. Da leuchteten die Augen des Wildschützensohnes auf. Hatte ihm doch der Neunteufel auf der Herfahrt vorgefaselt, beim Hegeronkel dürft er schiessen, was er wollte: Hasen, Fasanen, Reh und Hirsche. Als die beiden daheim anlangten, kam ihnen Liesel freudestrahlend entgegen: „Der Sepperl hat das Strumpfstricken g’lernt. Er kann auch schon die verkehrten Maschen und ’s Abnehmen!“
Als Bertel und Franzel ihren Fisch der Hegermutter in die Küche brachten, fanden sie Sepperl nicht etwa beim Strumpfstricken, sondern vor einer umgestülpten Kiste, die er für Liesels Puppen als schöne Stube herrichtete. Eine Feigenkaffee-Schachtel, in deren Ecken er vier Stäbchen eingenagelt und die er mit weissem Papier überklebt hatte, war der Tisch, ein Brettchen mit vier Füssen und hoher Lehne, von der ein rotes Tuchrestel über den Sitz wallte, war der Diwan.
Da sassen die zwei Puppen beim Kaffee, der in grossen Eichelnäpfen aufgetragen war, und hatten einen Gugelhupf vor sich, so gross wie ein halber Apfel. Es war ein richtiger Gugelhupf, den die Liesel gebacken hatte. Und oben auf der Kiste, also über der Zimmerdecke, lag Huscherl, die graue Hauskatze; sie hatte ein himmelblaues Halsband um und schien mit Eifer jeder Handbewegung Sepperls zu folgen, der dabei war, aus einem alten Zigarrenkistchen eine Anricht — oder, wie Liesel sagte, — eine Kredenz herzustellen.
Franzel und Bertel widmeten sich dem Putzen und Ausweiden des Hechtes. Als die zweiteilige Fischblase zum Vorschein kam, riss Franzel sie heraus, warf sie auf den Tisch und schlug mit der Faust darauf, dass sie mit lautem Krach zerbarst. Das klang wie ein Schuss. Die Katze sprang von der Kiste und verkroch sich unterm Wasserbankel, Liesel und Sepperl aber liessen vom Puppenspiel ab und wendeten ihre Aufmerksamkeit dem Fisch zu. Da zog Bertel zwei gelbliche Lappen aus dem Bauche des Hechtes, die aus vielen, vielen kleinwinzigen Kügelchen bestanden. „Mutter, da hast den Rogen für die Suppen.“ — Die Hegerin aber fragte die Kinder: „Welches von euch kann mir sagen, was der Rogen eigentlich ist?“ — „Eigentlich?“ — Keines wusste eine Antwort. „Denkt an die Henn’,“ half die Mutter darein. „Sollte der Rogen der Eierstock sein?“ fragte Liesel. „Es is nit anders. Jedes gelbe Kugerl ein Ei.“ „Wann die Hechtin am Leben blieben wär’ und aus jedem Eierl wär’ ein Hecht gewachsen,“ warf Bertel ein, „da hätt’s ja von lauter Hechten in der Naufahrt gewurlt. Die hätten aufgeräumt unter den anderen Fischen und schliesslich hätten s’ verhungern müssen oder eins das andre auffressen!“ — „Es wär’ nit so arg worden,“ beruhigte ihn die Mutter, „die meisten jungen Hechterln wären ja gefressen worden von der ältern Verwandtschaft. Glaubst, so ein hungriger Hecht macht einen Unterschied zwischen gewöhnlichen Spennadlern1 und jungen Hechten?“ — Da meldete sich Liesel: „ Mutter, darf ich ein Ei nehmen, ich möcht’ den Fisch panieren.“ Die Mutter nickte. Kochenspielen ging der Liesel über alles. Flink wusch sie den Fisch, salzte ihn und zerteilte ihn in sechs gleich grosse Schnitzel, die sie mit Mehl bestäubte. Dann zerschlug sie ein Ei, tat Dotter und Eiweiss in einen Teller und verrührte sie mit einer Gabel. In die klebrige Flüssigkeit tauchte sie die Schnitzel, damit die Semmelbrösel gut daran hafteten. Aus prasselndem Schweineschmalz knusperig gebacken, duftete der Fisch, dass allen „das Wasser im Munde zusammenlief“. Wenn auch Liesels Schnitzel nur als zarte Leckerbissen das Abendmahl vervollständigten, sie war glücklich, dass allen schmeckte, was sie gebacken hatte. Das Vorgefühl hausfraulicher Freude strahlte aus ihren Augen.
Da durch die Wiederherstellung des Steges über die Furt in der Alten Naufahrt der bereits trockene Biberweg nach Aspern gangbar geworden war, konnten die Hegerkinder nun wieder zur Schule.
Franzel und Sepperl waren wenig erfreut darüber, dass der Oberlehrer Wagner, ein grosser hagerer Mann mit ernstem Geschau, sie in die eigene, nämlich in die Oberklasse aufnahm. Sein bis auf den Schnurrbart glattrasiertes Gesicht machte auf sie den Eindruck grosser Strenge; und die Stille, die in der Klasse schon vor Unterrichtsbeginn herrschte, wirkte auf sie unheimlich. In Gaming war es anders gewesen. Bertel machte die Brüder auf das neunjährige blasse Söhnchen des Oberlehrers aufmerksam, auf den Hansi. Er erzählte ihnen, dass der Bub schon ein richtiger Organist war. Bei der Schulmesse musste Hansi die Orgel spielen, wenn ihn auch in den Fingern fror und in den Füssen, mit denen er die Pedale nur erreichen konnte, wenn er ganz am vorderen Rand der Orgelbank sass. Da half kein Weinen. Der Vater war streng, sehr streng. Bewunderung und Mitleid waren es, wodurch sich die stämmigen Gebirgler zu dem so ganz anders gearteten Musikerkinde hingezogen fühlten. Sie selbst erweckten durch ihre fremdartige Tracht und durch ihr Gebaren Hansis Aufmerksamkeit. Dazu kam, dass durch Hiasels Erzählung die unglaubliche Kletterleistung Franzels und durch Liesels Prahlen auch Sepperls Geschicklichkeit im Strumpfstricken bald bekannt wurde. So zeichneten sich in Hansis Augen die beiden Neuen als Besondere aus und die Bekanntschaft war schnell gemacht.
Die Asperner Schuljugend war ein Völklein für sich. Sie hatte nun zwei Fremde in ihren Kreis aufgenommen und mit sicherem Gefühl Eigenheiten an ihnen herausgefunden. Aber diesmal war es kein äusseres Kennzeichen, wie bei Hiasel die Haarfarbe, es waren die Tätigkeiten, die zur Namensgebung führten. Der ältere der Gaminger Gschaider hiess bald nur mehr der „Steiger-Franzel“, der jüngere „Stricker-Sepperl“. So waren die drei Gschaider-Buben wohl voneinander unterschieden. Als der Oberlehrer Wagner, der sich auf Namensdeutung verstand, von den neuen Namen erfuhr, benützte er die Gelegenheit, die Entstehung ihres Familiennamens zu erklären. Danach hiessen die Hegerkinder nicht etwa darum Gschaider, weil sie gescheiter waren als alle anderen; das sollten sie sich ja nicht einbilden; sondern sie stammten alle von einem Gebirgsbauer ab, der sein Haus auf einer Wasserscheide gebaut hatte, auf einem Bergsattel, an dem die Quellwässer sich teilten. Ein Bach floss links, der andere rechts hinab zu zwei durch den Höhenzug getrennten, vom Sattel vereinten Tälern: Gschaid, Gescheide. „Gschaider ist ebenso ein Geländename wie etwa Lehner oder Lechner oder Lahner, das ist einer, der auf einer Lehne (Lahn) haust.“ Da meldete sich ein Knabe: „Bitt’, der könnt’ ja auch Leitner heissen; statt Lehne kann man auch Leiten sagen. Ich kenn’ einen Eisenbahner, der heisst Bachleitner.“ — „Richtig, und der könnt’ wieder Achleitner heissen; weil Ach soviel als Bach oder Wasser bedeutet. Wer weiss noch andre Geländenamen?“ Da kamen die Beiträge von allen Seiten: Berger, Schönberger, Unterberger, Puchberger, Weinberger und Wimberger. Nun fragte ein Mädchen dazwischen: „Wim? was soll denn Wim heissen?“ — „Nichts andres als Wein; ist doch heute noch das alte Wort ,Wimmat’ gebräuchlich für Weinernte; und der Name Wimmer für Weinbauer.“ Der Oberlehrer fuhr fort: „Wie haben die Leute früher statt „Hügel‘ gesagt?“ — „Bühel, Biegl oder Pichel.“ — „Daher?“: „Bühler, Pichler, Schönbichler, Biegler.“ Die Förstergretel meldete sich von der Fensterreihe her: „Bitt’, ich kenn’ einen Greissler in der Brigittenau, der heisst Goldbiegler.“ Der Oberlehrer nickte ihr zu: „Und in Perchtoldsdorf gibt es dazu den Goldbieglberg. Wüssten die Perchtoldsdorfer, dass Biegl ohnehin schon Hügel oder kleiner Berg bedeutet, so würden sie sich den Zusatz — ,berg‘ wohl ersparen.“ — Der Feitsinger Franzl brachte noch die Beiträge Riegler, Steinriegler, Reiner und Reininger.
Читать дальше