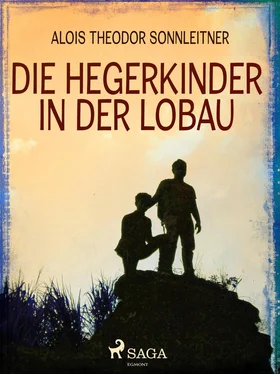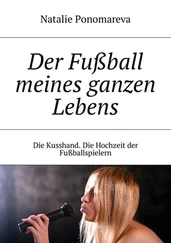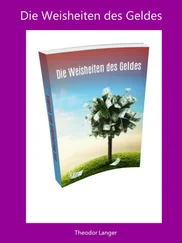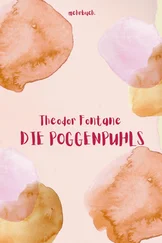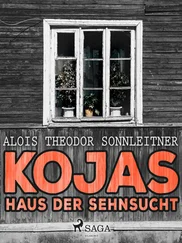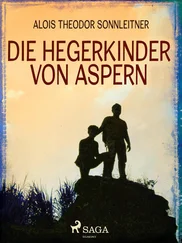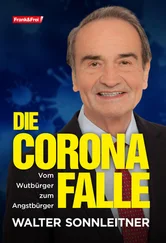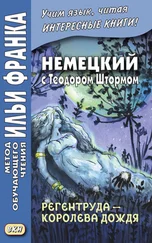Wieder einmal zur Namensforschung angeregt, zappelten die Kinder vor Ungeduld und einzelne schwenkten die hochgehobene Hand, um ihren Beitrag anzubringen; noch verweilten sie bei den Geländenamen: „Auer, Schönauer, Fischauer, Ecker, Rosegger, Landegger, Brucker, Neubrucker, Bruckner, Thaler, Freuntaler, Apfeltaler.“ Dann rückten sie mit den bekannten Standesnamen an: „Bauer, Schneider, Müller, Beck, Jäger, Schmidt, Schmiedl, Koch, Meier.“ Und Bertel, der den Namen Meier zu erklären bekam, wusste richtig zu sagen, dass der eigentlich vom lateinischen maior, der grössere oder ältere, also der für eine Hauswirtschaft Verantwortliche, abstammte; das hatte er sich seit dem Vorjahre gemerkt. Da warf der Oberlehrer die Frage ein, wer noch wüsste, was der Name Schulz ursprünglich bedeutet hätte. Aber kein Kind, ausser Hansi, dem Söhnchen des Oberlehrers, wusste mehr die vor Monaten gegebene Erklärung. Er ging zur Tafel und schrieb an: Scultheizo. „So haben die alten Deutschen erst den Schuldeneintreiber, den Richter, genannt, weil er die anderen die Schuld zahlen geheissen hat. Erst später hiessen die Bauermeister, die Dorfrichter, so und die Bürgermeister in den Städten.“
Nach der Aufzählung und Erklärung von allerlei Namen, die von persönlichen Eigenheiten herrührten, wie Langbein, Kurz, Trampler, wagten sich einzelne Kinder mit Fragen hervor über Namen, die ihnen als rätselhaft aufgefallen waren. Da hatte einer über einem Taschnerladen in der Leopoldstadt den Namen Rinőssl und gleich daneben überm Schuhmacherladen Hasenöhrl gelesen. „Nun, Össl und Öhrl ist vielleicht eins und dasselbe, der eine mochte ein krankes, rinnendes Ohr gehabt haben, der andre lange, schmale, verdrückte Ohren, in denen ein Witzbold eine Ähnlichkeit mit Hasenohren gesehen hatte. Es kommt ja im Deutschen öfter vor, dass ein R durch ein S ersetzt wird oder umgekehrt. Denkt nur an unser Lied vom Scheiden. Darin heisst es: „So dir geschenkt ein Knösplein was . . .“ Da habt ihr noch die alte Mitvergangenheit „was“ vom Zeitwort „wesen“, das heisst „sein“; heute sagt man wohl für „das Sein“ noch „das Wesen“, aber statt „er was“ sagen wir „er war“ — “ Die Kinder nickten und von mehreren Seiten liess sich ein leises „Aha!“ vernehmen. Auch der Name Ansorge machte keine Schwierigkeiten. „Ane“ hiess im alten Deutsch soviel als „ohne“ — also war der Herr Ansorge ein sorgloser Mensch gewesen, ein lustiger Bruder. Über den Namen „Anweiler“ waren die Ansichten geteilt: Die einen meinten, den Namen hätte einer bekommen, weil er an einem Weiler, d. i. an einem Landgut oder einer kleinen Ortschaft gewohnt hätte, andere aber erklärten den Namen ähnlich wie An-Sorge: Anweile mochte Anes-Weile, d. h. ohne freie Zeit, ohne Musse, bedeutet haben; und Anweiler mochte einer genannt worden sein, der sich immer Arbeit wusste und darum nie müssig war.
Als die Beiträge spärlicher wurden, rückte der Sohn des Buschenwirtes mit zwei Namen heraus, die er sich von Gästen gemerkt hatte: „Zahradnik“ und „Kominik“. Damit erreichte er, dass die Klasse zu kichern begann. Der Oberlehrer aber fragte ruhig: „Wisst ihr auch, warum ihr lacht? — Weil euch die nichtdeutschen Wörter sinnlos vorkommen. Aber wir können sicher sein, dass auch Namen, die wir nicht verstehen, ihre Bedeutung haben.“ Und schon meldete sich die kleine Ludmilla, das Töchterlein des Schneidermeisters Zaplatil: „Kominik“ heisst Kaminfeger, Rauchfangkehrer. Und „Zahradnik“ bedeutet „Gärtner“, „Zahrada“ ist der „Garten“. Der Oberlehrer schrieb die Namen nebeneinander an die Tafel. Er unterstrich Komin und Kamin.
Unter Za-hrad-nik schrieb er:
Hrad=Grad=Burg,
Graz=Gradec=Hradec=Burgstadt,
Grätzel=Bürglein,
König-Grätz=Königsburg,
Bel-grad=Weissen-burg,
Garde1 =Wache,
Garde1 -robe-Kasten=Kleiderschrank,
Zahrada=Gart-en, lateinisch hort-us
Hort
Hirt
Hürde.
hűten=hiarten (Dialekt)
Hut
Hütte
Er wartete, bis die Kinder mit dem Nachschreiben fertig waren; dann fragte er: „Was sagt ihr dazu?“ — Der Feitsinger Franzel meldete sich: „Komin und Kamin ist ja dasselbe Wort!“ — Dann aber blieb es stille, bis der Oberlehrer dreinhalf: „Versucht zunächst, die angeschriebenen Wörter in Sätzen anzuwenden. Vielleicht glückt es euch, die meisten mit einem gemeinsamen Zeitwort in Verbindung zu bringen.“ Jetzt kam Leben in die Klasse:
„Die Garde-Soldaten bewachen die Burg.“ — „Im Garderobe-Kasten werden die Kleider aufbewahrt.“ — „Wenn der Feind Graz belagert, flüchten die Einwohner in die Burg; sie soll sie vor dem Feinde bewahren.“ — „Der Zaun des Gartens bewahrt das Gemüse vor Hasen und Dieben.“. — „Auf dem Ringplatz von Eggenburg ist eine freistehende Häusergruppe, wie eine kleine Burg; die heisst ,Grätzel“ — ,Im Hort werden die Kinder vor schlechter Gesellschaft bewahrt,“ — „Der Hirt bewacht die Herde; er bewahrt sie in der Hürde, damit sie nicht auseinanderlaufen.“ Der Hut bewahrt den Kopf vor dem Regen. Die Hütte bewahrt die Leute vor Kälte. —
Und wieder schwiegen die Kinder. Da gab ihnen der Oberlehrer einen Wink: — „Ihr müsst doch etwas herausspüren, das in jedem der ähnlichen Wörter steckt. Wenn auch das H durch G ersetzt wird, oder das d sich verwandelt in t oder tz oder c, wenn auch zwei Laute den Platz wechseln und die Selbstlaute sich wunderlich ändern, es ist doch immer etwas Gemeinsames im Wort; das muss doch überall denselben Sinn tragen; ob das Wort nun gart heisst oder gard, grad, gratz, hrad, hort, hirt oder hürd.“ Von drei Seiten auf einmal kam die Antwort: ,,bewahren, behüten“. Da fiel des Oberlehrers Blick auf die zarte Martha Opferkuh, die still vor sich hinweinte. Seine guten Augen fragten das Kind: ,,Martha, warum weinst du?“ Die Kleine brachte unter stossweisem Schluchzen die Frage her vor: „Warum muss ich Opferkuh heissen?“ — „Wein’ doch nicht! bei uns heissest du ja nur Martha. Den dummen Namen hat offenbar der Feldwebel erfunden, der bei der Volkszählung vor mehr als hundert Jahren deinen Ur-Urgrossvater in die Liste der Steuerpflichtigen einschrieb. Weil die Juden zuviel gleiche Namen hatten, mussten ihnen zur Unterscheidung besondere Namen gegeben werden. Wer dem Listenschreiber viel Geld gab, der durfte sich einen Namen aussuchen, wie er ihm gefiel. Zum Beispiel: Mandelblüh, Rosenduft, Stern, Gold oder Diamant. Wer nicht genug oder nichts zahlte, musste den Namen annehmen, den man ihm mit mehr oder weniger Witz gab. Dass dein Ur-Urgrossvater kein reicher Mann war, und dass auch dein Vater nicht reich ist, darauf solltest du stolz sein.“ Über das Gesicht der kleinen Martha glitt ein verständnisvolles Lächeln. Sie setzte sich und trocknete sich die Augen. Der Oberlehrer sprach nun zur Klasse: „Was wir jetzt durchgesprochen haben, aus dem habt ihr bis heut acht Tag’ eine Aufgabe: Ein jeder sucht einige Namen, die bis heut bei uns nicht besprochen worden sind, und erklärt sie, so gut er kann. Ob er sie von Schildern herabliest oder von Grabsteinen, ob er sie von Erwachsenen erfragt, ist alles eins: Wer ein besserer Forscher ist, der wird mehr zustand bringen und besser deuten.“
Bald nahm auch der Oberlehrer von den Kindern die Gewohnheit an, die drei Pflegebrüder mit den Namen aufzurufen, die ihnen das kleine Volk beigelegt hatte. Heger-Bertel, Steiger-Franzel, Stricker-Sepperl.
Franzel wusste sich’s in einigen Tagen beim Hansi durchzusetzen, dass er ihm beim Orgelspielen helfen durfte als zweiterBlasbalgtreter; als erster behauptete Poldi seinen Platz, der flachsköpfige sommersprossige Bub des Mesners.
War ein Requiem auf halb 7 Uhr früh angesetzt, so marschierte Franzel schon um halb 6 allein aus, denn er durfte zum Blasbalgtreten nicht zu spät kommen. Hansi musste sich aufseine Pünktlichkeit verlassen können. Daneben suchte der Steiger-Franzel Gelegenheit, sich mit dem Kirchturm näher bekannt zu machen, in dem er emporsteigen wollte bis unter die Blechhaube, die kleine Guckfenster hatte und das Turmkreuz trug. Von dort musste es einen weiten Ausblick geben. Und der Mesnerbub hatte nichts dagegen, dass Bertel ihm beim Ziehen der Glockenstränge half, wenn er nach der Vormittagsschule Mittag läutete oder an Sonntagen das Läuten vor dem Gottesdienst besorgte.
Читать дальше