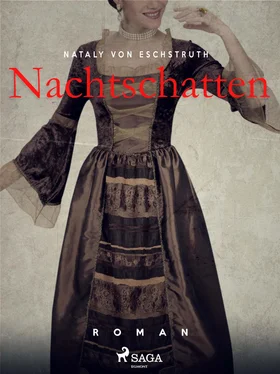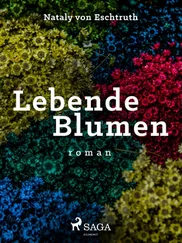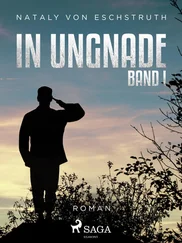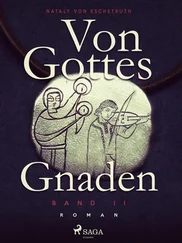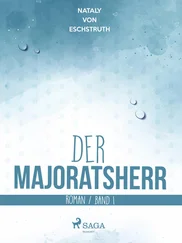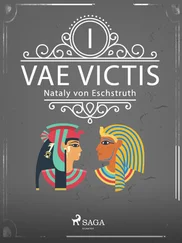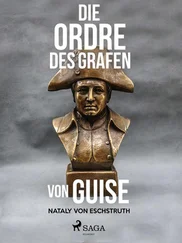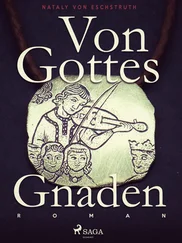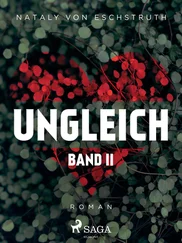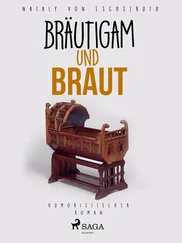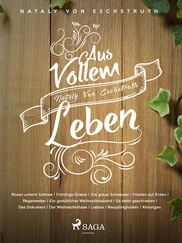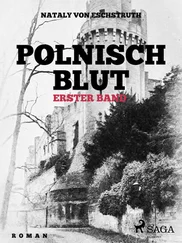„Erlöst! — O Herrgott des Himmels, habe Dank!“ stammelte sie, — küsste den roten Streif, den der Ring auf ihre Haut gezeichnet, und lächelte wie verklärt. „Ich habe ihn geduldig getragen, wie ein Joch, das mir dein Wille, o Herr, auferlegt! Nun hast du es voll Barmherzigkeit selber von mir genommen, und das dank’ ich dir in Ewigkeit!“ —
Frei! — Ja sie war frei! —
So entflieht ein Vögelchen dem Käfig, hinter dessen Gittern es in qualvoller Gefangenschaft geschmachtet. Frei! Los und ledig von all dem Elend, das sie hier umgeben.
Nun will sie einem neuen Leben entgegengehen.
Freundliche Sterne zeigen ihr den Weg, und der ganze Frühling voll Duft und Klang zieht mit ihr und gibt das Geleit!
Ach, wie so ganz verändert lächelt Margret jetzt in seinen wonnigen Zauber hinaus! Ihr Blick schweift über die träumenden Wipfel und haftet auf dem fernen, dunklen Dach, unter dem ein bleiches, zu Tode erschöpftes Antlitz in den Kissen ruht. —
Wie heisst er, dem sie Hilfe gebracht, um dessentwillen sie selber bei Nacht und Nebel entfliehen muss, einem unbekannten Schicksal entgegen?
Ihn hielt sie barmherzig im Arm, derweil ein Blitzstrahl vernichtend ihr eigen Nest getroffen. Ach, dass sie seinen Namen wüsste! —
Aber wozu? — Die Wege, die sie künftighin wandelt, werden fernab von der Welt und ihrem Glücke liegen.
Und sie wird sich nicht danach sehnen. Unter dem Schleiertuch der Diakonissin ist kein Platz für die Myrte, wohl aber für die Erinnerung, die ihre bleichen Immortellen um das Bild eines fremden Mannes flicht.
Eines fremden Mannes! Wie kommt es, dass ihre Gedanken wieder und immer wieder zu ihm zurückkehren? — Dass sie sein Antlitz noch immer schaut, ob sie auch die Augen schliesse?
Sie wird ihn nie wiedersehen im Leben, das weiss sie, — aber sie weiss auch ein anderes: dass sie ihn nicht vergessen wird. —
Vier Schläge von der Kirchturmuhr. —
Margret richtet sich entschlossen auf und greift nach Mantel und Hut, steckt das Ledertäschchen, das das Geld für ihre Ausstattung birgt, zu sich und fasst den kleinen Reisekorb.
Er ist so leicht. —
Noch einen Abschiedsblick über den stillen Raum. Dann öffnet sie die Tür und schreitet lautlos die Treppe hinab.
Um ein halb fünf Uhr geht der Schnellzug, der sie in wenig Stunden zu dem ersehnten Ziele bringt.
Der Bahnhof ist nicht weit, dennoch reichen ihre Kräfte nicht aus, den Korb zu tragen.
Voll sorgender Angst steht sie auf der stillen Strasse und blickt um sich, ob keine Menschenseele zu ihrer Hilfe naht.
Da rumpelt es heran. Der Milchwagen aus der Vorstadtmolkerei. Margret kennt den alten Mann, der ihn lenkt. Sie ruft ihn an — sie bittet! Und nach wenig Augenblicken ist der Korb aufgeladen, sie selber sitzt neben dem freundlichen Helfer und fährt dem Bahnhof entgegen.
Die ersten roten Strahlen flammen am östlichen Himmel auf.
Die Nacht versinkt, — voll sieghafter Pracht steigt die Sonne empor.
Margret wendet ihr voll lächelnder, hoffnungsfroher Zuversicht den Blick entgegen, — ihr Begleiter aber schüttelt nachdenklich den Kopf und sagt: „Es steht noch eine Nebelwand davor! — Wollen sehen, ob die Sonne sie niederzwingt!“ —
Im nördlichen Deutschland, nahe der Küste des wogenden Bernsteinmeeres, liegt Schloss Triberg.
Mächtige, uralte Waldungen umgeben es, kleine Seen spiegeln das Bild dunkler, melancholischer Tannen, und auf den trutzig stumpfen Türmen thront die Einsamkeit und starrt mit schläferigem Blick über das weite, flache Land, das den weitgedehnten Besitz der Majoratsherren Doos von Thüngen ausmacht.
Ehemals sassen die Freiherren wie kleine Könige inmitten ihres ungeheuren Besitzes, abgeschnitten von dem Verkehr mit der Aussenwelt, denn die Eisenbahn durchquerte das Land noch nicht, und die Nachbargüter lagen so weit ab, dass man sie bei den schlechten, oft grundlosen Wegen nur selten, und dann nur mit Schwierigkeiten, erreichen konnte.
Als vor etlichen Jahren aber eine Zweigbahn angelegt wurde, erreichte es der alte Erbherr von Triberg, dass sein Schloss eine Haltestelle im Wald bekam, und nun konnte man mit der angenehmen Möglichkeit rechnen, binnen einer Stunde zu der nächsten Provinzialstadt zu gelangen, die freilich für den Verkehr auch so gut wie nichts bot, da ihre Mauern nicht einmal Militär beherbergten. Immerhin war es in wirtschaftlicher Beziehung von grossem Vorteil, und wenn man sich auch in dem öden, recht schmutzigen Trinowo nicht sonderlich amüsieren konnte, so bildete die kleine Stadt doch bei besonderen Anlässen den Sammelplatz für die Gutsbesitzer der Umgegend und bot durch ihr Sommertheater oder durch ein Winterkonzert, das durchreisende Künstler veranstalteten, etwas Abwechslung.
Der bejahrte Freiherr Doos von Thüngen, der seit langen Jahren Schloss Triberg bewohnt, hatte nicht viel Wert auf Zerstreuung gelegt.
Er lebte mit seiner sehr kränklichen Frau in kinderloser Ehe, war ein unzugänglicher, mürrischer alter Mann, dem das Leben von Jugend auf die liebsten Wünsche versagt hatte, den es an Liebe und Glück bettelarm gelassen, obwohl es ihm den feudalsten und herrlichsten aller Besitze als schwarze Perle in den Schoss geworfen.
So war Baron Georg ein stiller, verschlossener Mann geworden, der sich von der Welt, die ihn so wenig mehr befriedigte, hinter die gewaltigen Mauern seines Schlosses zurückzog und nur noch Interesse für seine Bücher hatte — „die treuesten und selbstlosesten Gesellschafter“, wie er sagte, „die einzig imstande sind, der Phantasie das verlorene Paradies von Glauben, Liebe und Treue neu zu erschliessen“.
Die Bewirtschaftung des Gutes interessierte ihn nicht.
„Für wen soll ich schaffen und arbeiten?“ grollte er. „Einen Sohn besitze ich nicht, meinen Erben kenne ich nicht, — was kümmert es mich!“
Trotzdem wies er jeden Versuch seiner Cousine, ihm den zukünftigen Besitzer von Triberg zuzuführen, ebenso eigensinnig wie unfreundlich zurück.
„Der Knabe ist mir gleichgültig,“ antwortete er in seiner schroffen Weise der Mutter des jungen Maurus; „warum eine Komödie verwandtschaftlicher Zuneigung aufführen? Ich sehe in Ihrem Sohn lediglich einen Menschen, der voll Ungeduld auf meinen Tod wartet.“ —
Was war gegen solche Feindseligkeit zu machen? Baron Georg war zu erbittert und gönnte der verwitweten Cousine nicht das, was ihm selber so grausam versagt geblieben, — einen Sohn.
Glücklicherweise lag die Verwaltung des grossen Besitzes in sehr treuen und zuverlässigen Händen, so dass durchaus geregelte und günstige Verhältnisse vorgefunden wurden, als Baron Georg ziemlich unerwartet an einer Lungenentzündung starb.
Seine Cousine, die Mutter des nunmehrigen Besitzers von Triberg, war ebenfalls einem langjährigen Leiden erlegen, und Maurus stand als junger Ulanenoffizier in der Residenz und war so mit Leib und Seele Soldat, dass er noch keinerlei Lust verspürte, sich in jungen Jahren schon in der Einsamkeit des alten Schlosses zu begraben.
Er wusste die Güter ja in besten Händen, liess die Verwaltung derselben in nämlicher Weise wie bisher bestehen und traf nur zu dreitägigem Aufenthalt auf Triberg ein, um sich seinen Beamten als neuer Herr und Besitzer zu zeigen und etliche Formalitäten zu erfüllen.
Seine Tante bekam er nicht zu sehen.
Die Kranke war durch den Tod des Gatten aufs tiefste erschüttert und leidender wie je; sie durfte das Bett nicht verlassen und liess dem Neffen nur durch ihre Kammerfrau die Bitte aussprechen, „der junge Herr Baron möge doch die Pietät haben und den letzten Willen des Verstorbenen respektieren“.
Dieser letzte Wille war dem Testament in einem Briefe an Maurus beigefügt.
Der Verstorbene sprach den Wunsch aus, bei den ungeheuren Raumverhältnissen des Schlosses, seiner Gemahlin ihre jetzige Wohnung zeitlebens als Witwensitz zu belassen, da sie zu krank sei, um noch einen Wohnungswechsel ertragen zu können.
Читать дальше