2.4.2 Körperlicher und psychischer Zwang
Diese Qualität des Zwangs kann in drei Gruppen unterteilt werden: Erstens in physischen, also körperlichen bzw. »körpergestützten« Zwang (Höhler 2009, S. 90), zweitens in einen psychischen Zwang, also einen »Zugriff auf die ›Seele‹« (Schwabe 2008, S. 20) und drittens in einen strukturellen bzw. organisatorischen Zwang, zu dem wir den Freiheitsentzug zählen. In anderen Systematiken wird der Freiheitsentzug hingegen gesondert aufgeführt oder auch als »Zwangskontext« bezeichnet (  Kap. 2.5).
Kap. 2.5).
Physischer bzw. körpergestützter Zwang umfasst nicht nur direkte Gewalt, etwa Schläge, Festhalten oder das handgreifliche Wegnehmen einer Sache, sondern »jegliche Form des Einwirkens […], das auf der körperlichen Überlegenheit der PädagogIn beruht« (Höhler 2009, S. 90).
Da damit auch die Macht durch die körperliche Überlegenheit sowie die Androhung des Einsatzes von körperlicher Gewalt gemeint sein kann, ist die Grenze zum psychischen Zwang fließend bzw. nur anhand der konkreten Situation klar zu ziehen. Psychischer Zwang kann über explizite Drohungen oder auch den Entzug von Zuwendung ausgeübt werden und setzt in der Regel eine hohe Macht der zwingenden Person bzw. eine große Abhängigkeit der Zwangsunterworfenen voraus. So könnte – je nach Abhängigkeit – bereits das Stirnrunzeln oder das Hochziehen einer Augenbraue einen solchen engen Zwang bewirken, weil sich der Jugendliche dadurch gezwungen sieht, nun gegen seinen Willen den Abwasch zu erledigen. Anderen mag es dagegen gleichgültig sein, wie häufig der*die Sozialarbeiter*in die Augenbrauen hochzieht, das hängt von dem Macht- und Abhängigkeitsverhältnis sowie den damit verbundenen unausgesprochenen Drohungen zusammen.
Ein Beispiel für Zwang durch angedrohten Zuwendungsentzug ist die Äußerung einer Fachkraft gegenüber einem Kita-Kind, das als letztes noch auf dem Spielplatz ist und dort noch eine Weile bleiben will. Die Erzieherin ruft: »Ich gehe jetzt! Tschüss!«. Das ist ein Beispiel für die Kaschierung von engem Zwang. Jeder Mensch weiß, dass das nicht geschehen wird, und dass das Kind mitkommen muss. So wird vorgetäuscht, den engen in weiten Zwang umzuwandeln: »Du kannst selbst entscheiden, ob du nun mitkommst oder nicht.«
2.4.3 Struktureller Zwang
Auch der Entzug von Privilegien im Rahmen eines Phasenmodells, etwa der Erlaubnis, mit den anderen Jugendlichen sprechen zu dürfen, kann als psychischer Zwang bewertet werden. Er beruht aber auf dem strukturellen Zwang auf der Makro-Ebene, da jede Phase mit bestimmten Handlungsfreiheiten bzw. deren Einschränkung verbunden ist, die durch den organisatorischen und konzeptionellen Rahmen definiert werden. So können Jugendliche, die sich in den Augen des Personals ordentlich verhalten haben, mit dem größeren Zimmer in einem besseren Haus mit mehr Freiheiten oder der Erlaubnis belohnt werden, ihre Eltern anzurufen, wenn sie eine Stufe aufgerückt sind.
Der strukturelle bzw. organisatorische Zwang auf der Makroebene ist deshalb von besonderer Bedeutung, da er auch Personal selbst betrifft. Zunächst beschreibt struktureller Zwang, wie das Beispiel des Strafvollzugs (  Beispiel 1) verdeutlicht, einen Zwang, der nicht in direkter Interaktion ausgeübt wird, aber zu bestimmten Interaktionen führt. Der Entzug der Freiheit ist dafür das deutlichste Beispiel. Aber auch sehr rigide Regeln können dieser Zwangsform zugerechnet werden, etwa die so genannten Stufenmodelle in der Heimerziehung, in denen die Handlungsmöglichkeiten der Adressat*innen durch ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Phase bestimmt werden. Dieser strukturelle Zwang hat für die Jugendlichen dann Folgen für den Kontakt zu Außenstehenden, für die Teilnahme an wünschenswerten Aktivitäten oder für den Zugang zu einem Telefon und anderem mehr (Kunstreich/Lutz 2015). In solchen Settings eines dominierenden strukturellen Zwangs gehen die Handlungsbeschränkungen der Adressat*innen immer auch mit Handlungsbeschränkungen der Fachkräfte einher. Wenn die Adressat*innen wenig dürfen und stark beschränkt werden, dann darf auch das Personal nur ganz bestimmte Reaktionen in einem engen Handlungskorridor zeigen. Diesen engen Handlungskorridor muss es dann ausfüllen. Darauf kommen wir in folgendem Exkurs zu sprechen.
Beispiel 1) verdeutlicht, einen Zwang, der nicht in direkter Interaktion ausgeübt wird, aber zu bestimmten Interaktionen führt. Der Entzug der Freiheit ist dafür das deutlichste Beispiel. Aber auch sehr rigide Regeln können dieser Zwangsform zugerechnet werden, etwa die so genannten Stufenmodelle in der Heimerziehung, in denen die Handlungsmöglichkeiten der Adressat*innen durch ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Phase bestimmt werden. Dieser strukturelle Zwang hat für die Jugendlichen dann Folgen für den Kontakt zu Außenstehenden, für die Teilnahme an wünschenswerten Aktivitäten oder für den Zugang zu einem Telefon und anderem mehr (Kunstreich/Lutz 2015). In solchen Settings eines dominierenden strukturellen Zwangs gehen die Handlungsbeschränkungen der Adressat*innen immer auch mit Handlungsbeschränkungen der Fachkräfte einher. Wenn die Adressat*innen wenig dürfen und stark beschränkt werden, dann darf auch das Personal nur ganz bestimmte Reaktionen in einem engen Handlungskorridor zeigen. Diesen engen Handlungskorridor muss es dann ausfüllen. Darauf kommen wir in folgendem Exkurs zu sprechen.
Exkurs 1: Struktureller Zwang als Zwang für die Fachkräfte
Die Fachkräfte sind in allen Organisationen angehalten, sich im Einklang mit den Regeln der Organisation zu verhalten. In freiheitsentziehenden Maßnahmen etwa müssen sie dafür sorgen, dass die Jugendlichen das Zimmer oder das Gebäude oder das Gelände nicht verlassen können. Handelt es sich dagegen um eine offene Einrichtung, müssen sie sich darum nicht groß kümmern und vielleicht erst tätig werden, wenn Jugendliche um 22:00 Uhr immer noch nicht in der Wohngruppe angekommen sind.
Der Umstand, dass die Fachkräfte im Einklang mit den aus den strukturellen Rahmenbedingungen hervorgegangenen Regeln handeln, bedeutet aber nicht, dass sie diese Regeln wie Maschinen automatisch exekutieren. Das würde auch nicht funktionieren.
Strukturellen Zwängen unterworfen zu sein, bedeutet für sie nicht, innerhalb dieses Rahmens keine eigenen Entscheidungen treffen zu können oder nur Anweisungen auszuführen. Zwar gibt es Routinen, und die Aufgabe von Routinen besteht darin, »Unregelmäßigkeit in Regelmäßigkeit« zu übersetzen (Luhmann 1971, S. 119). Doch damit werden Einrichtungen nicht zu bürokratischen Maschinenorganisationen, in denen die Professionellen präzise, stetig, diszipliniert, straff und verlässlich, also berechenbar arbeiten (Weber 1972, S. 123). Im Gegenteil, obgleich in allen Einrichtungen für das pädagogische Personal Handreichungen, Vorschriften und vor allem die Vorbildpraxis der ›Altgedienten‹ zeigen, wie mit den Adressat*innen umzugehen ist, müssen sie selbst Entscheidungen treffen. »Das System wird durch seinen Zweck, der zugleich die Abnahmefähigkeit seiner Entscheidungen definiert, im Großen und Ganzen am Seil geführt, aber doch nicht auf genau vorgezeichneter Spur. Es bleibt, um seiner spezifischen Eigenleistung und Verantwortung willen, relativ autonom« (Luhmann 1971, S. 119). Mit anderen Worten, der enge Zwang einer Organisation ist für die Fachleute in der Regel ein weiter Zwang, da sie über Handlungsoptionen verfügen. Aber handeln müssen sie.
Diese spezifischen Eigenleistungen und die Verantwortung am Ende des Seils der Zwangsausübung übernehmen die Professionellen, da »Organisationen Rollenerwartungen niemals bis ins kleinste Detail vorgeben können« (Kühl 2014, S. 226). Daher ist »für den Träger einer Rolle die Darstellung als Person letztlich unvermeidlich« (ebd.). Diese Notwendigkeit, auch in stark an Regeln orientierten Einrichtungen als Person in Erscheinung zu treten, erleichtert es den Sozialarbeiter*innen, sich auch unter sehr rigiden Bedingungen, etwa einer freiheitsentziehenden Maßnahme, als eigenständig Handelnde zu verstehen und als solche verstanden zu werden.
Dieses Handeln geschieht, gerade wenn enger struktureller Zwang dominiert, in einer »Indifferenzzone«, »innerhalb der sie zu den Befehlen, Aufforderungen Anweisungen und Vorgaben von Vorgesetzten nicht Nein sagen können, ohne die Mitgliedschaft in ihrer Organisation grundsätzlich infrage zu stellen« (ebd.). Das kann als eine Art »Generalgehorsam« bezeichnet werden, als Handlungskorridor, der nicht verlassen werden darf, innerhalb dessen jedoch eigenständige Entscheidungen getroffen werden können, ja müssen. Als feste Organisationsmitglieder entwickeln die Fachkräfte ihre Mitwirkungsbereitschaft innerhalb der Normalität der Organisation. Diese Normalität müssen sie, und das ist für sie die Voraussetzung, um ihrer Rolle überhaupt eine persönliche Note geben zu können, als vereinbar mit ihren professionellen Grundsätzen betrachten, als sinnvoll, angemessen und dem Wohl ihrer Adressat*innen entsprechend. Die Bereitschaft zur Mitwirkung entsteht dann im Zuge ihrer Organisationsmitgliedschaft: »Das (zugeschriebene) Handeln der Personen [ist] nur in dem organisatorischen Kontext, also mit Bezug auf die Systemreferenz Organisation, zu verstehen« (ebd., S. 37).
Читать дальше
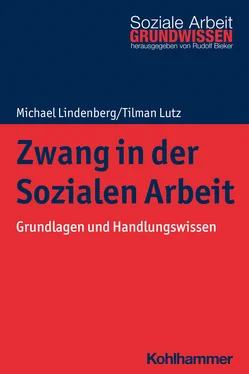
 Kap. 2.5).
Kap. 2.5).










