Zu allen diesen Handlungen werden sie durch Befehle gezwungen. Ihre Wahlmöglichkeiten sind dabei durchgehend auf null reduziert. Sie unterliegen bei all diesen Schritten einem engen Zwang. Dieser ist strukturell bedingt, äußert sich jedoch in konkreten Interaktionen, wie das bei fast allen Zwangssituationen der Fall ist, denn Strukturen müssen nun einmal von Menschen umgesetzt werden. Ohne Interaktionen haben Strukturen keinen Bestand und verdämmern. So ist der Entzug der Freiheit selbst das entscheidende Strukturmerkmal der Organisation Strafvollzug – ihr gesellschaftlich erwünschter Zweck. Dieser ist materiell durch Mauern und geschlossene Türen vermittelt und nicht – wie bspw. die Durchsuchung – an eine einzelne Interaktion gebunden. Doch folgt diese Durchsuchungshandlung aus dieser Struktur, sie ist insofern folgerichtig. So wäre es bspw. organisationsfremd und nicht folgerichtig, wenn Lehrende Studierende vor der mündlichen Prüfung körperlich durchsuchten. Deshalb kann der Entzug der Freiheit als ein enger Zwang gefasst werden, da die Inhaftierten gegen ihren Willen dazu gezwungen sind, etwas Bestimmtes zu unterlassen: nämlich sich frei in der Gesellschaft zu bewegen. Dieser enge Zwang dominiert den Strafvollzug absolut, weil er alle Lebensäußerungen der Inhaftierten bestimmt – daher der bekannte Begriff »Totale Institution« (Goffman 1973). Auf diese Unterscheidung kommen wir bei den unterschiedlichen Formen des Zwangs (  Kap. 2.4) zurück.
Kap. 2.4) zurück.
Beispiel 2: Die Kindertagesstätte
Die Wahl einer Kita können Eltern, abhängig von Angebot und Nachfrage, selbstständig bestimmen. Auch das Eintrittsdatum ist nicht zwingend vorgeschrieben. Zwar gibt es bestimmte Zeiten, zu denen in der Regel die Aufnahme erfolgt, etwa der Schuljahresbeginn, wenn bisherige Kita-Kinder eingeschult werden und die Kita verlassen. Es ist aber auch möglich, Kinder zu einem anderen Zeitpunkt anzumelden. Aber die Anmeldung reicht noch nicht. In Kitas findet regelhaft ein Aufnahmegespräch statt, dem sich weder Eltern noch Personal entziehen können und dem sie sich meist auch nicht entziehen wollen. Beide Seiten finden das sinnvoll und sehen darin eine Voraussetzung zur Erfüllung des Organisationszwecks, denn hier versuchen sie sich gegenseitig kennenzulernen. Dabei gehen beide Seiten zunächst von Wahlmöglichkeiten aus. Es handelt sich also um eine Form des weiten Zwanges. Eltern stehen meist unter einer in der Gesellschaft erzeugten Notwendigkeit, das Kind einer Kita zu überantworten, weil ein oder beide Elternteile arbeiten oder sie das Kind aus anderen Gründen nicht durchgehend betreuen können. Dies ist ebenfalls weiter Zwang, denn es wäre auch möglich, dass nur ein Elternteil arbeitet und das andere zu Hause bleibt und sich dort um das Kind kümmert. Dann müsste allerdings auf Einkommen verzichtet werden. Außerdem wird heutzutage davon ausgegangen, dass beide Elternteile berufstätig sein sollten, so dass ein nicht arbeitendes Elternteil nicht nur materiell, sondern auch sozial unter Druck geraten würde. Er oder sie müssten sich dafür rechtfertigen, keiner Erwerbsarbeit nachzugehen. Die Möglichkeit aber besteht durchaus.
Die Aufnahme in die Kita erfolgt dann zugewandt und freundlich unter Beteiligung der Eltern, die das Kind in der Eingewöhnungsphase begleiten. Nach und nach werden die Eltern weniger erscheinen, schließlich wird das Kind sich an die Situation gewöhnt haben und mehr oder weniger zufrieden in der Kita bleiben. Für das Kind allerdings handelt es sich analytisch zumindest dann um engen Zwang, wenn es selbst einmal nicht in die Kita möchte, wie es jedes Kita-Kind schon einmal erlebt hat. Es hat selbst jedoch keine eigenständige Möglichkeit, diese Situation zu vermeiden. Insofern kann gesagt werden, dass zwischen einem Strafgefangenen und einem Kindergartenkind unter diesen Gesichtspunkt kein Unterschied besteht. Beide unterliegen hinsichtlich ihrer Mitgliedschaft im Strafvollzug bzw. in der Kita einem engen Zwang. Allerdings wissen wir auch von manchen Strafgefangenen, dass sie Angst vor der Entlassung haben und lieber im Strafvollzug bleiben möchten. Das ändert aber nichts daran, dass es sich bei der Inhaftierung um einen engen Zwang handelt.
Beispiel 3: Die Wohngruppe in der Jugendhilfe
Auch in der Organisation der Wohngruppe muss es ein geregeltes Verfahren geben, künftige Bewohner*innen aufzunehmen. Die Aufnahme wird unter »fachlichen Gesichtspunkten« entschieden. Diese fachlichen Gesichtspunkte sind eine Summe aus Einschätzungen und Haltungen von beteiligten Fachkräften, etwa des Allgemeinen Sozialen Dienstes und angrenzender Dienste, ambulanter Hilfen, aber vor allem der Personensorgeberechtigten und des*der Aufzunehmenden selbst. Dafür gibt es rechtliche Grundlagen im SGB VIII. Aber diese gesetzliche Grundlage wird in der Praxis jeweils unterschiedlich ausgefüllt. Es geht eher darum, was die Beteiligten für legitim, also vertretbar, vernünftig, berechtigt und moralisch einwandfrei halten. Unterschiedliche Personen werden in diesem Prozess sehr häufig zu unterschiedlichen fachlichen Einschätzungen kommen. Diese fachlich gelenkte Aufnahme hat zur Folge, dass die Vorbereitungen sehr lange dauern: Es wird ein Hilfeplangespräch geben, Vorgespräche mit den Personensorgeberechtigten, den Jugendlichen oder auch anderen sozialen Diensten. Es werden Schriftstücke ausgetauscht und Telefonate geführt. Am Ende dieses Verfahrens und auch nach Abklärung mit der Wohngruppe, die den Jugendlichen unterstützen soll, wird dann die Aufnahme erfolgen. Für die Jugendlichen kann dieses Verfahren die Ausprägung eines weiten oder auch eines engen Zwanges annehmen. Um einen weiten Zwang handelt es sich für sie dann, wenn sie selbst gefragt werden und auch noch andere Optionen angeboten bekommen, etwa eine alternative Wohngruppe, die Weiterführung einer ambulanten Hilfe oder einen Schulwechsel. Ein enger Zwang liegt dann vor, wenn das rechtlich verbriefte Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) missachtet und der Einzug in eine bestimmte Wohngruppe festgelegt wird oder wenn die Aufnahme in diese Wohngruppe damit verbunden ist, Haft zu vermeiden, oder wenn sie als eine Reaktion der Jugendhilfe auf Straftaten erfolgt und vom Gericht angeordnet ist. Wenn die Eltern diese Hilfe nicht wollen und sie ablehnen, kann der Entzug des Sorgerechts drohen. Dann kann von engem Zwang gesprochen werden. Enger und weiter Zwang vermischen sich sehr häufig, was sich auch darin verdeutlicht, dass die Aufnahmewege sehr viel komplizierter und auch unsichtbarer bzw. uneindeutiger ablaufen als etwa ein Haftantritt (die Ladung zum Strafantritt gibt genau an, bis wann die Aufnahme zu erfolgen hat, sonst droht ein Haftbefehl) oder die Aufnahme in eine Kita (Kita, Eltern und Kinder haben sich in der Regel darauf geeinigt). Durch die Beteiligung der Betroffenen bei der Aufnahme in eine Wohngruppe entsteht dagegen der Eindruck, der Einzug sei Gegenstand partnerschaftlicher Aushandlung. Das kann auch so sein, doch hier kann auch immer enger Zwang drohen.
Auch im Alltag der Wohngruppe selbst kann es engen und weiten Zwang geben. So kann es üblich und Bestandteil der Regeln sein, dass die Fachkräfte mit den Jugendlichen jeden Abend kochen. Das wäre weiter Zwang, denn es kann durchaus sein, dass ein*e Jugendliche*r entschuldigt oder unentschuldigt fehlt, aber verhalten wird er*sie sich zu dieser Anforderung jedenfalls müssen. Zudem werden die Beschäftigten darauf achten, dass die Essenspläne eingehalten werden, die Jugendlichen sich an den Vorbereitungen beteiligen und anschließend gemeinsam abgewaschen wird. Und darauf achten heißt: Sie werden bei Nichterfüllung dieser Erwartung durch die Jugendlichen weiten oder engen Zwang ausüben, sei es, indem sie Jugendliche auf ihrem Zimmer aufsuchen und dort bleiben, bis sie*er sich beteiligt, oder sie*ihn (auch körperlich) daran hindern, den Raum zu verlassen, wenn sie*er anschließend den Abwasch verweigert. In manchen Einrichtungen können sie den jungen Menschen in einen Auszeitraum verbringen und ihm über einen bestimmten Zeitraum die Freiheit entziehen. Das wären jeweils Zwangsmittel, also enger Zwang. Sie könnten aber auch ihr Missfallen lediglich verbal ausdrücken, in einen Aushandlungsprozess eintreten oder nur die Stirn runzeln und nichts weiter tun. Dann würden sie auf engen Zwang verzichten und das Fernbleiben zwar als Fehlverhalten markieren, es zunächst aber hinnehmen, um es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt aufzugreifen, zu verzeihen oder zu vergessen. Das sind verschiedene Reaktionen mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen, in denen bereits unterschiedliche Formen von Zwang bzw. Zwangsmitteln deutlich werden – körperlicher Zwang, psychischer Zwang und Zwang durch Freiheitsentzug (  Kap. 2.4.2).
Kap. 2.4.2).
Читать дальше
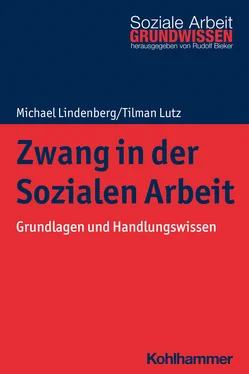
 Kap. 2.4) zurück.
Kap. 2.4) zurück.










