Aus Sicht der jungen Menschen mag die Regel, am gemeinsamen Essen teilzunehmen, an den meisten Tagen gar nicht als Zwang erscheinen. Die gemeinsame Mahlzeit kann auch als Selbstverständlichkeit, als Ausdruck der Fürsorge, als Ort der Gemeinschaft und des Austauschs oder auch als lästiges Übel erscheinen, das in Kauf genommen werden muss. Aus unserer Sicht ist das dann ein weiter Zwang, der als solcher gar nicht von allen wahrgenommen werden muss. Erst wenn sie nicht daran teilnehmen wollen – etwa weil sie eine Verabredung haben oder weil sie im Streit mit anderen Jugendlichen liegen – wird diese Regel für die jungen Menschen als enger und damit bemerkbarer Zwang relevant, denn dann geschieht es gegen ihren Willen. Ob es dazu kommt, ist von drei Voraussetzungen abhängig): auf der Mikro-Ebene, ob die Sozialarbeiter*innen sich dazu entscheiden, die Regel mit engen Zwangsmitteln durchsetzen zu wollen, auf der Meso-Ebene, ob sie dabei die Unterstützung ihrer Kolleg*innen haben und gegen die Jugendlichen engen Zwang anwenden, und schließlich auf der Makro-Ebene, ob Zwangsmittel konzeptionell und strukturell verankert sind, etwa in Form eines abschließbaren Raumes (  Abb. 1).
Abb. 1).
Vielleicht ist mit diesen Beispielen die grundlegende Unterscheidung zwischen weitem und engem Zwang etwas deutlicher geworden: Weiter Zwang ist die Einwirkung von außen auf ein Individuum. Durch ihn wird sein Handlungsspielraum in unterschiedlichem Ausmaß beschnitten bzw. eingeschränkt. Weiter Zwang kann auch selbst gewählt bzw. aufgrund des eigenen Willens wissentlich in Kauf genommen werden – etwa, dass Studierende Referate halten müssen oder dass Eltern ihr Kind zur Kita bringen müssen, womöglich noch in einem begrenzten Zeitfenster.
Der enge Zwang bedeutet dagegen, den eigenen Willen gegen den Willen einer Person durchzusetzen, die Wahlmöglichkeiten des Gezwungenen auf null zu reduzieren und dabei gegebenenfalls Zwangsmittel anzuwenden.
Wichtig für die weitere Argumentation ist, dass weiter Zwang allgegenwärtig ist. Auf ihn stellen wir uns ein und häufig bemerken wir ihn so wenig wie die Luft zum Atmen. Und so wenig wir auf Atemluft verzichten können, so wenig kann in einer Gesellschaft insgesamt von diesem weiten Zwang abgesehen werden. Darauf haben wir eingangs mit Norbert Elias hingewiesen. Ihm zufolge zeigt sich dieser Zwang in den »Interdependenzen«, womit er wechselseitige Abhängigkeiten und das Angewiesensein aufeinander bezeichnet. Diesen unterliegen wir, und zugleich verbinden sie uns miteinander. Zum anderen haben wir Pierre Bourdieu (1985, S. 10) herangezogen, der sich auf den Sozialen Raum als Ensemble unhintergehbarer Kräfteverhältnisse bezieht. Die damit erzeugten Zwänge lassen sich jedoch weder auf die Absichten oder Haltungen der beteiligten Akteure noch auf deren direkte Interaktionen zurückführen.
Auch Soziale Arbeit vermittelt Interdependenzen und wirkt auf den Sozialen Raum ein, übt also Zwang im weiten Sinne aus, indem sie Entscheidungsfreiheiten und Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Gleichzeitig ist sie selbst nicht völlig frei in ihren Entscheidungen, steht also selbst unter Zwang, wodurch sie wiederum Zwang erzeugt, etwa wenn ein Jugendlicher wiederholt nicht am gemeinsamen Essen teilnimmt (  Beispiel 3).
Beispiel 3).
So greift unsere Unterscheidung zwischen einem weiten und einem engen Zwang auf, dass mit Zwang ganz verschiedene Phänomene bezeichnet werden: einerseits die alltagspraktischen und interdependenten Bedingungen menschlichen Lebens insgesamt (weiter Zwang), andererseits ausdrückliches und gewaltförmiges Eingreifen in das menschliche Leben (enger Zwang). Diese Unterscheidung wird von uns im Folgenden sowohl mit Blick auf die verwandten Begriffe (Macht, Erziehung, Strafe, Paternalismus,  Kap. 4) als auch mit Blick auf den Diskurs um die Legitimität von Zwang in der Sozialen Arbeit immer wieder aufgegriffen. Bei der umstrittenen Frage der Legitimität von Zwang geht es uns primär um den engen Zwang, um bewusst eingesetzte Zwangsmittel und -maßnahmen. Hier ist das Feld der Auseinandersetzung, in das wir mit unseren Überlegungen eintreten. Denn wir werden nicht müde zu wiederholen: weiter Zwang ist überall. Weiter Zwang kann aber keine Rechtfertigung oder Begründung für den tatsächlich und bewusst ausgeübten oder unterlassenen engen Zwang sein.
Kap. 4) als auch mit Blick auf den Diskurs um die Legitimität von Zwang in der Sozialen Arbeit immer wieder aufgegriffen. Bei der umstrittenen Frage der Legitimität von Zwang geht es uns primär um den engen Zwang, um bewusst eingesetzte Zwangsmittel und -maßnahmen. Hier ist das Feld der Auseinandersetzung, in das wir mit unseren Überlegungen eintreten. Denn wir werden nicht müde zu wiederholen: weiter Zwang ist überall. Weiter Zwang kann aber keine Rechtfertigung oder Begründung für den tatsächlich und bewusst ausgeübten oder unterlassenen engen Zwang sein.
2.4 Formen von Zwangsanwendung, Zwangsmitteln und Zwangsmaßnahmen
Die Zwangsmaßnahmen und Zwangsmittel in der Sozialen Arbeit lassen sich neben der Unterscheidung von weitem und engem Zwang auch nach ihrer Qualität klassifizieren bzw. nach unterschiedlichen Merkmalen und Formen unterscheiden (Höhler 2009). Diese Differenzierung ist für die Analyse und Reflexion der Praxis ebenfalls relevant, da sie im Fachdiskurs geläufig ist. Wir konzentrieren uns bei der Vorstellung zunächst auf grundlegende Unterscheidungen von Zwangsanwendungen in der Praxis der Sozialen Arbeit. Vor diesem Hintergrund entwickeln wir unsere Systematik und fassen die im Weiteren verwendeten Differenzierungen und Begriffe in einem Schaubild (  Abb. 2) zusammen. Anschließend (
Abb. 2) zusammen. Anschließend (  Kap. 2.5) gehen wir auf Zwangskontexte der Sozialen Arbeit als eine Sonderform ein, da organisatorische Kontexte zwar Zwangsmaßnahmen und Zwangsanwendungen ermöglichen, selbst aber keine Zwangsmaßnahme im engeren Sinn darstellen.
Kap. 2.5) gehen wir auf Zwangskontexte der Sozialen Arbeit als eine Sonderform ein, da organisatorische Kontexte zwar Zwangsmaßnahmen und Zwangsanwendungen ermöglichen, selbst aber keine Zwangsmaßnahme im engeren Sinn darstellen.
2.4.1 Zwangsmomente und Zwangselemente
Eine erste wesentliche Unterscheidung für die Anwendung von Zwang ist die zwischen spontaner Zwangsausübung und geplanter, konzeptionell oder strukturell verankerter Zwangsausübung. In der Terminologie folgen wir Schwabe (2008, S. 24ff), der zwischen Zwangsmomenten und Zwangselementen unterscheidet, wobei wir im Gegensatz zu ihm beide Formen in der institutionellen Praxis der Sozialen Arbeit verorten.
Zwangsmomente finden spontan und ungeplant statt. Damit bezeichnen wir unmittelbare und in der Regel wenig durchdachte, aber subjektiv als notwendig empfundene Reaktion. Ein Beispiel ist das Festhalten eines Kindes durch eine Erzieherin, weil das Kind gerade vor ein Auto laufen will, oder auch der Rauswurf aus der Küche, wenn die Pädagogin in der Wohngruppe (  Beispiel 3) beim gemeinsamen Kochen mit dem Verhalten einer Jugendlichen überfordert ist. Zwangsmomente zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie »zeitlich und inhaltlich« (ebd., S. 27) nur einen Moment in der Erziehungspraxis darstellen. Wenn es passiert, haben die Zwangsunterworfenen damit nicht gerechnet, und die Zwingenden setzen ihre spontane Handlung nicht systematisch und wiederholt ein. Es sind Handlungen im Augenblick.
Beispiel 3) beim gemeinsamen Kochen mit dem Verhalten einer Jugendlichen überfordert ist. Zwangsmomente zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie »zeitlich und inhaltlich« (ebd., S. 27) nur einen Moment in der Erziehungspraxis darstellen. Wenn es passiert, haben die Zwangsunterworfenen damit nicht gerechnet, und die Zwingenden setzen ihre spontane Handlung nicht systematisch und wiederholt ein. Es sind Handlungen im Augenblick.
Allerdings kann das Verweisen aus dem Raum, wenn es konzeptionell verankert und geplant ist, auch ein Zwangselement in dieser Wohngruppe sein. Dann ist es keine spontane Reaktion, sondern »eine vorher geplante und konzeptionell verankerte Maßnahme« (ebd.) und damit ein Zwangselement. Die Handlung geschieht dann nicht spontan, sondern regelhaft, erwartbar und angebbar. Sie ist als Maßnahme begründet und reflektiert, möglicherweise sogar schriftlich in der Konzeption festgehalten. Aber auch nicht konzeptionell verankerte Handlungen, die als inoffizielle Routinen Praxis geworden sind, können den Zwangselementen zugeordnet werden. So kann das gemeinsame Einnehmen der Mahlzeit auch eine von einem Großteil des Personals getragene Regel sein, die im Konzept des Trägers gar nicht auftaucht und vielleicht nur innerhalb dieser bestimmten Wohngruppe bekannt ist und gilt. Ebenso sind ein Time-Out-Raum oder eine komplette Freiheitsentziehung durch den Einschluss in dem eigenen Zimmer in einer geschlossenen Wohngruppe Zwangselemente. Diese Unterscheidung zwischen Moment und Element ist hilfreich, sagt aber noch nichts über die Qualität des Zwangs aus.
Читать дальше
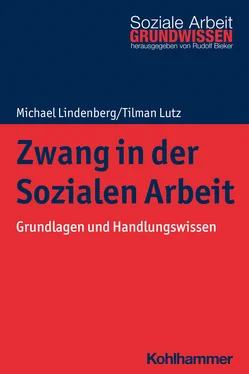
 Abb. 1).
Abb. 1).










