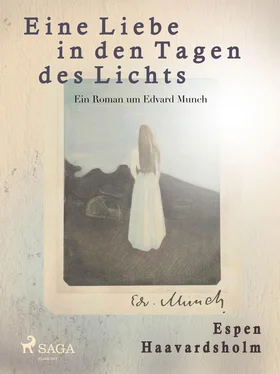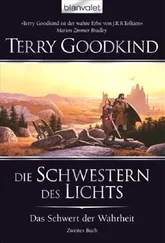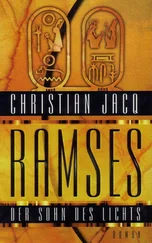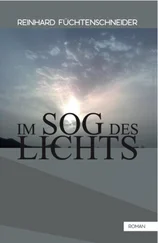Espen Haavardsholm
Eine Liebe in den Tagen des Lichts
Roman um Edvard Munch
Aus dem Norwegischen von
Gabriele Haefs und
Andreas Brunstermann
Saga
Dreiundzwanzigster Januar, Morgendämmerung.
Wie sonderbar, dass noch immer Leben in ihm ist. Ganz oben im Hals hat sich der Katarrh festgesetzt, er hat Fieber- und Hustenanfälle, zu allem Überfluss noch eine Bronchitis.
Wie jeden Winter.
Nur schlimmer! Jahr für Jahr wird es schlimmer!
Mit einer hastigen Bewegung zieht Herr M. die Jalousien hoch. Er kneift die Augen zusammen und blinzelt benommen auf einen schmalen Streifen Gelb und Zinnoberrot, der zwischen den mit Raureif überzogenen Baumkronen zum Vorschein kommt.
Finster und erbärmlich. So sieht es in ihm aus.
Er zieht Pantoffeln an und wirft sich Ulster, Schal und Morgenrock über den Schlafanzug. Während er ein paar alte Zeitungen zusammensucht, um damit Feuer zu machen, fällt sein Blick auf eine Bekanntmachung, die besagt, dass allen norwegischen Juden jetzt ein »J« in den Pass gestempelt wird.
»Pah!«
Er verzieht das Gesicht, reißt die Zeitungsseiten entzwei und knüllt sie zusammen. Dann stopft er das Papier in den rußigen Ofenschlund und legt Späne und Kleinholz dazu. Schließlich hält er ein Streichholz an das Ganze.
»Na, also!«
Schon lange klingt seine Stimme nur wie ein krächzendes Flüstern. Sobald die Flammen aufzüngeln, stellt er das Ofenventil ein und lässt die Luft durch einen schmalen Spalt an der Aschenschublade eindringen. Die Geräusche aus der Küche verraten ihm, dass seine Haushälterin da draußen schon eingeheizt hat, hier drinnen jedoch kümmert er sich um so etwas lieber selbst.
Dies hier ist seine Seite des Hauses. Die Haushälterin soll ihm nicht zu nahe kommen.
Nicht jeder Raum, in dem es Bilder gibt, bedarf des Ofenfeuers – hier unten allerdings, wo seine Utensilien sind, will er es etwas behaglicher haben. Denn die elektrische Heizung allein kann gegen die Eiseskälte nicht genügend ausrichten. Diese Arbeitszimmer sind sein Zuhause, hier hängen all seine Bilder und auch Briefe an den Wänden. Graphische Blätter, Skizzen und unfertige Entwürfe liegen über den Fußboden verstreut – hier laufen alle Fäden zusammen.
Der gebrechliche Hausherr von Ekely erhebt sich mühsam von den Knien und blickt umher, bevor er mit schleppenden Schritten den Nebenraum betritt, um auch dort den Ofen anzuheizen. Es knackt in seinem dünnen Leib.
»Scheiße!«
So lange hatte er in Deutschland gewohnt, dass Deutsch zu seiner zweiten Muttersprache wurde. Wochen und Monate sind vergangen, seit er zuletzt der eigenen Stimme trauen konnte.
Der Krieg verbreitet sich von Ozean zu Ozean, von Kontinent zu Kontinent. Bald gibt es wohl keinen Fleck mehr auf Erden, der unberührt ist. Allenfalls in Landstrichen, die sich den Fängen der Zivilisation bisher entzogen haben, bei den Polynesiern in Tahiti, zum Beispiel; oder den wilden Indianerstämmen irgendwo am Amazonas.
Doch andererseits – wer weiß? Vielleicht wird die Blutspur aus dem Schlachthof des Zweiten Weltkriegs sogar bis zu solch entlegenen Orten führen?
Womöglich endet alles mit diesem Krieg.
Denn zweifelsohne gibt es Umstände, die darauf hinweisen, dass es sich um die alles verschlingende Apokalypse handeln könnte – die Endzeitkatastrophe, die sein alternder Vater den Kindern in dunklen Stunden ausmalte.
Gleichwohl gilt es, die düsteren Gedanken im Zaum zu halten.
Sein Freund, Doktor Schreiner, gemahnt ihn ständig daran. Der Anatom! Der Pathologe! Der Totendoktor! Sein Hausarzt, den der alte Maler vor einer geöffneten Leiche im Obduktionssaal porträtiert hat und zu dem er ein gewisses Vertrauen hegt.
Sobald Herr M. die Öfen versorgt hat, geht er ein Stück an der Wand entlang, mit geschlossenen Augen. Ein kleiner Trick, den er manchmal anwendet – zumindest wenn er ein wenig Aufmunterung braucht. Wie ein Blinder bewegt er sich vorwärts, bevor er schließlich stehen bleibt und die Augen öffnet. Er darf nicht mogeln. Das ist ja gerade der Witz an diesen Morgenspaziergängen. ›Marats Tod‹ ist das Bild, vor dem er heute landet. Er blickt auf und nickt.
»Guten Morgen, Herr Graf«, sagt er.
Allein die Bronchitis in seinem Hals antwortet mit einem Pfeifen.
»Guten Tag, Frau Gräfin«, murmelt er dann, ein wenig verlegen, und sieht sie direkt an.
Verblüffend offenherzig erwidert sie seinen Blick. Doch auch von ihr erhält er keine Antwort. Das hätte er auch nicht erwartet – natürlich nicht.
Ein passendes Bild, um den Tag zu beginnen, wie er gleich merkt. Denn die Schwermut lichtet sich ein wenig, wenn er an die Unterhaltung zurückdenkt, die er – auf stockendem, aber halbwegs brauchbarem Deutsch – vor einer Ewigkeit dort unten in Berlin mit seinen Modellen, dem Ehepaar mit dem adelig klingenden Nachnamen Grävenitz führte.
Ob sie sich vielleicht vorstellen könnten, ihm für ein bestimmtes historisches Motiv Modell zu stehen?
»Aber natürlich!«
Jung waren sie zu jener Zeit – und schienen auch den starken Wunsch zu hegen, sich ein Bild zu kaufen.
Er erklärte seine Idee. Der hochwohlgeborene Herr Grävenitz war gleich bereit, die Rolle des erstochenen Marat zu spielen, zögerte jedoch, als der Maler die Notwendigkeit erklärte, dass sie beide – er und seine Frau – in einer möglichst natürlichen Situation posieren müssten, was bedeuten würde, dass …
Die beiden blickten einander an. Fast unmerklich nickte sie. Er tat dasselbe und fragte dann:
»Wann?«
»Morgen früh um zehn?«
Die Eheleute sahen sich wieder an und nickten.
Im Grunde hatte er damit gerechnet, dass das junge Patrizierpaar Bedenken haben und nicht auftauchen würde. Doch das taten sie, genau wie vereinbart. Verlegen rief er:
»Ich habe das Gefühl, dass es nicht richtig ist, Sie um so etwas zu bitten.«
»Unsinn.«
»Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu arbeiten, aber Sie sind einverstanden, wenn es etwas Zeit in Anspruch nimmt?«
»Natürlich sind wir einverstanden.«
»Gut, dann …«
»Ja?«
»Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber dort drüben steht ein Wandschirm, wenn die Herrschaften tatsächlich …«
Sogleich verschwanden sie hinter dem Wandschirm und machten sich bereit. Etwas Freimütiges und Robustes strahlten sie aus. Er hatte schon altgediente Berufsmodelle gesehen, die in solchen Augenblicken viel befangener waren als diese beiden.
Er – der Skandalmaler aus Kristiania im hohen Norden – hatte die vornehme Frau Grävenitz überreden können, sich völlig schutz- und hüllenlos in der Rolle der Mörderin Charlotte Corday zu zeigen! Stundenlang hatte sie so dastehen müssen, mit ihrem langen, rotblonden Haar und den geröteten Wangen. Ihr distinguierter Mann hatte nicht nur das akzeptiert, sondern war sogar einverstanden, dass er selbst, im Bett liegend, die Rolle des nackten, verratenen und ermordeten französischen Revolutionshelden übernahm! Von all den erstaunlichen Erlebnissen, die er mit Modellen hatte, kommt ihm jenes an diesem eiskalten Januarmorgen auf Ekely besonders denkwürdig vor.
Ein ungewöhnliches Ehepaar. Aber hochwohlgeboren! Und so kunstinteressiert!
Er, der Skandalmaler, war damals jung und stark gewesen. So viele Einfälle waren ihm gekommen. Doch das war vor dem Nervenzusammenbruch gewesen, vor den alkoholfreien Malereien, den nikotinfreien Zigarren und den giftfreien Damen – bevor er es vorgezogen hatte, sich hinter dem hohen Bretterzaun hier in der Villa zu verstecken.
Vor Urzeiten also. Viele seiner stärksten Bilder wurden vor Urzeiten geschaffen. Manchmal denkt er, das Geheimnisvolle seiner Malerexistenz sei in Wahrheit darin zu suchen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unheilverkündenden Geschehnissen in seinem eigenen Leben und den Dingen, die sich da draußen in der Welt ereignen.
Читать дальше