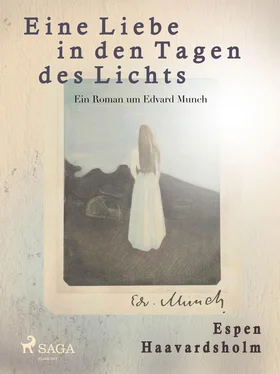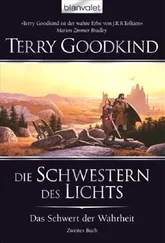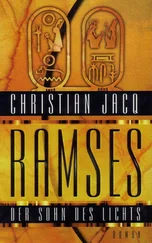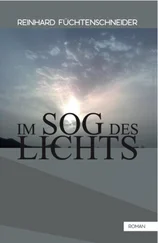Schon als junger Kunststudent zog er sich im Karneval eine Mönchskutte über – und auf dieselbe Weise lebt er nun. Eine Jungfrau ist er nicht, bei weitem nicht, auch wenn er noch ein Novize war, als Frau Thaulow ihn auf ihre Mondscheinspaziergänge lockte, damals im Wald zwischen Borre und Åsgårdstrand. Sie lehrte ihn das Küssen, auf eine Art, bei der man nicht mehr weiß, wer eigentlich wer ist; und danach war das Leben verändert.
Seitdem hat er Lithographien und Graphiken von dieser Umarmung angefertigt – die Küssenden vor den halb zugezogenen Gardinen am Fenster, so, dass ihre Gesichter zu einem verschmelzen. Frau Thaulow und er sind es, in seinem Atelier in Hammersborg, in jenem Herbst. Zwei Mal pro Woche kam sie zu Besuch, versteckt hinter ihrem Schleier.
Kurz vor Weihnachten machte sie Schluss mit ihm.
Offenbar wurde er ihr zu intensiv und fordernd. Und doch brauchte sie immer ein wenig Ablenkung, um eine Ehe mit einem Mann auszuhalten, der sie seinerseits betrog, und legte sich daher einen jungen Offizier zu, mit dem sie spielen konnte. Stundenlang streifte der verschmähte Liebhaber M. im folgenden Halbjahr durch den Studenterlunden, in der Hoffnung, Frau Thaulow zu begegnen – bis er sie schließlich wiedersah, in ihren feinen Kleidern; ihr glattes, ausdrucksloses Gesicht neben dem Gatten in Gehrock und Zylinder. Eine ganze Bildserie, Zeichnungen und Malereien, hat er von dieser Situation gefertigt – die weißen Spukgeister inmitten der anderen Promenadengespenster auf der Karl Johan.
Auch die anderen Frauen, in die er sich in seiner Jugend unvorsichtigerweise verliebte, hatten eine andere Seite gezeigt. Schwierig waren sie gewesen. Unergründlich, voller Widerspruch und treulos.
So viel falsches Spiel!
So viel Verwirrung! So viel Wankelmut!
Ja, auch er selbst war wankelmütig. Ja, auch er selbst verhielt sich unbegreiflich. Ja, auch er selbst war verwirrt, und hat gezweifelt.
Aber dennoch …
Dennoch!
Haben diese Schicksalsfrauen etwa nicht versucht, ihn seiner Vitalität und Manneskraft zu berauben? Muss er etwa nicht mit seiner halbverkrüppelten linken Hand leben, dieser ewigen und beschämenden Erinnerung an die schlimmste von allen – damals, als sie auf höchst ausgeklügelte Weise erneut versuchte, ihn zu einer Boheme-Ehe zu verleiten?
Diese verwöhnte Bürgertochter aus Homansbyen! Diese durchtriebene kleine Füchsin!
Danke, oh Herr, dass du mir genügend Scharfblick gabst, um vor ihr zu türmen, noch vor dem Besuch beim norwegischen Konsul, damals in Nizza!
Er ballt die rechte Hand zur Faust und hämmert sie auf den Nachttisch, mit aller Kraft.
Nein, Einsamkeit ist wohl das Beste für einen Mann seines Schlags. Natürlich kann Ekely als recht geräumige Mönchszelle betrachtet werden, aber eine Mönchszelle ist der Ort dennoch geworden. Insbesondere um all seine Malereien unterzubringen, hat er hier für so viel Platz gesorgt – mit hohen Bretterzäunen zum Schutz vor seinen Feinden, die sich im Prinzip zu jeder Zeit zwecks eines neuen Angriffs auf ihn sammeln könnten.
Ist es eine Art von Irrsinn, dass er so denkt?
Nein, Irrsinn … Man muss ja wirklich nicht geisteskrank sein, um die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist.
Damals in Åsgårdstrand, als er Rüben auf die Zaunpfähle unten am Fjord steckte, diesen Stangen die Namen seiner meist verhassten Feinde gab und mit seiner Kleinkaliberpistole auf die Köpfe feuerte – da war er vielleicht nicht ganz gesund. Aber das war ja ohnehin nicht ganz ernst gemeint. Er tat es nur, um sich von all dem Gift zu befreien, mit dem seine Lebenserfahrungen ihn angefüllt hatten. Ein richtiger Genuss war es, die durchbohrten Köpfe in den Kristianiafjord zu werfen.
Hiob …
M. holt seine Lesebrille hervor und setzt sich auf die aus Familienbesitz stammende Chaiselongue – »das Konversationssofa«, wie es damals genannt wurde. In den Jahren nach dem Tod seiner Mutter, saß sein Vater, falls er nicht gerade bei der Arbeit war, immer auf dieser Chaiselongue, um den Kindern in der Dämmerung etwas vorzulesen – Dickens, wenn er in seiner Armenarztstimmung war, Marryat, wenn den ehemaligen Schiffsarzt das Temperament überkam, und die Bibel, wenn ihm alttestamentarisch zumute war.
Das waren Abende, die er niemals vergessen wird; und tatsächlich hat er diese Angewohnheit hier auf Ekely wieder angenommen – sich niemals schlafen zu legen, ohne zuerst eine Weile gelesen zu haben, gern auf dieser Chaiselongue, auf der sie sich einst alle an ihren grauhaarigen Arztvater schmiegten, die drei Schwestern, der kleine Bruder und er.
Jaja. Die Seiten sind so dünn, und die Schrift so klein, aber es hilft, wenn er den Zwicker aufsetzt. Zunächst liest er schweigend, doch im dritten Kapitel – als das Resultat der Wette zwischen Satan und Jehova den getreuen Hiob trifft – lässt er sich hinreißen und liest mit erhobener Stimme Vers für Vers:
Und Hiob begann und sagte: Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach: Ein Junge wurde empfangen! Dieser Tag sei Finsternis! Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen, und kein Licht soll über ihm glänzen! Dunkel und Finsternis sollen ihn für sich fordern, Regenwolken sollen sich über ihm lagern, Verfinsterungen des Tages ihn erschrecken! Diese Nacht – Dunkelheit ergreife sie! Sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres, in die Zahl der Monate komme sie nicht! Siehe, diese Nacht sei unfruchtbar, kein Jubel soll in sie hineinkommen! Es sollen sie die verwünschen, die den Tag verfluchen, die fähig sind, den Leviatan zu reizen!
Als er über die alte Familienbibel gebeugt dasitzt, überkommt ihn ein Niesanfall.
Herr M. wird verlegen. Winzige ekelhafte Speichel- und Schleimperlen haben sich wie ein gräulicher Regen auf die dünnen Buchseiten gelegt. Er versucht, sie mit einem Taschentuch abzuwischen – so vorsichtig wie möglich, da er fürchtet, die Bibelseiten könnten einen Riss bekommen.
Dann holt er sich ein Glas Wasser und trinkt.
Es ist lange her, dass er so viel gesprochen hat. Das laute Vorlesen hat ihn heiser und seinen Hals wund werden lassen. Fast fühlt es sich an, als hätte er die Stimme seines Vaters angenommen. Er kann sich noch lebhaft erinnern, wie sein Vater ihnen aus dem Buch Hiob vorlas; und tief in seinem Innern spürt er, dass es gut war, die Zeilen laut zu deklamieren – auch wenn kein Mensch gehört hat, was er zu sagen hat.
Ist es ihm in diesem Winter wirklich wie dem armen Hiob ergangen? Vielleicht nicht ganz so schlimm. Ganz im Gegenteil, als er auf seine Malereien schaut, an all den Wänden, kommt es ihm vor, als habe ihm Hiobs Wehklagen neuen Lebensmut gegeben. Was hier an den Wänden hängt, ist ein Teil von ihm selbst. Die Malereien handeln von dem, was ihm selbst im Leben widerfahren ist.
Das Buch der Bücher.
Viele Jahre hat er es nicht angerührt. Das war ein Fehler. Jugendliche Hybris war das, in seiner Bohemezeit.
»Ja, Mama!«
Das hatte er als Fünfjähriger zu seiner schwarzhaarigen Mutter gesagt, als sie ihre Kinder fragte, ob sie fest an Gott glaubten, damals, kurz bevor sie sie verließ, – und dasselbe Versprechen hatte er seinem grauhaarigen Vater am Weihnachtsfest gegeben, als er dreizehn Jahre alt war.
»Ja, ich glaube an Gott, Papa!«
Ein zweifaches Versprechen, an das er sich gleichwohl nicht hielt – nach der Begegnung mit Hans Jæger und seiner Wolfsmeute, als er noch Student an der Zeichenschule war.
Man kann seine Eltern nicht schlecht genug behandeln!
Pah, die Boheme!
Wenn er – der herausragende junge Doktor Faustus der norwegischen Kunst – in seiner Jugend jemals einen Mephisto hatte, dann muss es wohl Hans Jæger gewesen sein. Plötzlich sieht er die Augen der halbwüchsigen Ingeborg K. vor sich; ihren bohrenden Blick.
Wieso? Und weshalb ausgerechnet jetzt?
Читать дальше