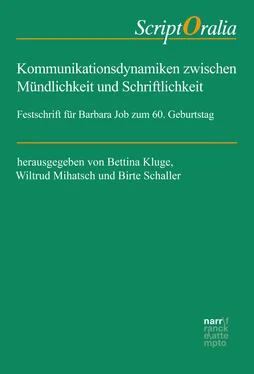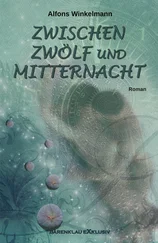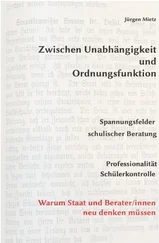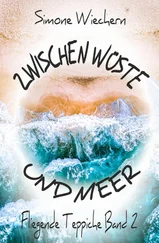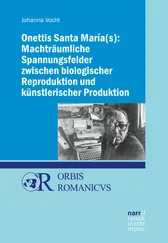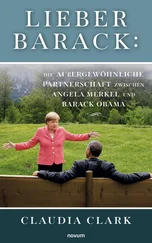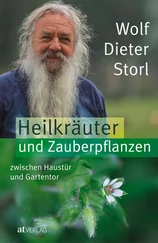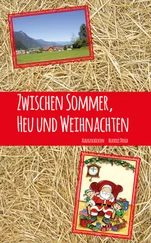Es gibt klare sachliche Gründe für die Zurückweisung des dichotomischen Denkens. Eines der zentralen Argumente von Peter Koch und Wulf Oesterreicher für die Fokussierung der sprachlichen Konzeption (auf Kosten der Fokussierung der technischen Realisation der sprachlichen Formen) ist die Beobachtung, dass die Unterscheidung von kommunikativer Nähe und Distanz auch in schriftlosen Kulturen gegeben ist. Rituelles und poetisches Sprechen ist, so die Annahme, in allen menschlichen Kulturen vom Alltagssprechen abgehoben und in den verwendeten sprachlichen Formen unterschieden. Diese Annahme scheint uns plausibel, selbst wenn die Unterschiede verschieden groß sein mögen. Für die Autoren ist ferner entscheidend, dass nicht nur die sprachlichen Formen zwischen Ritual, Poesie und Alltag variieren, sondern eben auch die kommunikativen Rahmensetzungen. Auch dieses Argument scheint uns evident, weil eine Variation aufscheint, die ganz klar medienunabhängig ist und anthropologisch in der Tatsache verankert zu sein scheint, dass die unterschiedlichen Bereiche sprachlichen Handelns von Anfang an, vor jeder medialen Weiterentwicklung, spezifische Bedingungen für das sprachliche Handeln setzen.
Nur stellt sich in der gerade skizzierten Perspektive die Erfindung der Schrift unvermutet als trivial dar – als eine Erfindung, die die Bedingungen menschlicher Kommunikation nicht wesentlich, sondern eben nur quantitativ verschoben hätte, in Richtung auf eine bequemere Handhabbarkeit der Distanz, auf eine distanziertere Distanz. Dies scheint uns wenig überzeugend. Die Erfindung der Schrift schafft nie dagewesene Bedingungen für die Sprache. Ihre Wirkmächtigkeit in historischer Hinsicht, die Bedeutung der Entwicklung von Schriftkulturen, die ganz anders geartete Möglichkeit zur Distanzierung des*der Schreiber*in vom Kommunikat und die damit einhergehenden Möglichkeiten zu dessen Ausgestaltung werden übrigens von Peter Koch und Wulf Oesterreicher niemals bestritten, sondern in Passagen zur Geschichte der Kommunikation überdeutlich herausgestellt. Ihre Überlegungen zur romanischen Sprachgeschichte und zu Ausbau- und Überdachungsprozessen (siehe etwa Koch/Oesterreicher 2011: 135–154, 183–196, 223–236) zeigen immer wieder, dass für sie die von der Schrift eröffneten Möglichkeiten, etwa die veränderten Wahrnehmungs- und Kontrollmöglichkeiten oder die Möglichkeiten der Archivierung oder Zentralisierung, entscheidende Faktoren der historischen Entwicklungen sind.
Für die Formulierung der theoretischen Grundlagen und für die Entwicklung des Modells scheinen diese historischen Einsichten aber nicht zu gelten. Hier schließen sich die Autoren der Denktradition an, die den Exteriorisierungstypus als kontingent betrachtet und die Brücke der Transkodierung zwischen den beiden Räumen fokussiert. Mit diesem Schulterschluss ist dann leider aber ein begrifflicher Kurzschluss verbunden: Das mediale Substrat kann in der Tat ausgetauscht werden, aber nur dann, wenn Medialität ausschließlich am – autonom zu denkenden – Zeichenkörper verankert wird. Die Medialität des Formulierens, der Spracharbeit, der kommunikativen Interaktion, ist dagegen nicht austauschbar. Beide Medialitäten sind möglich, aber wenn wir kontrollieren, was mit den Formen im jeweils anderen medialen Raum, auf dem jeweils gegenüberliegenden Plateau passiert, kann von Austauschbarkeit nicht mehr die Rede sein. Medialität ist im Modell von Koch und Oesterreicher sekundär, ja letztendlich zu vernachlässigen. Das Verhältnis zwischen Exterioritätstypen und den sprachlichen Strukturen zwischen Nähe und Distanz haben sie mit dem Begriff der Affinitäten beschrieben. Das ist natürlich nicht falsch, aber es bleibt unbefriedigend. Es erscheint als eine zu schwache Annahme. Die Affinitäten kommen als eine empirisch beobachtbare Größe daher, für deren Annahme es kein theoretisches Fundament gibt, die folglich ebenso gut nicht gegeben sein könnten. Dies erscheint uns als reduktionistisch und wir wollen hier dagegen argumentieren. Wir wollen die historische Tragweite der Schrift, also des Exteriorisierungstyps und der mit ihm verbundenen Produktions- und Rezeptionsbedingungen, im Modell klar zum Ausdruck bringen. In der schematischen Darstellung von Koch und Oesterreicher dominiert der Gedanke der bloßen Affinität von Exterioritätstypus und Konzeption, und diese Vereinfachung macht das Modell auch so leicht lesbar. Wie aber ist das Modell zu lesen, wenn die Medialität und die mit ihr zusammenhängende kommunikative Variation mitgedacht werden?
2 Konzeptionelle Variation: die kommunikativen Parameter
Was Nähe und Distanz trennt und verbindet, sind nach Koch und Oesterreicher variierende Bedingungen der Kommunikation und damit verknüpfte variierende sprachliche Techniken. Auf das genaue Verhältnis zwischen situativen Bedingungen und sprachlichen Konsequenzen kommen wir später noch zu sprechen. Hier soll es zunächst nur um die Mehrdimensionalität der kommunikativen Variation gehen. Denn mit der Distanzierung von der Medialität war auch der Schritt von der eindimensionalen Gegenüberstellung zweier Exterioritätstypen zu einem mehrdimensionalen kommunikativen Variationskontinuum verbunden. Peter Koch und Wulf Oesterreicher haben in ihrem 1986 erschienenen Aufsatz zehn Parameter formuliert, Variationsdimensionen, die die Variation ordnen und Parameterwerte zwischen Nähe und Distanz bestimmen. Das Inventar haben sie später kaum mehr verändert. Das Zeichen der Unabgeschlossenheit „etc.“ begleitete zwar von Anfang an dieses Inventar (Koch/Oesterreicher 1985: 23; siehe auch Oesterreicher/Koch 2016: 24), aber die Frage der Auswahl, des Umfangs und der internen Relationierung der Parameter wurde nie ausführlich thematisiert. Es entstand schnell der Eindruck, die Bestandsaufnahme der situativen Seite des Modells sei abgeschlossen und in der vorgeschlagenen Form nicht weiter zu begründen.
Diskussionsbedarf bestand und besteht aber durchaus. Wie verhält es sich beispielsweise mit dem Parameter der „ face-to-face -Interaktion/raum-zeitliche Trennung“ (Koch/Oesterreicher 1985: 23) bzw. der „physischen Nähe/Distanz der Kommunikationspartner“ (Koch/Oesterreicher 2011: 7; Oesterreicher/Koch 2016: 24)? Klar war von Anfang an, dass es sich in diesem Fall nur um ein Entweder-Oder handeln konnte, und dass somit jeder Gedanke an eine graduelle Variation ausgeschlossen war (Koch/Oesterreicher 2011: 7; Oesterreicher/Koch 2016: 24–25). Außerdem – und das wurde in der Rezeption des Modells in der Germanistik immer wieder herausgestellt – war der Parameter unmittelbar mit der medialen Dichotomie verknüpft. Vielleicht könnten wir sogar sagen, dass die Autoren in der scheinbar sorglosen Verwendung dieses (annähernd) dichotomischen Parameters bei der Beschreibung der Konzeption unbemerkt in eine Beschreibung der Bedingungen dessen wechseln, was sie Medium nennen, den Gegensatz von Graphie und Phonie. Der Parameter der physischen Nähe/Distanz bleibt in jedem Falle sperrig und er scheint auch gar nicht zu den anderen Parametern zu passen, weil er in den Diagrammen, mit denen die kommunikativen Bedingungen der einzelnen Texttypen1 als Konstellationen zusammengefasst werden, regelmäßig für wilde Ausschläge nach rechts oder links sorgt, die dem Bild eines kommunikativen Kontinuums so gar nicht entsprechen wollen (Koch/Oesterreicher 2011: 8–9).
Diese Diskussion könnte man noch unter dem Stichwort der fehlenden Ausarbeitung der Medialität verbuchen. Ganz anders und viel grundsätzlicher muss aber die Kritik an der additiven Reihung der Parameter eingestuft werden. Es kann der Eindruck entstehen, Koch und Oesterreicher hätten eine Liste zusammengestellt, die „eine Gleichheit der einzelnen Kommunikationsbedingungen […] suggeriert“, obwohl ein hierarchisiertes Modell mit klarer Gewichtung der einzelnen Parameter notwendig wäre (Ágel/Hennig 2007: 183). Koch und Oesterreicher geben in ihrer Monographie zur gesprochenen Sprache in der Romania eine knappe Begründung der Parameterwahl (siehe Koch/Oesterreicher 2011: 6). Sie benennen die „wichtigsten Instanzen und Faktoren der sprachlichen Kommunikation“, eine Auflistung der Instanzen, wie wir sie aus gängigen Kommunikationsmodellen kennen (Produzent*in, Rezipient*in, Diskurs/Text, Gegenstände/Sachverhalte); darüber hinaus geben sie auch eine kondensierte Beschreibung der „schwierigen Formulierungsaufgabe“, die „im Spannungsfeld zwischen der Linearität sprachlicher Zeichen, den Vorgaben der Einzelsprache und der komplexen, vieldimensionalen außersprachlichen Wirklichkeit [steht]“. Der nächste Satz macht noch einmal die Fokussierung der Versprachlichungsanforderungen deutlich, die im Zentrum des Nähe-Distanz-Kontinuums steht: „Produzent und Rezipient sind eingebunden in personale, räumliche und zeitliche Zeigfelder (Deixis), in bestimmte Kontexte und in bestimmte emotionale und soziale Bezüge.“ (Koch/Oesterreicher 2011: 6). Es gibt also durchaus theoretische Überlegungen zur Herleitung der Parameter. Die Frage, ob die „ungeordnete Menge“ (Hennig 2006: 74) in hierarchische Strukturen umgedeutet werden sollte, wird aber durch diese Trennung von Instanzen der Kommunikation, darauf zu beziehenden Kommunikationsbedingungen, den allgemeinen Bedingungen der sprachlichen Formulierungsarbeit und den wiederum darauf zu beziehenden Versprachlichungsstrategien selbstverständlich nicht beantwortet.
Читать дальше