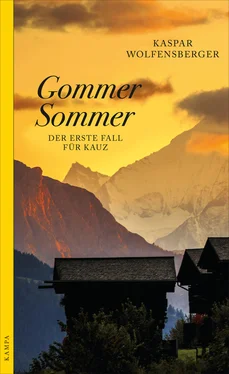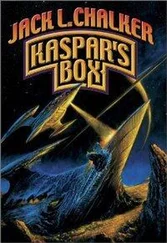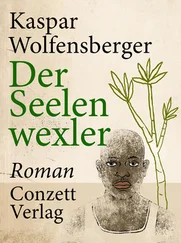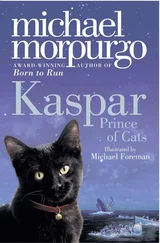Zu verkaufen , stand an einem Stall. Darunter das Logo von Z’Blatten-Immobilien. Bewilligung vorhanden , hieß es weiter. Damit musste die Baubewilligung für den Umbau in ein Ferienhaus gemeint sein. In den letzten paar Jahren florierte im Goms der Verkauf und der Umbau von Ställen und Speichern. Von Wendel hatte er einiges über diesen Boom erfahren. Er war erstaunt gewesen, dass sich Wendel nicht darüber aufregt hatte.
»I bi uberhöpt nit dergägä« , er sei überhaupt nicht dagegen, hatte er versichert.
Wenn man die Ställe, Stadel und Speicher sorgfältig umbaue, so sei ihm das lieber, als wenn sie zerfielen und verrotteten. Die meisten dieser Nutzbauten würden nicht mehr gebraucht, und sie auf eigene Kosten instand zu stellen und zu unterhalten, dafür fehle den meisten ortsansässigen Eigentümern das Geld. Die schlichte Art Umbau, wie er ihn vor zwanzig Jahren habe machen lassen, sei allerdings nicht mehr gefragt. Heute werde luxuriöse Ausstattung mit allem Komfort erwartet. Verpackt in eine schöne alte Hülle. Deshalb seien solche Holzbauten gesuchte Objekte.
»Bis keeni me hät« , bis es keine mehr gebe, hatte Wendel trocken bemerkt.
Schlimmer seien die andern, hatte er sich in einem Anfall von Redseligkeit ereifert. Die, die ganze Ferienkolonien rund um die Dörfer bauten und damit die Landschaft verschandelten.
»Nummä wägäm Gääld« , hatte er gesagt und den Kopf geschüttelt. Nur des Geldes wegen würden diese geldgierigen Siächä Land an schönster Lage zusammenkaufen und mit hässlichen Wohnblöcken überbauen. Alles Zweitwohnungen, deren Fensterläden die meiste Zeit geschlossen seien. Von dieser Welle sei Münster bis anhin verschont geblieben. Andere Dörfer seien weniger gut davongekommen.
»Äs ischt ä Schand!« , hatte Wendels Fazit gelautet.
Kauz stieg zur Antonius-Kapelle hinauf. Die Verwüstungen, die der Minstigerbach ein oder zwei Jahre zuvor mitten im Sommer angerichtet hatte, waren kaum mehr zu sehen. Dass das Dorf nicht viel mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde und dass es keine Toten gegeben habe, das habe man dem Heiligen Antonius zu verdanken, hatte Wendel gesagt.
In der Kapelle zündete Kauz für Wendel eine Kerze an. Er war kein Kirchgänger, längst hatte er sich von der Kirche entfremdet. Vielleicht hatte er auch gar nie wirklich dazugehört. Wäre ich im Goms aufgewachsen, dachte er manchmal, so wäre es wohl anders gekommen. Vielleicht wäre ich dann Schweizergardist geworden statt Polizist.
Es war ein Widerspruch, das wusste er, aber die Kerze für Wendel musste sein. Das war er ihm schuldig. Er war allein und blieb eine ganze Weile in der Kapelle stehen. Die Vorstellung, dass Wendel vielleicht immer noch am Kälberstrick in seinem eigenen Speicher hing, würgte ihn im Hals. Der Gedanke an Wendels Eltern, die vielleicht noch gar nichts von der Tragödie wussten, zog ihm das Herz zusammen. Wendelin, dachte er, du arme Seele! Was ist bloß passiert?
Das Unglück ließ ihm keine Ruhe.
Er nahm einen andern Weg zurück ins Dorf. Noch fünfmal kam er an einem Stall oder einem Stadel vorbei, der zum Kauf angeboten wurde. Immer mit dem Logo von Z’Blatten-Immobilien. Zuerst empfand er diesen Ausverkauf der Heimat als deprimierend, aber dann dachte er, es sei ja ganz in Wendels Sinn: Schöne alte Ställe und Stadel wurden zwar verkauft – an Üsserschwiizer!, also fast an Ausländer –, aber immerhin, sie blieben erhalten. Wenn sie sorgfältig umgebaut wurden, trugen sie zur Erhaltung des Ortsbilds bei. Und wurden dazu noch genutzt. Zu Wohnzwecken zwar, nicht für Vieh und Heu, aber dagegen war nichts einzuwenden. Wieso auch? Er gehörte ja auch zu den Nutznießern.
Er stieg ins Unterdorf hinab und ging in den Gommereggä, unweit der Langen Gasse.
Das Grüezi mitenand , das ihm auf der Zunge lag, konnte er gerade noch unterdrücken.
»Güätän Abänd« , sagte er stattdessen laut und vernehmlich.
Einige der Männer, die um den Stammtisch saßen, hoben den Kopf, andere blickten mürrisch in ihr Glas.
Zwei, drei, die schon etwas intus hatten, erwiderten seinen Gruß. Einer schien ihn zu erkennen – Kauz ging jedes Jahr im Gommereggä ein und aus –, hob die Hand und sagte: »Salü!«. Aber er lud ihn nicht ein, sich zu ihnen an den Stammtisch zu setzen.
Kauz kannte die knorrige Art der Gommer Männer. Er war ja selbst aus diesem Holz geschnitzt. Er setzte sich an einen separaten Tisch und gab der Serviertochter einen Wink: »Schtangä!«
Die Serviertochter stellte das Bier vor ihn auf den Tisch: »Gsundheit!«
Er fühlte sich hundeelend beim Gedanken daran, dass er jetzt ohne Wendel hier sitzen musste. Trotzdem nahm er einen großen Schluck. Bhüeti! , dachte er und stieß innerlich mit ihm an. Oder was soll man einem Toten wünschen?
Eine Weile war es still im Lokal. Dann wurde das Gespräch, das wohl seinetwegen unterbrochen worden war, wieder aufgenommen. Es drehte sich um einen Verkehrsunfall, der sich am Morgen zugetragen hatte. Der Fahrer war abgehauen. Man überbot sich mit Vorschlägen, wie man mit dem Flüchtigen verfahren müsste. Offenbar hatte der flüchtige Fahrer einen Einwohner namens Hubert angefahren und schwer verletzt. Hubert liege im Spital Visp im Koma, wusste der eine. Ach was, er sei nach Bern ins Inselspital geflogen worden, meinte ein anderer. Nein, er sei tot, behauptete ein Dritter.
Nach einer Weile betrat ein weiterer Gast die Gaststube. Er blieb neben dem Stammtisch stehen.
»Hedär keert?«
»Was?«
Der neue Gast sah sich mit einem misstrauischen Blick nach Kauz um. Dann raunte er denen am Stammtisch etwas zu.
»Was? Schandarmä? Bim Wändel schim Schpiichär?«
»Gwiss!«
»Wägä was?«
Kauz hörte wieder ein Raunen.
»Was?! Toot? Bischt sichär?«
»Fiiwoll!«
»Dr Gottswillä!«
Die traurige Nachricht machte also schon die Runde. Sie würde sich wie ein Lauffeuer durch das Dorf und das ganze Tal verbreiten. Kauz blieb sitzen. Mit halbem Ohr schnappte er Dinge auf, die am Stammtisch gesprochen wurden. Alle zeigten sich schockiert. Es war klar, dass niemand Wendels Tod erwartete hatte, schon gar nicht einen Selbstmord. Keiner sprach ein böses Wort. Offensichtlich war Wendel ein respektierter und geschätzter Minstiger gewesen. Seine Eltern, wollte man den Worten glauben, taten allen schrecklich leid.
Es hielt Kauz nicht länger. Er legte das Geld für das Bier auf den Tisch, stand auf und wandte sich zum Gehen.
»Was ischt das fär eenä«? , hörte er einen in seinem Rücken tuscheln, ehe sich die Tür hinter ihm schloss.
Er nahm den Weg durch die Lange Gasse.
Der Streifenwagen stand immer noch auf der mit einem Fahrverbot belegten Straße, daneben ein beiger Subaru. Der Bezirksarzt ist da, vielleicht auch der Staatsanwalt, schloss Kauz. Ein Leichenwagen fuhr eben vor. Die Umstehenden wichen zurück und verzogen sich zwischen die Ställe und Stadel auf der andern Straßenseite. Jetzt bereute Kauz, dass er beim Warten auf die Polizei nicht aufgelesen hatte, was er auf der Erde hatte liegen sehen. Langsam näherte er sich Wendels Ziegenstall und hob die nur halb gerauchte Zigarette, die immer noch zwischen Stall und Stadel auf dem Boden lag, mit einem Papiertaschentuch auf. Darin eingewickelt steckte er sie ein.
Die Speichertür ging auf, zwei Männer trugen einen hölzernen Sarg heraus und luden ihn in den Leichenwagen. Die Menschen ringsum hörten auf zu tuscheln. Eine alte Frau schlug das Kreuz und murmelte ein Gebet. Eine andere schluchzte auf und hielt sich die Hand vor den Mund, wieder eine wischte sich Tränen aus dem Gesicht. Ein Greis nahm die Mütze ab und senkte den Kopf.
Читать дальше