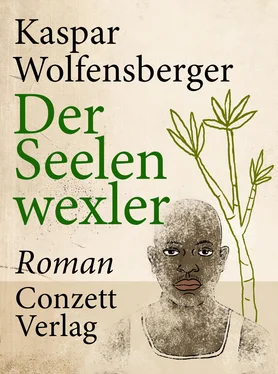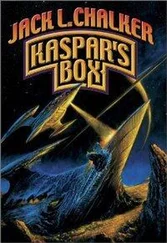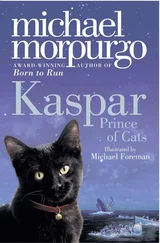Kaspar Wolfensberger
Der Seelenwexler
Roman
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck in jeder Form sowie die Wiedergabe durch Fernsehen, Rundfunk, Film, Bild- und Tonträger, die Speicherung und Verbreitung in elektronischen Medien oder Benutzung für Vorträge, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Verlags
© 2. Auflage 2014 Conzett Verlag by Sunflower Foundation, Zürich
Cover: www.sofie.erhardt.ch
ISBN 978-3-03760-030-6
www.conzettverlag.ch www.kasparwolfensberger.ch
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Prolog: Zanggers Fieber
Côte d’Ivoire, im Jahr 1977.
Plötzlich wurde es ihm am Steuer speiübel. Er konnte seinen VW-Camper noch an den Pistenrand manövrieren, die Wagentür aufstossen und sich aus dem Fahrersitz beugen. Auf der roten Erde bildete sich eine Lache, die rasch versickerte. Da sass er nun, von Fieber geschüttelt, das Hemd bekleckert, mitten im Nirgendwo. Mutterseelenallein, sterbenskrank. Seine rechte Seite schmerzte. Er nahm einen Schluck aus seiner Feldflasche, spülte den Mund und spuckte das Wasser aus. Den zweiten Mundvoll versuchte er zu schlucken – und musste sich gleich wieder übergeben. Erschöpft beugte er sich über das Lenkrad. Er hob den Kopf und blickte in den Rückspiegel. Das Weiss seiner Augen leuchtete kanariengelb. Jetzt wusste er, was es geschlagen hatte: Gelbsucht. Akute Hepatitis.
An Weiterfahrt war nicht zu denken. Er setzte sich am Pistenrand neben seinen Camper und wartete auf Rettung. Vor zwei Tagen war er in Man aufgebrochen und, mit fiebrigem Kopf, an diesem Tag bereits fünf oder sechs Stunden gefahren. Er war keinem einzigen Fahrzeug begegnet. Es konnte Stunden, vielleicht ein, zwei Tage dauern, bis jemand auf dieser Piste vorbeifuhr. Er wusste nicht genau, wo er sich befand. Vielleicht hundert, zweihundert Kilometer von Abidjan entfernt? Die Küste hatte er noch nicht erreicht, aber weit konnte es nicht mehr sein bis zur Lagune von Grand-Lahou. Dort hatte er eine Woche zuvor für ein paar Tage Halt gemacht. Schon damals hatte er sich fiebrig und krank gefühlt. Malariakrank, hatte er gedacht, fern der Heimat, wie Doktor Livingstone vor hundert Jahren. In seinem fiebrigen Zustand hatte er eigenartigen Gefallen am Vergleich mit dem legendären Arzt und Afrikaforscher gefunden.
Die Hitze war kaum auszuhalten. Er netzte einen Waschlappen und legte ihn auf seine Stirn. Er nippte an der Feldflasche und befeuchtete sich die Lippen. Sobald er einen grösseren Schluck nahm, kam ihm buchstäblich die Galle hoch. Auf der Fahrt durch den Urwald hatte er zwei-, dreimal anhalten und sich in die Büsche schlagen müssen. Jetzt wird’s brenzlig, dachte er, wenn es so weitergeht, droht Dehydrierung. Er fürchtete, bald ins Delirium zu fallen. David Livingstone starb in den Sümpfen Sambias am Fieber, im Alter von sechzig Jahren. Musste er, Lukas Zangger, Tropenarzt in spe und nicht einmal dreissigjährig, jetzt am Rand einer Urwaldpiste elendiglich zugrunde gehen? Würde es ihr leidtun, die Nachricht von seinem einsamen Tod in Westafrika zu hören?
Es gab ringsum massenhaft grosse Bäume, aber sie waren zu weit von der Piste entfernt. Die Pistenbauer hatten rücksichtslos eine breite Schneise in den Urwald geschlagen. Er wagte es nicht, sich in den Schatten eines Baumes zu legen. Er durfte nicht riskieren, dass ein Vorbeifahrender zwar seinen Camper, nicht aber ihn selber sehen würde. Um der sengenden Sonne zu entrinnen, kroch er, seiner geistigen Kräfte schon halb beraubt, mit der Feldflasche in der Hand unter das Fahrzeug. Er wollte um jeden Preis wach bleiben.
Kaum lag er unter dem Camper, dämmerte er weg …
«Qu’est-ce qu’il y a? Une panne?»
Die Stimme kam von weit her. Auf dem Rücken liegend, öffnete Lukas die Augen und drehte den Kopf. Er glaubte zu halluzinieren: Er sah bloss ein Paar Schuhe. Turnschuhe. Seine Turnschuhe!
«Tu dors?»
Jetzt erkannte er neben den Schuhen ein schwarzes Gesicht. Verkehrt herum, ein hängendes Gesicht, Augen unten, Mund oben. Lukas wollte etwas sagen. Er konnte nicht, die Zunge klebte an seinem Gaumen.
«T’es malade?»
Lukas blickte benommen in das schwarze, irgendwie bekannte Gesicht.
«T’es malade, n’est-ce pas?», wiederholte die Stimme. Eine Hand streckte sich ihm entgegen. Er fasste sie und liess sich unter dem Camper hervorziehen.
«Mais oui», stellte Félix fest, als Lukas auf den Beinen stand, «t’es vraiment malade.»
Er nahm ihm die Feldflasche aus der Hand und reichte sie ihm, damit er trinke. Lukas schüttelte den Kopf.
«Gravement malade», konstatierte Félix. «Il faut voir un guérisseur. Tout de suite. Viens!», sagte er und nahm ihn bei der Hand.
Verwirrt schloss Lukas den Camper ab und schaute um sich. Mit einer Geste machte Félix ihm klar, dass das Fahrzeug sicher sei. Dann zog er ihn von der Piste weg. Halb in Trance – stets die Turnschuhe fixierend, die er dem Jungen eine Woche zuvor geschenkt hatte –, trottete Lukas auf einem Trampelpfad hinter Félix durch den Urwald. Wie lange, wusste er nicht, er hatte kein Zeitgefühl mehr. Der Frage, wie Félix ihn gefunden hatte, konnte er nicht mit klarem Kopf nachgehen, schon gar nicht, indem er ihn fragte. Er war nicht mehr in der Lage, ein Gespräch zu führen. Aber er wusste, dass ein Kommen und Gehen in Afrika nie unbemerkt blieb, ganz gleich ob in der Wüste, in der Steppe oder im Urwald. Bäume, Sträucher und Büsche hatten Augen, Felsen und Hütten hatten Ohren. Und Nachrichten verbreiteten sich in Afrika in Windeseile. Irgendjemand musste seinen auffälligen hellgrünen Camper gesehen oder gehört haben. Und im Umkreis von Grand-Lahou wusste jeder, dass Félix der Führer des weissen Mannes gewesen war, der am Steuer dieses Fahrzeugs sass. Es konnte nur eine Frage der Zeit gewesen sein, bis ihm die Nachricht zugetragen wurde. Und er sich auf den Weg machte, um zu sehen, was los war. Vielleicht war Félix ein paar Stunden gelaufen, vielleicht war Lukas aber auch kurz vor Grand-Lahou gestrandet, nur einen Sprung von Félix’ Hütte entfernt, er wusste es nicht.
Sie trafen bei einem Kraal ein. Félix liess Lukas stehen und rief nach dem Medizinmann. Erst als er dazu aufgefordert wurde, betrat er den Kraal und erwies dem Guérisseur seine Reverenz. Félix sagte ein paar Sätze auf Dioula und überliess Lukas dann dem Heiler. Lukas hörte die beschwörenden Worte, die der Medizinmann sagte, verstand sie aber nicht. Er roch den Dung und den Rauch in der Hütte und nahm, nur halb bei Bewusstsein, wahr, wie der Heiler zu murmeln und über einem Kessel, der auf einem eisernen Dreifuss über dem Feuer stand, zu hantieren und zu rühren begann. Irgendwann senkte der Heiler eine blecherne Henkeltasse in den Kessel, schöpfte von der Flüssigkeit und reichte Lukas den Trunk. Er roch abstossend, und doch empfand Lukas den unbändigen Wunsch, davon zu trinken. Er nippte an der Tasse. Der Trunk schmeckte wie bittere Medizin, widerlich und wohltuend zugleich. Zu seiner Überraschung spürte er keinen Brechreiz. Er nahm einen ganzen Schluck. Nichts geschah. Dann leerte er, begleitet von einer auffordernden Gebärde des Medizinmanns, die Henkeltasse. Der Medizinmann, der bisher eine ernste Miene gezeigt hatte, nickte zufrieden. Er hiess ihn zwei weitere Tassen trinken, dann hängte er ihm ein Amulett um. Er zeigte auf eine Decke, die ausgebreitet auf dem Fussboden der Hütte lag, und bedeutete Lukas, sich hinzulegen. Lukas legte sich hin und fiel in einen tiefen Schlaf. Einige Male wachte er halbwegs auf, jemand wischte den Schweiss von seiner fiebrigen Stirn, und er bekam jedes Mal eine Tasse des Heiltrunks vorgesetzt, die er, im Dämmerschlaf, leerte. Am nächsten Tag erhielt er etwas zu essen, was nach gekochten Bananen schmeckte. Am dritten Tag fühlte er sich mit einem Mal wieder gesund. Er stand auf, Félix erwartete ihn schon draussen vor dem Kraal. Als Entgelt für die wundersame Heilung überliess Lukas dem Guérisseur sein Schweizer Armeesackmesser mit acht Klingen und das nicht eben saubere, khakifarbene Hemd mit Brusttaschen, das er über seinem T-Shirt trug. Dem Heiler schien das ein angemessener Lohn zu sein, jedenfalls strahlte er übers ganze Gesicht, entblösste die lückenhaften Zahnreihen und deutete eine Verbeugung an, die Lukas seinerseits mit einer Verbeugung, einer tieferen, erwiderte. Der Heiler nahm das Amulett von Lukas’ Hals, füllte den eingekochten Rest des Heiltrunks in ein grünes, gläsernes Flakon, schraubte einen Deckel drauf und steckte ihm das Flakon zu. Félix erklärte ihm, die Worte des Guérisseurs übersetzend, dass er das Konzentrat mit Wasser aufkochen und zu sich nehmen müsse, sollte unterwegs das Fieber wieder auftreten.
Читать дальше