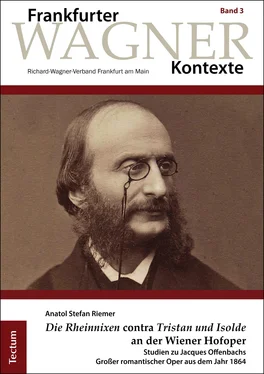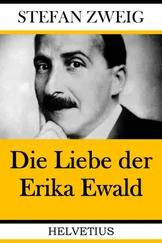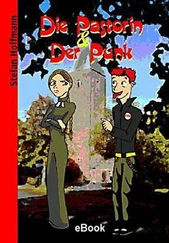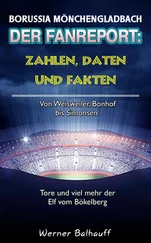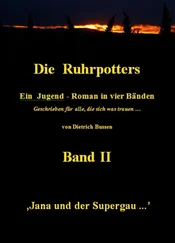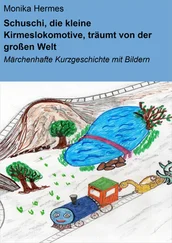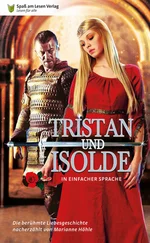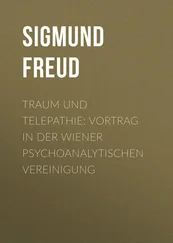27Siehe hierzu beispielsweise Werner Breig, »Wagners kompositorisches Werk«, in: Richard-Wagner-Handbuch, S. 353–470, hier S. 353: »Sein Frühwerk zeigt vielmehr eine Art der Bindung an prägende musikalische Vorbilder, die ausgesprochen epigonale Züge hat. Die Ausmerzung dieser Züge, oder – positiv gewendet – die Herausbildung eigener Schaffensintentionen, denen die Elemente der Tradition dienstbar gemacht werden konnten, geschah in einem längeren Prozeß, der erst in der Pariser Zeit um 1840 abgeschlossen war.«
28Siehe hierzu Peter Wapnewski, »Die Oper Richard Wagners als Dichtung«, in: Richard-Wagner-Handbuch, S. 223–352, hier S. 232 f.
29Vgl. zur wechselseitigen Beziehung zwischen Paris und Offenbachs musikalischer Sprache – auch jenseits seiner Opéra bouffe La Vie parisienne (1866) – Peter Hawig: »Und da gibt es […] ein eben nicht empirisch greifbares, sondern ein künstlerisch erzeugtes, ein fiktionales Paris, das als Phantasmagorie in Offenbachs ›Operetten‹ entsteht, aber in einem Rückkopplungseffekt das Bild des realen Paris wiederum stark beeinflusst hat.« (zitiert aus dem Vortrag »Offenbachs Paris«, gehalten am 15.10.2019 im Rahmen einer Ringvorlesung zu Jacques Offenbach an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Wintersemester 2019/2020; Publikation in Vorbereitung).
30Parallelen bzw. spiegelbildliche Entsprechungen im »Exil«-Schaffen beider Komponisten lassen sich bis zur Ebene kleiner Gelegenheitskompositionen und Gebrauchsmusik nachverfolgen: »Daß Wagner, der in Bezug auf die Konventionalität der französischen und der italienischen Oper später kein Pardon kannte, mit dem letzten Lied des Zyklus [Acht französische Lieder (1839–1840, WWV 53–61)], Adieux de Marie Stuart, eine regelrechte Meyerbeersche Opernszene komponiert hat, mutet im historischen Rückblick kurios an […] und zeigt, wie sehr [Wagner] sich in diesen Liedern, mit denen sich er in Frankreich etablieren wollte, die später so verteufelte französische Operntradition zu eigen gemacht hatte.« (siehe hierzu Annette Förger, »›… immer kommt das Erbe auf uns zu, fordernd, Antworten verlangend …‹. Tradition als Fluch und Herausforderung: Hans Werner Henze und Richard Wagner«, in: wagnerspectrum 1/1 (2005), S. 127–144, hier S. 133). Offenbach hingegen schreibt während seines Kölner Aufenthaltes in den Jahren 1848–1849 für Bürgerwehrmusikkapellen und Gesangsvereine eine Reihe von deutsch-patriotisch gefärbten und romantischen Liedern, die in seinem Schaffen ebenfalls eine ausgesprochen randständige Position einnehmen. Eines dieser Lieder, Das deutsche Vaterland, verwendet Offenbach 1864 erneut in den Rheinnixen und weist ihm, wie später noch ausführlicher erläutert werden wird, bedeutsame erinnerungsmotivische Funktion zu.
31Jean-François Candoni, »Verdi, Wagner und die französische Grand Opéra«, in: Verdi & Wagner. Kulturen der Oper, S. 93–111, hier S. 99.
32Vgl. hierzu Carl Dahlhaus, »Wagners Stellung in der Musikgeschichte«, in: Richard-Wagner-Handbuch, S. 60–85, hier S. 67.
33Matthias Brzoska, Die Idee des Gesamtkunstwerks in der Musiknovellistik der Julimonarchie, Laaber 1995 (Thurnauer Schriften zum Musiktheater, 14), S. 215.
34Siehe hierzu Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, hrsg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, Frankfurt am Main 2003 (Gesammelte Schriften, Bd. 12), S. 159.
35Jacques Offenbach, Concours pour une opérette en un acte, in: Le Figaro 3/148, 17.07.1856, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k269487z/f7.item, abgerufen am 20.06.2020. – Ein Übertragungsfehler Anton Henselers ist dafür verantwortlich, dass in der deutschsprachigen Offenbach-Literatur wiederholt die »einfache und heitere« Machart fälschlicherweise als Maxime von Offenbachs Musiksprache definiert wird. Diesem Irrtum sitzt beispielsweise auch Carl Dahlhaus auf: »Ein ›genre primitif et gai‹, wie Offenbach es nannte, ein Genre, dessen musikalische Substanz in den Lied-, Tanz- und Marschtypen einer Zeit, aber auch in der parodistischen Aneignung von Formen und Stilmitteln der ›ernsten‹ Musik besteht, wird allmählich zu einer Gattung, deren ästhetischer Anspruch sie der Sphäre des Jahrmarkts, der Vorstadt und des ›grünen Wagens‹ entrückt, manchmal zum Bedauern der Akteure wie des Publikums.« (siehe ders., Die Musik des 19. Jahrhunderts, S. 188 f.).
36Peter Hawig, Offenbach für Einsteiger, Bad Ems 2019 (Bad Emser Hefte, 539), S. 14.
37Siehe hierzu Peter Hawig, Offenbachs verhinderte Große Oper. Die Schauspielmusik zu Victorien Sardous Historiendrama ›La Haine‹, Bad Ems 2012 (Bad Emser Hefte, 341).
38Bereits 1857 komponiert Offenbach die einaktige Opérette fantastique Les Trois Baisers du diable, in der zwar zahlreiche Elemente der romantischen Musiksprache zur Nachzeichnung der schauerlichen Figur des Gaspard eingesetzt werden. Aufgrund ihrer Kürze und gleichsam kammermusikalischen Behandlung erreicht sie jedoch nicht das dramaturgische Gewicht der Rheinnixen oder von La Haine.
39Siehe hierzu Friedrich Nietzsche, »Unzeitgemäße Betrachtungen IV. Richard Wagner in Bayreuth«, in: Ders., Die Geburt der Tragödie. Unzeitgemäße Betrachtungen, kritische Studienausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 1999 (Sämtliche Werke, Bd. 1), S. 429–510, hier S. 487.
40Sieghart Döhring und Sabine Henze-Döhring, Oper und Musikdrama im 19. Jahrhundert, Laaber 1997 (Handbuch der musikalischen Gattungen, 13), S. 271.
41Carl Dahlhaus, »Zitierte Musik. Zur Dramaturgie des Antonia-Aktes in Hoffmanns Erzählungen«, in: Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen, S. 309–316, hier S. 311 f.
42Das Vorspiel wurde bereits am 12. März 1859 in Prag mit einem von Hans von Bülow komponierten Konzertschluss aufgeführt, der Wagner jedoch nicht überzeugt hat (siehe hierzu beispielsweise John Deathridge, Martin Geck und Egon Voss, Wagner-Werk-Verzeichnis (WWV). Verzeichnis der musikalischen Werke Richard Wagners und ihrer Quellen, Mainz u. a. 1986, S. 445).
43Auf Jodel-Elemente bzw. auf die »Tyrolienne« als in sich geschlossene Gesangsnummer greift Offenbach mehrfach in seinen Bühnenwerken zurück, beispielsweise als couleur locale in der »Tyrolienne« (No 2 bis) des frühen Einakters Le 66 (1856), oder parodisierend im »Chœur et Barcarolle« (No 1) im I. Akt von Le Pont des Soupirs (1861), im »Chœur et Couplets de Pâris« (No 21) im III. Akt von La Belle Hélène (1864) oder in der »Tyrolienne« (No 19) im II. Akt der Zweitfassung von Geneviève de Brabant (1867).
44Siehe hierzu Henseler, Jakob Offenbach, S. 260, aufgegriffen beispielsweise in Haffner, »Offenbach und Wagner«, S. 204 oder zitiert in Schwarz, Jaques Offenbach, S. 255.
45In seiner »Villa Orphée« im Seebad Étretat veranstaltet Offenbach zu besonderen Gelegenheiten mit burlesken und dadaistisch anmutenden Elementen gespickte Hausfeste, die u. a. auch mit Musik Richard Wagners untermalt werden (vgl. hierzu Alain Decaux, Offenbach. König des zweiten Kaiserreichs, aus dem Französischen übers. von Lilli Nevinny, München 1960 (Titel der Originalausgabe Offenbach, roi du Second Empire, Paris 1958), S. 229).
46An dieser Stelle setzt nicht etwa ein Zitat aus einem der in den Konzerten Wagners vorgestellten Bühnenwerke ein, sondern der dem Pariser Publikum aus dem Vorjahr bekannte »Karnevalsschlager« Les bottes de Bastien von Eugène Imbert (1821–1898).
47Für den vorliegenden Zusammenhang ist, wie weiter unten noch ausführlicher dargestellt wird, dieses Ballett auch insofern von Interesse, als Offenbach eine der zugkräftigsten Nummern, die »Valse des rayons«, später in die Rheinnixen übernimmt und ihrem Hauptthema erinnerungsmotivische Funktion verleiht. – Offenbachs Weg an die beiden bedeutendsten Pariser Bühnen, das Théâtre Impérial de l’Opéra und die Opéra-Comique, gestaltete sich anfangs ausgesprochen steinig. Im Zusammenhang mit dem Misserfolg seiner Opéra comique Barkouf (1860) stellt er in einem offenen Brief an den Herausgeber des Figaro, Hippolyte de Villemessant, am 30.12.1860 mit Blick auf sein Ballett fest: »La croisade a commencé à propos du Papillon, et je crois que jamais on n’a fait à de la musique de ballet l’honneur de l’écouter avec autant de curiosité et autant de désir de la trouver mauvaise.« (zitiert nach Jean-Claude Yon, Jacques Offenbach, Paris 2000, S. 242).
Читать дальше