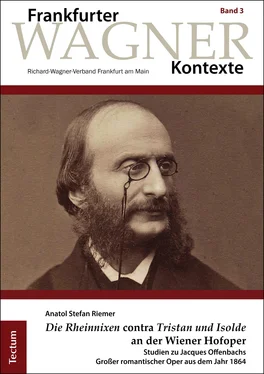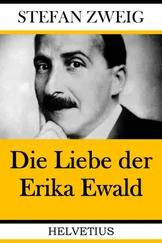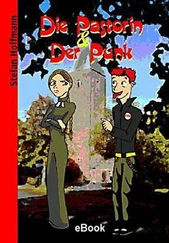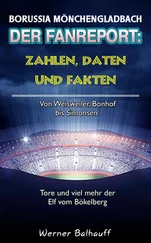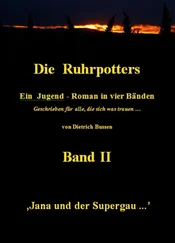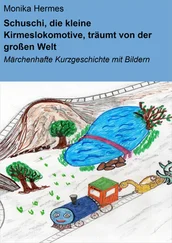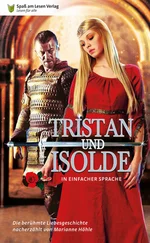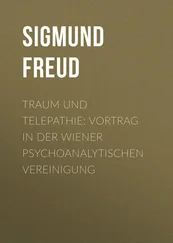* * *
6Siehe für entsprechende Darstellungen z. B. Maria Haffner, »Offenbach und Wagner«, in: Der Auftakt 10/9–10 (1930), S. 203–206; Peter Ackermann, »Eine Kapitulation. Zum Verhältnis Offenbach – Wagner«, in: Jacques Offenbach. Komponist und Weltbürger, hrsg. von Winfried Kirsch und Ronny Dietrich, Mainz u. a. 1985 (Beiträge zur mittelrheinischen Musikgeschichte, 26), S. 135–152; Peter Hawig, Wagner und Offenbach. Ein Vergleich anhand der romantischen Opern Die Feen und Die Rheinnixen, Bad Ems 2013 (Bad Emser Hefte, 345), hier S. 1–2 oder zuletzt Ralf-Olivier Schwarz, Jacques Offenbach. Ein europäisches Portrait, Köln u. a. 2019, hier S. 253–259.
7Anton Henseler, Jakob Offenbach, Berlin 1930, S. 261.
8Ackermann, »Eine Kapitulation«, S. 135.
9Lionel Pons, Jacques Offenbach, hrsg. von »Les Amis de la musique française«, [Montrem] 2003, S. 29.
10Grete Wehmeyer, Höllengalopp und Götterdämmerung. Lachkultur bei Jacques Offenbach und Richard Wagner, Köln 1997, S. 148.
11Wehmeyer, Höllengalopp und Götterdämmerung, S. 151.
12Anna-Christine Brade, Kundry und Stella. Offenbach contra Wagner, Bielefeld 1997, S. 9.
13Siehe Yvonne Nilges, »Die Meistersinger von Nürnberg oder Die Geburt der musikalischen Komödie aus dem Geiste Shakespeares«, in: wagnerspectrum 3/1 (2007), S. 7–34, hier S. 19.
14Siehe Arne Stollberg, »›… wenn die Würde und Konvention plötzlich durch das Naturgesetz gebrochen wird‹ – Zur musikalischen Darstellung des Komischen in Wagners Musiktheater«, in: wagnerspectrum 3/1 (2007), S. 35–58, hier S. 37.
15Siehe hierzu Theodor W. Adorno, »Versuch über Wagner«, in: Ders., Die musikalischen Monographien, hrsg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, Frankfurt am Main 2003 (Gesammelte Schriften, Bd. 13), S. 7–148, hier S. 19. Adorno nennt als Beispiel für »humoristische Figuren« neben Beckmesser auch Alberich und Mime. – Vgl. in diesem Zusammenhang mit Blick auf den Antisemitismusvorwurf anhand der Ausgestaltung der Rolle von Mime beispielsweise Dieter Borchmeyer, »Richard Wagner und der Antisemitismus«, in: Richard-Wagner-Handbuch, S. 137–161, hier S. 159: »Seit Theodor W. Adornos Versuch über Wagner (1952) ist immer wieder behauptet worden, auch in Wagners musikdramatischem Werk gebe es deutliche Spuren des Antisemitismus. Demgegenüber ist festzustellen, daß es in den zahllosen Kommentaren Wagners zu seinem Werk keine einzige Äußerung gibt, die Figuren oder Handlungselemente seiner Musikdramen in antisemitischem Sinne oder überhaupt als jüdisch interpretiert. Der Versuch, die Nibelungen, vor allem die Gestalt Mimes unter Hinweis auf Wagners Beschreibung der Erscheinung und Sprache der Juden in seinem Pamphlet von 1850 als mythische Reprojektionen des Judentums zu dechiffrieren, stellt eine nicht verifizierbare Spekulation dar.«
16Theodor W. Adorno, »Hoffmanns Erzählungen in Offenbachs Motiven«, in: Ders., Musikalische Schriften IV. Moments musicaux. Impromptus, hrsg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, Frankfurt am Main 2003 (Gesammelte Schriften, Bd. 17), S. 42–46, hier S. 44.
17Carl Dahlhaus, Richard Wagners Musikdramen, München u. Zürich 1988, S. 67.
18Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber 1980 (Neues Handbuch der Musikwissenschaft, 6), S. 234.
19[Anonymus], Richard Wagner und Jacob Offenbach. Ein Wort im Harnisch von einem Freunde der Tonkunst, Altona 1871, S. 47. Der Autor widmet seine Schrift »[D]en Manen unserer großen Componisten Sebastian Bach, Händel, Haydn, Mozart, Gluck, Beethoven, Weber, Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann«, siehe [S. 3].
20Ackermann, »Eine Kapitulation«, S. 139.
21[Anonymous], Richard Wagner und Jacob Offenbach, S. 6.
22Ebd., S. 30.
23Ebd., S. 46. – Siehe zum Aspekt des Dilettantismus bei Wagner z. B. auch Adorno, »Versuch über Wagner«, S. 26: »Tatsächlich und nicht nur oberflächlich, sondern mit Leidenschaft und Bewunderung hingeblickt, kann man sagen, auf die Gefahr hin, mißverstanden zu werden, daß Wagners Kunst ein mit höchster Willenskraft und Intelligenz monumentalisierter und ins Geniehafte getriebener Dilettantismus ist. Die Vereinigungsidee der Künste selbst hat etwas Dilettantisches und wäre ohne die mit höchster Kraft vollzogene Unterwerfung ihrer aller unter sein ungeheures Ausdrucksgenie im Dilettantischen steckengeblieben.« – Eine knappe Bewertung der Neuerungen im Werk beider Musikdramatiker findet sich beispielsweise bei Jean-Claude Yon, der zu dem Ergebnis gelangt, dass »[die] Operette […] das Musiktheater ebenso gründlich wie Wagners Opern [verändert], als deren Gegenteil sie erscheint, aber mit denen sie durch einen gemeinsamen Erneuerungswillen verbunden ist.« (siehe ders., »Die Gründung des Théâtre des Bouffes-Parisiens oder die schwierige Geburt der Operette«, in: Jacques Offenbach und das Théâtre des Bouffes-Parisiens 1855. Bericht über das Symposion Bad Ems 2005, hrsg. von Peter Ackermann, Ralf-Olivier Schwarz und Jens Stern, Fernwald 2006 (Jacques-Offenbach-Studien, 1), S. 27–50, hier S. 28). – Siehe zur Frage der handwerklichen Beherrschung von Satztechnik beispielsweise auch Ludwig Finschers Unterscheidung von »affektivem« und »parodistischem« Kontrapunkt im Tristan bzw. in den Meistersingern (vgl. ders., »Über den Kontrapunkt der Meistersinger«, in: Das Drama Richard Wagners als musikalischen Kunstwerk, hrsg. von Carl Dahlhaus, Regensburg 1970 (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, 23), S. 303–312, hier S. 306 f.) oder Johannes Schild zum Liebesthema im Vorspiel zu den Meistersingern: »Hier gibt sich eine Musik kontrapunktisch, ohne es im engeren Sinne zu sein, und gerade so erfüllt sie ihre Aufgabe brillant.« (siehe ders., »Heitere Spätblüte: Falstaff und Meistersinger gegenübergestellt«, in: Verdi & Wagner. Kulturen der Oper, hrsg. Arnold Jacobshagen, Köln u. a. 2014, S. 112–149, hier S. 142). Anton Henseler verweist darauf, dass die Verwendung polyphoner Strukturen bei Offenbach, z. B. in den Kanons »Quatuor, Chanson, Causerie et Ensemble« (No 10) im II. Akt von Les Bavards (1863) oder im »Canon« (No 10) im II. Akt von Les Brigands (1869) aufgrund ihrer Abweichung vom übrigen satztechnischen Gefüge parodistische Wirkung entfaltet und die vermeintliche kontrapunktische Kunstfertigkeit damit gleichsam in ihr Gegenteil verkehrt wird (vgl. ders., Jakob Offenbach, S. 421).
24Siehe hierzu Richard Wagner, »›Zukunftsmusik‹. An einen französischen Freund als Vorwort zu einer Prosa-Übersetzung meiner Operndichtungen«, in: Ders., Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. 7, Leipzig 41907, S. 87–137, hier S. 119. – Siehe mit Blick auf die Implementierung der Philosophie Arthur Schopenhauers in Tristan und Isolde Andreas Dorschel, »Die Idee der ›Einswerdung‹ in Wagners Tristan«, in: Richard Wagner. Tristan und Isolde, hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München 1987 (Musik-Konzepte, 57/58), S. 3–45, hier S. 30: »Wagner war eben kein um theoretische Stringenz bemühter Philosophieprofessor, der auch komponierte; er verfuhr nicht systematisch, sondern eklektisch.«
25Henseler, Jakob Offenbach, S. 420.
26Ulrich Dibelius, »›La Prise de Troie‹ – doppelt bis dreifach«, in: Jacques Offenbach, hrsg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München 1980 (Musik-Konzepte, 13), S. 17–36, hier S. 18. – Siehe für eine weitergehende Erörterung der Theorierelevanz bei Offenbach Anatol Stefan Riemer, »Palindrome, Symmetrien und kreisförmige Strukturen. Eine analytische Annäherung an Jacques Offenbachs Themen- und Motivgestaltung in den Rheinnixen«, in: Der »andere« Offenbach. Bericht über das internationale Symposium anlässlich des 200. Geburtstages von Jacques Offenbach in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main am 18. und 19. Oktober 2018, hrsg. von Alexander Grün, Anatol Stefan Riemer und Ralf-Olivier Schwarz, Köln 2019 (Beiträge zur Offenbach-Forschung, 4), S. 103–128, hier S. 104 f.
Читать дальше