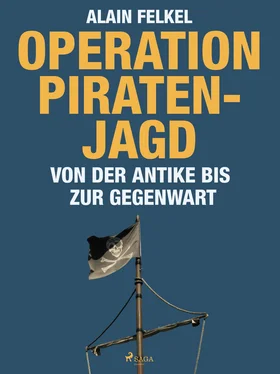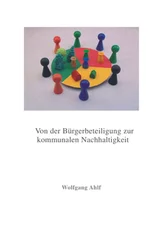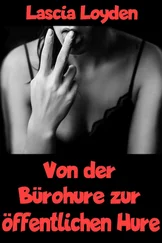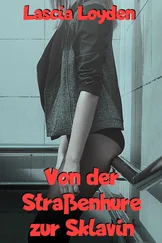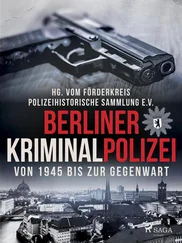Die Phönizier waren eine Seefahrer- und Handelsnation, die seit 1000 v. Chr. das Mittelmeer besiedelte. Sie waren die erste Seefahrernation, die sich nicht mehr davor scheute, über das offene Meer zu navigieren. Grund genug für Sargon II., ihnen die Leitung seiner Marine anzuvertrauen.
Die Schiffe, welche die Phönizier im Dienst des assyrischen Königs steuerten, hießen »Biremen«. Sie hatten zwei Ruderreihen und wurden aus Zedernholz gebaut. Sie waren hochbordig, besaßen einen senkrechten Steven und ein bauchiges Heck. Aus ihrem stumpfen Bug ragte der zu einer kegelförmigen Ramme verlängerte Kiel. Am Heck befand sich ein erhöhtes Verdeck und in der Bordmitte ein Mast mit einem rahgetakelten Segel, das schnell gerefft werden konnte. Back- wie steuerbords schützte ein Schanzkleid zwei Ruderreihen mit mindestens neun bis zehn Ruderern vor feindlichen Geschossen. Über der höchsten Ruderreihe befand sich das Kampfdeck, von dem aus Schwerbewaffnete durch an der Reling befestigte Schilderreihen die Feinde mit Fernwaffen unter Beschuss nehmen konnten. Gesteuert wurde das antike Kampffahrzeug vom Heck aus mithilfe von zwei Steuerrudern, die sich ebenfalls jeweils back- und steuerbords befanden. Die Länge der Bireme betrug nach Schätzungen 30 Meter, der Tiefgang zwei, die Breite höchstwahrscheinlich fünf bis sechs Meter.
Zur damaligen Zeit war die Bireme ein furchtbarer Gegner für jedes Piratenschiff, zumal die phönizischen Seeleute für ihre Geschicklichkeit und die assyrischen Soldaten wegen ihrer Tapferkeit gefürchtet waren.
Mithilfe einer derartig starken Flotte gelang es den Assyrern, das Rote Meer von Piraten zu säubern. Indes, Sargon II. wie auch sein Sohn Sanherib waren zu kriegerisch, als dass ihnen ein langes Leben beschieden gewesen wäre. Beide fanden ein gewaltsames Ende, Sargon fiel im Jahr 705 v. Chr. gegen die Kimmerer, Sanherib 25 Jahre später durch den Mordstahl seiner Söhne. Wieder entstand ein Machtvakuum, erneut wurde der Seehandel vermutlich zum Freiwild raubgieriger Piratenvölker.
Für ein weiteres Jahrhundert erfahren wir kaum etwas über Raubzüge zur See sowie deren Ahndung. Wahrscheinlich liegt dies am Umstand, dass der organisierte Kampf gegen Seeräuber auf der Rechtsauffassung beruht, dass Piraterie überhaupt ein Verbrechen ist. Diese Ansicht setzte sich in der Antike erst spät durch, genauso wie der Begriff »Peirates«, den heute jeder in seiner latinisierten Form »Pirat« kennt. Die Bezeichnung fand erst ab dem dritten vorchristlichen Jahrhundert Verwendung und leitet sich vom griechischen Wort πειραν (peiran), »versuchen, unternehmen, auskundschaften«, und πεĩρα (peira), »Wagnis, Unternehmen, Überfall«, über πειρατής (peiratēs) ab.
Doch so schnell setzte sich der Piratenbegriff nicht durch. Noch bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. bezeichnete man im griechischen Kosmos die Seeräuber als »Leistes«, als »Plünderer« beziehungsweise »bewaffnete Räuber«. Dies weist eindeutig darauf hin, dass damalige Piraterie wie schon all die Jahrhunderte zuvor dem Küstenraub huldigte.
»Die alten Hellenen ... hatten kaum damit begonnen, mit Schiffen häufiger zueinander hinüberzufahren, als sie sich auch schon auf den Seeraub verlegten, wobei gerade die tüchtigsten Männer sie anführten, zu eignem Gewinn und um Nahrung für die Schwachen; sie überfielen unbeteiligte Städte und offene Siedlungen und lebten so fast ganz vom Raub. Dies Werk brachte noch keine Schande, eher sogar Ruhm.« 9
Angesichts solcher Rechtsauffassung wundert es nicht, wenig von Piratenjägern und Strafexpeditionen zu hören. Erst ab dem 6. vorchristlichen Jahrhundert blitzen Glanzlichter der Piratenjagd auf. Als die griechische Kolonisation im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. ihre maximale Ausdehnung erreichte, veränderte sich langsam die Auffassung der Griechen von Piraterie. Gezwungen, ihren Seehandel zu verteidigen, ging insbesondere das aufblühende Athen ab dem 6. Jahrhundert gegen Piratenstützpunkte auf Limnos, Kythnos, Mykonos und den Sporaden vor.
Etwa zur selben Zeit vollzog sich ebenfalls im westlichen Mittelmeer ein Wandel. Hier waren es Karthager und Etrusker, die sich von den Phokäern bedroht fühlten. Diese waren vor den Persern unter Kyros ins westliche Mittelmeer geflohen und hatten sich auf Korsika niedergelassen. Von dort aus schädigten sie den karthagisch-etruskischen Seehandel, wo sie nur konnten. Dies blieb nicht ungestraft. Um 540 v. Chr. schlugen die vereinigten Seeflotten der Karthager und Etrusker die Flotte der Phokäer vor Korsika, was eine der ersten großen Piratenplagen der Antike beendete.
Eine weitere bekannte Strafaktion ist die des athenischen Flottenführers Kimon, der in der Glanzzeit des von Athen beherrschten 1. Attisch-Delischen Seebundes um 475 v. Chr. die alte Pirateninsel Skyros eroberte und mit Athenern besiedelte.
Athen war es nicht lang vorbestimmt, als Hegemonialmacht das östliche Mittelmeer zu beherrschen. Im fast dreißigjährigen Peloponnesischen Krieg gegen Sparta und dessen Verbündete erlitt es eine entscheidende Niederlage im Kampf um die Vormacht in der Ägäis.
Um 400 v. Chr. war der 1. Attisch-Delische Seebund nur noch Geschichte. Nach der katastrophalen Niederlage der Athener auf Sizilien reckte die Piraterie erneut ihr Haupt im östlichen wie westlichen Mittelmeer.
349 v. Chr. durchzog eine griechische Seeräuberflotte sengend und mordend das westliche Mittelmeer, sodass sich die zwei rivalisierenden Großmächte Karthago und Rom dazu genötigt sahen, im darauffolgenden Jahr einen Vertrag abzuschließen. Diese vertragliche Vereinbarung regelte einerseits die karthagisch-römischen Zwistigkeiten zur See und versuchte andererseits, eine gemeinsame Richtlinie im Kampf gegen Piraten festzulegen. Dass sich mithilfe derartiger Verträge der zunehmende karthagisch-römische Gegensatz nicht aus der Welt schaffen ließ, ist bekannt. Was die Piratenbekämpfung anbetrifft, zeigt der Vertrag eindrucksvoll die Verflechtung von Seeraub, Seekrieg und Seehandel und die ambivalente Haltung der antiken Seemächte gegenüber der Piraterie.
Noch im vierten vorchristlichen Jahrhundert ist Seeraub selbstverständlich und nur ein Verbrechen, wenn Angehörige eines anderen Staates ihn betreiben. Wenn es für sie nützlich war, griffen die antiken Staaten selbst zum Mittel der Piraterie oder bedienten sich der Seeräuber.
Für Staaten ohne große Kriegsmarine hatte dies den Vorteil, sofort über eine schlagkräftige Armada zu verfügen. Für die Seeräuber rechneten sich Militärbündnisse, weil sie unter dem Deckmantel kriegerischer Operationen umso ungehinderter die feindlichen Küsten und Seefahrtswege plündern konnten. So nimmt es aus heutiger Sicht nicht wunder, dass es bei derartigen politischen Verhältnissen unmöglich war, die Seewege dauerhaft vor Piratengeschwadern zu schützen.
Überall herrschte ein Zustand kriegerischer Anarchie. Durch die zerrütteten politischen Verhältnisse traten Piraten immer selbstbewusster auf. Sie kannten keine moralischen Skrupel und zeigten das Machtbewusstsein von Kleinkönigen, wie das folgende moralische Traktat belegt, das von einer legendären Begegnung Alexanders des Großen mit einem unbekannten Seeräuberhäuptling handelt:
»Was anderes sind also Reiche, wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anderes als kleine Reiche. Auch da ist eine Schar von Menschen, die unter Befehl eines Anführers steht, sich durch Verabredung zu einer Gemeinschaft zusammenschließt und nach fester Übereinkunft die Beute teilt. Wenn dies üble Gebilde durch Zuzug verkommener Menschen so ins Große wächst, dass Ortschaften besetzt, Niederlassungen gegründet, Städte erobert, Völker unterworfen werden, nimmt es ohne Weiteres den Namen Reich an, den ihm offenkundig nicht etwa hingeschwundene Habgier, sondern erlangte Straflosigkeit erwirbt. Treffend und wahrheitsgemäß war darum die Antwort, die einst ein aufgegriffener Seeräuber Alexander dem Großen gab. Denn als der König den Mann fragte, was ihm einfalle, dass er das Meer unsicher mache, erwiderte er mit freimütigem Trotz: Und was fällt dir ein, dass du den Erdkreis unsicher machst? Freilich, weil ich’s mit einem kleinen Fahrzeug tue, heiße ich Räuber. Du tust’s mit einer großen Flotte und heißt Imperator.« 10
Читать дальше