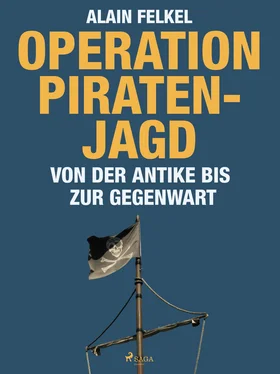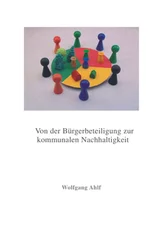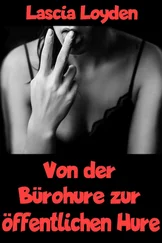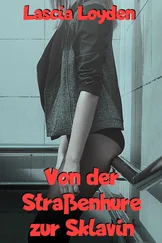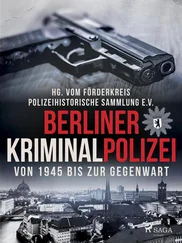Wie viele Schiffe an jenem Tag an der Seeschlacht auf dem Nil beteiligt waren, lässt sich nicht mehr in Erfahrung bringen. Auf dem Relief von Medinet Habu sind fünf Seeräuberschiffe zu sehen, die von vier ägyptischen Kampfschiffen angegriffen werden. Vermutlich handelt es sich nicht um die Gesamtzahl aller beteiligten Schiffe, sondern um eine symbolische Verdichtung der Schlacht.
Größere Gewissheit herrscht darüber, wie sich der Kampf zur See abspielte. Nachdem sich die Ägypter mit kräftigen Ruderschlägen den Seevölkerschiffen angenähert hatten, eröffneten die Bogenschützen des Pharaos den Fernkampf. Mit tödlicher Präzision jagten sie Pfeil auf Pfeil in die dicht gedrängten Massen der Feinde. Zusätzlich zum Pfeilregen deckte ein Hagel von Steinen, Wurfpfeilen und Lanzen das feindliche Raubgeschwader ein. Die Seevölker erlitten schwere Verluste. Dies nutzten die Ägypter sofort aus. Wuchtig rammten die löwenkopfverzierten Vordersteven ihrer Schiffe die flachkieligen Vogelbarken, von denen eine sofort kenterte. Dann wirbelten Enterhaken durch die Luft, und der Enterkampf begann. In einem erbarmungslosen Gemetzel gewannen die Ägypter die Oberhand. Unter dem schwankenden Mastenwald der kämpfenden Flotten färbte sich das Wasser rot vom Blut der Erschlagenen, die bald zu Dutzenden in den Fluten des Nils trieben.
Denjenigen der Seevölkerkrieger, die über Bord sprangen, um sich zum Land durchzukämpfen, erging es nicht besser. Die meisten fielen am Ufersaum des Nildeltas oder wurden gefangen genommen. Von den Oberbefehlshabern, welche die Seevölker in die Schlacht geführt hatten, überlebte keiner. Ramses III. tötete nach eigenen Angaben »denjenigen, der sich den Sieg so sehr gewünscht hatte« mit einem gezielten Pfeilschuss, während der zweite Piratenhäuptling ins Wasser fiel und ertrank.
Als die Sonne unterging, gab es keinen Zweifel mehr, wer den Sieg errungen hatte. Erbarmungslos hackten ägyptische Soldaten jedem getöteten Feind eine Hand und den Penis ab, um sie wenig später gegen Kopfgeld einem der Quartiermeister zu geben, dessen Gehilfen die schaurigen Trophäen aufschichteten. Während sich dieses grausame Ritual vollzog, marschierten endlose Reihen gefesselter Seevölkerkrieger in die Gefangenschaft.
Einigen war es bestimmt, im Tempel Amuns geopfert zu werden. Andere erlitten das Los der Sklaverei oder wurden wie die Peleset und Serden ins heutige Palästina 7umgesiedelt. Ramses III. hatte einen großen Sieg erfochten und die Seevölker zu Lande wie zu Wasser entscheidend geschlagen.
»Diejenigen nun, die meine Grenze zu Lande erreichten – ihr Same existiert nicht mehr ... diejenigen aber, die zusammengeschart herankamen vom Meer – die Glut erfüllt sich an ihnen vor den Deltamündungen. ... Diejenigen, die in die Nilmündungen eingedrungen waren, waren gefangen wie Vögel im Netz. So wurden sie vernichtet.« 8
Durch seinen Sieg auf dem Nil hatte Ramses III. den Zusammenbruch des Ägypterreiches verzögert und die Sturmwelle des Seevölkerangriffs gebrochen. In den folgenden drei Jahrzehnten bis zu Ramses’ III. Ermordung während einer Palastrevolution verzeichnen die Quellen keinen Angriff der Seevölker mehr.
Als sicher kann angenommen werden, dass der Angriff der Seevölker ein Invasionsversuch von Landstreitkräften war, der mithilfe von Piraten durchgeführt wurde, wie die Teilnahme der Tjeker, Serden und Šekeleš an der Expedition beweist.
Abgesehen von diesen ersten schweren Abwehrschlachten gegen Seeräuber sind uns kaum gezielte Piratenjagden oder Abwehrkämpfe aus der Zeitenwende von der Bronze- zur Eisenzeit bekannt. Zwar behauptet der griechische Historiker Thukydides, dass schon der mythische König Minos von Kreta die Meere von Seeräubern säuberte, doch herrscht hier große Unsicherheit, wann dies war und zu welcher Zeit der angebliche Piratenbezwinger überhaupt gelebt hat.
Einzig die griechischen Epen und Mythen erhellen jene dunkle Zeit der Raubzüge der Hellenen, die einst die Insel- und Küstenwelt der Ägäis in erschreckendem Maße verheert haben müssen.
In den Abenteuern von Jason und den Argonauten, der Ilias und der Odyssee lassen sich mannigfach Hinweise auf die Seeräubereien der griechischen Helden und ihrer treuen Gefolgsmänner finden. So erhielt Jason mit seinen Gefährten den Auftrag, das Goldene Vlies zu stehlen, bot die Entführung Helenas durch Paris den Anlass für die Zerstörung Trojas und wurde der Ursprung aller Irrfahrten des Odysseus der unglückselige Gedanke, die in Troja gemachte Beute noch durch weitere Raubzüge an Thrakiens Küste anzureichern.
In Homers Odyssee erzählt der nach Ithaka heimkehrende Odysseus dem Schweinehirten Eumaios von einer schweren Niederlage, die er als Führer hellenischer Piraten im Nildelta erlitten hat. War dies ein Nachruf auf die große Abwehrschlacht von Ramses III. auf dem Nil? Oder eine Hommage Homers an zeitgenössische, historisch verbürgte Piratenangriffe auf Ägypten?
Die Erzählung hält dies offen. Sie ist als eine der Lügenschichten getarnt, die der als Bettler verkleidete Odysseus seinem einfachen Wirt, dem er sich zunächst nicht zu erkennen gibt, als erdichtete Biografie auftischt.
Nun sind Epen und Mythen keine Tatsachenerzählung historischer Ereignisse, doch in einem zeigen sie sich hilfreich. Sie gewähren einen Blick auf die Gedankenwelten und Erfahrungshorizonte der jeweiligen Epoche, die von der Allgegenwart des Seeraubs stark geprägt war. In den griechischen Mythen spielen vor allem die Tyrrhener eine Rolle, die in grauer Vorzeit die Ägäis besiedelten. Ein Teil von ihnen – die pelasgischen Tyrrhener – wurde von den Hellenen an die unwirtlichen Küstenstreifen Nordwestkleinasiens, die Inseln der Nordägäis verdrängt, andere tyrrhenische Stämme ins westliche Mittelmeer nach Sardinien. Dies sollte den Hellenen bald zum Nachteil gereichen. Die Tyrrhener rächten sich durch zahllose Seeräubereien für die Vertreibung aus ihrer ursprünglichen Heimat und wurden so sehr zum Schrecken der Ägäis, dass bald jeder Grieche das Wort »Tyrrhener« mit »Pirat« gleichsetzte.
Ist auch wenig über ihre Raubzüge bis zum 8. Jahrhundert v. Chr. bekannt, so bewahrten doch Mythen die Erinnerung an jene grausamen Küstenräuber, die ihren Gegnern derartig überlegen waren, dass nur noch die griechische Götterwelt in der Lage war, ihren Übermut zu bändigen.
So ergeht es den Tyrrhenern sehr schlecht, als sie das Standbild der Hera aus ihrem unverschlossenen Tempel auf Samos rauben und damit fliehen wollen. Göttlicher Frevel hält das Schiff im Hafen fest, so sehr sich die Piraten auch in die Riemen legen, um den Hafen zu verlassen. Die Tyrrhener verzweifeln. Erst als sie begreifen, dass sie zu weit gegangen sind, tragen sie das Götterbild ans Ufer, opfern Hera eifrig und können so den Hafen wieder verlassen. Aber ein Götzenbild zu rauben ist eine Sache, einen Gott zu stehlen eine andere, womit wir beim zweiten blasphemischen Schurkenstreich der Tyrrhener wären, den Homer in seinen Hymnen ins Gewand des Mythos gekleidet hat. Unbelehrbare Plünderer, die sie sind, scheuen die Tyrrhener nicht davor zurück, während einer Razzia den Fruchtbarkeitsgott Dionysos am Strand zu rauben. Trotz seiner Beteuerung, ein Gott zu sein, verschleppen sie Dionysos und werfen ihn in Banden geschlagen in ihr Schiff. Doch kaum ist die frevelhafte Tat begangen, folgt die Strafe auf dem Fuß. Der Geraubte wirft die Fesselung ab und beschwört mit Götterkraft einen Sturm herauf, der das Schiff der Seeräuber in Seenot bringt. Als die Tyrrhener ihren Irrtum bemerken, bieten sie Dionysos vergeblich die Freiheit an. In Gestalt eines Löwen verwandelt er erzürnt die Piraten in Delfine und verdammt sie dazu, bis ans Ende ihrer Tage im Meer zu schwimmen.
Woanders brauchte es keine Götter, um Piraten zu bestrafen. Im 8. Jahrhundert v. Chr. suchte die Flotte des Assyrerherrschers Sargon II. die Meereswogen des Mittelmeeres und des Persischen Golfes nach Piraten ab und sorgte so für die Sicherheit zur See. Die Schiffe Sargons II. waren für die Verhältnisse der damaligen Zeit bestens gerüstet zur Piratenjagd. Eine Steinplatte des verfallenen Königspalasts von Nimrud hat die Erinnerung an die Flotte der Assyrer bewahrt, deren Mannschaften hauptsächlich aus Phöniziern bestanden.
Читать дальше