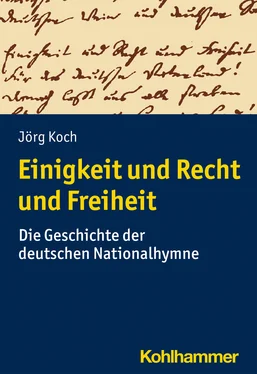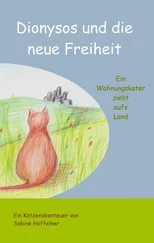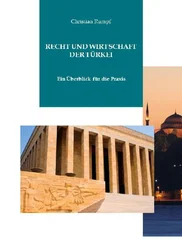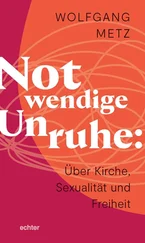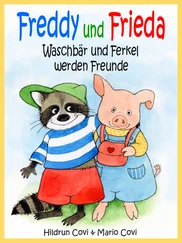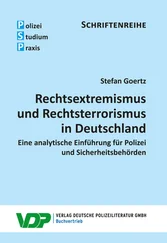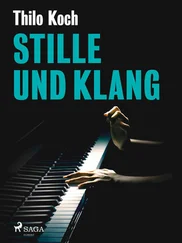Sogar in dem US-amerikanischen Filmklassiker »Casablanca« (1942) mit Humphrey Bogart (1899–1957) und Ingrid Bergman (1915–1982) ist das Lied zu hören: Nachdem die deutschen Offiziere in »Ricks Bar« die »Wacht am Rhein« angestimmt haben, animiert der Protagonist die Kapelle dazu, die Marseillaise zu spielen. Die anderen Gäste stimmen ein und übertönen die »Wacht am Rhein« voller Enthusiasmus. Bei dieser direkten Gegenüberstellung merkt man, wie sich beide marschartigen Melodien ähneln. Auch in anderen Literaturverfilmungen, die im Kaiserreich angesiedelt sind, ist das Lied auszugsweise zu vernehmen, etwa in »Im Westen nichts Neues« (1930, 1979) nach dem Roman von Erich Maria Remarque (1898–1970) oder in der Serie »Berlin Alexanderplatz« (1980) von Rainer Werner Fassbinder (1945–1982). Ferner gehört es zur bemerkenswerten musikalischen Untermalung der Schlussszene des Films »Der Untertan« (DDR, 1951): Bei Enthüllung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals im Sturm und Gewitterregen erklingen Melodiefetzen der »Wacht am Rhein«, des »Horst-Wessel-Liedes« und der Sondermeldungsfanfare des Großdeutschen Rundfunks; damit blickt die Szenerie – im Gegensatz zur Romanvorlage von Heinrich Mann (1871–1950) – auch auf den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg.
Im Rückblick von 150 Jahren interpretierte der Autor Jörg von Uthmann (geb. 1936) die »Wacht am Rhein« auf seine Art: 8 8 Jörg von Uthmann: Poetische Frucht einer Nahostkrise in: Marcel Reich-Ranicki (Hg.): 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen, Frankfurt 1994, Bd. 4, S. 381 f.
»Wie sich die Zeiten ändern! Wenn heute vom Rhein die Rede ist, denkt jeder sofort an Chlorbenzol und tote Fische. Vor hundertfünfzig Jahren sang das deutsche Volk mit dem Bonner Geschichtsschreiber Nikolaus Becker ›Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein!‹ Sie – das war nicht die chemische Industrie, das waren die Franzosen. Auf dem Wiener Kongress hatte Frankreich seine linksrheinischen Eroberungen herausgeben müssen. Wirklich abgefunden mit dem Verlust hatte es sich jedoch nicht. 1840, nach einer schweren diplomatischen Schlappe im Nahen Osten, suchte Premierminister Thiers die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abzulenken. Er verlangte die Rheingrenze und war bereit, dafür in den Krieg zu ziehen. Zwar blitzte er bei seinem friedfertigen König Louis Philippe ab und musste zurücktreten. Aber das Unglück war geschehen: Die alte Wunde begann wieder zu bluten.
Während die Pariser Presse in schrillen Tönen nach einer Revision des schmachvollen Friedens schrie, machten sich in Deutschland die Dichter ans Werk. Eine unvorstellbare Massenproduktion vaterländischer Lyrik setzte ein. Beckers Rheinlied war nur das bekannteste; es wurde nicht weniger als hundertmal in Musik gesetzt. Der Germanistik-Professor Hoffmann von Fallersleben unterlegte der alten Kaiserhymne einen neuen Text – das Deutschlandlied. Derweil beschloss man in Köln, am Dom – dem Symbol der unvollendeten deutschen Einheit – die im Mittelalter unterbrochenen Bauarbeiten wiederaufzunehmen. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. legte den Grundstein und hielt dabei eine antifranzösische Rede.
In diesem überhitzten Klima wollte auch der schwäbische Hütteningenieur Max Schneckenburger nicht zurückstehen. In einer Eisengießerei im fernen Bern küsste ihn die patriotische Muse. Er griff zur Feder und brachte ›Die Wacht am Rhein‹ zu Papier […].
Im Krieg 1870/71 stieg ›Die Wacht am Rhein‹ zur inoffiziellen deutschen Nationalhymne auf und blieb es bis zum Ende des Kaiserreichs. Sie zur offiziellen deutschen Nationalhymne zu erheben, zögerte der Berliner Hof, da – wie ›Meyers Großes Konversationslexikon‹ von 1908 feinsinnig anmerkt – ›dieselbe wegen ihrer antifranzösischen Spitze nicht bedingungslos für die internationale Repräsentation geeignet‹ schien. Mit dem amtlichen Liedgut hatten die Deutschen, wie man sieht, schon damals ihre Not […]«.
1S. Victor Hugo: Rheinreise, Frankfurt/M. 1982, S. 301 f. (Nachwort von Friedrich Wolfzettel). Heutige, gekürzte Ausgaben der »Rheinreise« verzichten i. d. R. auf die Veröffentlichung derartiger Äußerungen Hugos.
2Zit. nach Franz Josef Ewens (Hg.): Das Deutsche Sängerbuch. Wesen und Wirken des Deutschen Sängerbundes in Vergangenheit und Gegenwart, Dortmund 1930, S. 28 f.
3S. Georg Scherer/Franz Lipperheide (Hg.): Die Wacht am Rhein. Das deutsche Volks- und Soldatenlied des Jahres 1870, Berlin 1871.
4Abgedruckt in: Max Kegel (Hg.): Sozialdemokratisches Liederbuch, 5. Auflage, Stuttgart 1896, S. 41.
5Kommission des Demokratischen Vereins in München (Hg.): Demokratisches Liederbuch zum Gebrauch der Volksvereine, Stuttgart 1898, S. 15.
6Unsere Feldgrauen. Marsch- und Lagerlieder, Leipzig 1914, (Geleitwort) o. S.
7Adolf Hitler: Mein Kampf, München 1933, S. 180.
8Jörg von Uthmann: Poetische Frucht einer Nahostkrise in: Marcel Reich-Ranicki (Hg.): 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen, Frankfurt 1994, Bd. 4, S. 381 f.
3
Das Lied der Deutschen« – Inhalt und Bedeutung
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält;
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt:
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt!
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang:
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand;
Blüh im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!
Die beiden ersten Zeilen des »Deutschlandliedes« gehören zu den bekanntesten Versen überhaupt. Oft zitiert, gesungen, gegrölt, inhaltlich missbraucht und missverstanden, sind sie nicht im Sinne eines chauvinistischen Herrschaftsanspruchs anderen Staaten gegenüber zu verstehen. Auch sie spiegeln den Geist der Zeit, insbesondere die Gesinnung ihres Verfassers wider. August Heinrich Hoffmann fordert als verbindende Klammer ein Deutschland über viele deutsche Länder hinweg, also die Einheit und das Ende der Partikularstaaten. Denn nur ein geeintes, mächtiges Deutschland könne die Gebietsansprüche Frankreichs zurückweisen. Im Gegensatz zu anderen Rheinliedern jedoch erwähnt der Verfasser in seinem Lied weder den Rhein noch Frankreich. Vielmehr nennt er in seiner ersten Strophe vier Flüsse, die die Grenzen dieses neuen Deutschlands markieren. Alle vier Gewässer liegen außerhalb der deutschen Grenzen von 1937, doch damals entsprachen sie im Wesentlichen den allseits akzeptierten Grenzen des Deutschen Bundes:
Die rund 875 Kilometer lange Maas, die in Frankreich entspringt, Belgien und die Niederlande durchfließt, bevor sie in das Rhein-Maas-Delta mündet, bildet die Grenze zwischen den Provinzen Belgisch-Limburg und Niederländisch-Limburg. Aufgrund einer neuen Gebietsregelung im Jahr 1839 (»Londoner Protokoll«) fiel der niederländische Teil von Limburg an den Deutschen Bund, damit war die Maas die westliche Grenzmarkierung des Staatenbundes. Daran hat sich bis heute kaum etwas verändert; die Maas nähert sich in ihrem Lauf der deutschen Grenze bei Kaldenkirchen (Nordrhein-Westfalen) auf rund fünf Kilometer.
Die rund 940 Kilometer lange Memel entspringt in Weißrussland und zieht sich durch Litauen, wo sie ins Kurische Haff (Ostsee) mündet. Die Hafenstadt Memel (Klaipeda) war bis 1920 die nördlichste Stadt Deutschlands. Zwar gehörte Ostpreußen nicht dem Deutschen Bund an, doch weil im Memelgebiet Deutsche lebten, bzw. Kaschuben, Polen und Masuren, die als Preußen geführt wurden, vielerorts dort auch deutsch gesprochen wurde und überdies das preußische Königspaar Friedrich Wilhelm III. (1770–1840) und Luise (1776–1810) während der napoleonischen Herrschaft hier Zuflucht gefunden hatte, galt den Zeitgenossen diese Gegend als deutsch. Die Memel als östlicher Grenzfluss war zwar problematisch, doch ganz abwegig war diese Markierung nicht.
Читать дальше