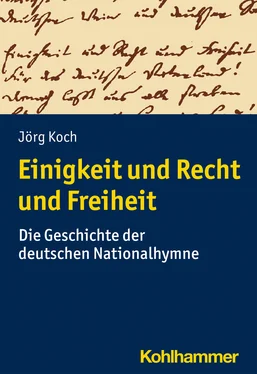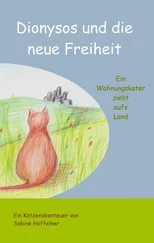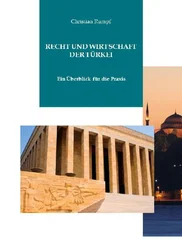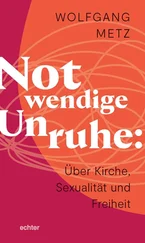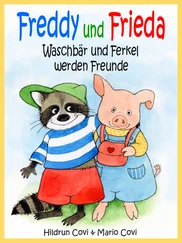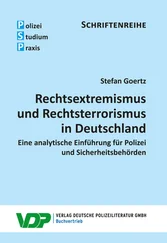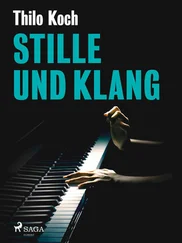»Sie haben durch die Komposition von Max Schneckenburgers Gedicht ›Die Wacht am Rhein‹ dem deutschen Volke ein Lied gegeben, welches mit der Geschichte des eben beendeten, großen Krieges untrennbar verwachsen ist. Entstanden zu einer Zeit, wo die deutschen Rheinlande in ähnlicher Weise wie vor einem Jahre von Frankreich bedroht schienen, hat ›Die Wacht am Rhein‹ ein Menschenalter später, als die Drohung sich verwirklichte, in der begeisterten Entschlossenheit, mit welcher unser Volk den ihm aufgedrungenen Kampf aufgenommen und bestanden hat, ihren vollen Anklang gefunden. Ihr Verdienst, Herr Musikdirektor, ist es, unserer letzten großen Erhebung die Volksweise gefunden zu haben, welche daheim, wie im Felde dem nationalen Gemeingefühle zum Ausdruck gedient hat. Ich folge mit Vergnügen einer mir von dem Geschäftsführenden Ausschuss des Deutschen Sängerbundes gewordenen Anregung, indem ich der Anerkennung, welche Ihnen von allen Seiten zu Teil geworden ist, auch dadurch Ausdruck gebe, dass ich Sie bitte, die Summe von Eintausend Talern aus dem Dispositionsfonds des Reichskanzleramtes anzunehmen. Ich hoffe, dass es mir möglich sein wird, Ihnen alljährlich den gleichen Betrag anbieten zu können. Die Reichshauptkasse ist angewiesen, Ihnen die für das laufende Jahr bestimmte Summe alsbald gegen Quittung auszuzahlen.
Der Reichskanzler – Bismarck«
Den geschichtlichen Hintergrund – die »Rheinkrise« von 1840 zwischen Frankreich und dem Deutschen Bund, hier nur kurz angerissen – muss man kennen, um die Bedeutung dieser Lieder zu verstehen. In demselben Kontext nämlich entstand das »Lied der Deutschen« von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874).
Verbreitung fanden diese nationalistisch-patriotischen Lieder zunächst vor allem über Kommersliederbücher der Burschen-, Studenten- und Turnerschaften, schon bald gehörten sie zum Repertoire von Männerchören. Nicht immer war der Originaltext abgedruckt, die Bearbeiter und Komponisten erlaubten sich gelegentlich Variationen. »Die Wacht am Rhein« war Gegenstand des Musik- und Deutschunterrichts, an altsprachlichen Gymnasien wurde sie sogar ins Lateinische, Altgriechische und Hebräische übersetzt. 3 3 S. Georg Scherer/Franz Lipperheide (Hg.): Die Wacht am Rhein. Das deutsche Volks- und Soldatenlied des Jahres 1870, Berlin 1871. 4 Abgedruckt in: Max Kegel (Hg.): Sozialdemokratisches Liederbuch, 5. Auflage, Stuttgart 1896, S. 41. 5 Kommission des Demokratischen Vereins in München (Hg.): Demokratisches Liederbuch zum Gebrauch der Volksvereine, Stuttgart 1898, S. 15. 6 Unsere Feldgrauen. Marsch- und Lagerlieder, Leipzig 1914, (Geleitwort) o. S. 7 Adolf Hitler: Mein Kampf, München 1933, S. 180. 8 Jörg von Uthmann: Poetische Frucht einer Nahostkrise in: Marcel Reich-Ranicki (Hg.): 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen, Frankfurt 1994, Bd. 4, S. 381 f.
Das Lied war allgegenwärtig, im häuslichen Umfeld und in Kneipen und bei vielen anderen Anlässen wurde es gesungen, es erklang aus Spieldosen und Musikautomaten und bei Volksfesten aus der Drehorgel. Sogar Wirtshäuser und Hotels gaben sich diesen Namen. Das Lied wurde so oft geträllert und geleiert, dass es manchmal schon nicht mehr zu hören war. Der Widerwille gegenüber der Omnipräsenz äußerte sich auch in parodistischen Umdichtungen, z. B.: 4 4 Abgedruckt in: Max Kegel (Hg.): Sozialdemokratisches Liederbuch, 5. Auflage, Stuttgart 1896, S. 41. 5 Kommission des Demokratischen Vereins in München (Hg.): Demokratisches Liederbuch zum Gebrauch der Volksvereine, Stuttgart 1898, S. 15. 6 Unsere Feldgrauen. Marsch- und Lagerlieder, Leipzig 1914, (Geleitwort) o. S. 7 Adolf Hitler: Mein Kampf, München 1933, S. 180. 8 Jörg von Uthmann: Poetische Frucht einer Nahostkrise in: Marcel Reich-Ranicki (Hg.): 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen, Frankfurt 1994, Bd. 4, S. 381 f.
Die Wacht am Rhein,
das ist der Titel des Liedes,
das im Schwange geht.
Es ist ein ganz probates Mittel
für einen, der sonst nichts versteht.
Darum, bei Mond und Sonnenschein
sing ich nur stets die Wacht am Rhein,
die Wi-Wa-Wacht am Rhein, die Wacht am Rhein.
Eine weitere Neuschöpfung in drei Strophen erschien unter dem Titel »Die Freiheitswacht«: 5 5 Kommission des Demokratischen Vereins in München (Hg.): Demokratisches Liederbuch zum Gebrauch der Volksvereine, Stuttgart 1898, S. 15. 6 Unsere Feldgrauen. Marsch- und Lagerlieder, Leipzig 1914, (Geleitwort) o. S. 7 Adolf Hitler: Mein Kampf, München 1933, S. 180. 8 Jörg von Uthmann: Poetische Frucht einer Nahostkrise in: Marcel Reich-Ranicki (Hg.): 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen, Frankfurt 1994, Bd. 4, S. 381 f.
Es geht durchs Land ein Schrei der Not:
Des Volkes Freiheit ist bedroht.
Viel dunkle Raben fliegen schon
und krächzen laut: Reaktion!
D’rum deutsches Volk, sei auf der Hut,
schirm’ fest und treu dein höchstes Gut,
d’rum deutsches Volk, mein Volk, sei auf der Hut,
schirm’ fest und treu, ja treu dein höchstes Gut …
Lieder dienen der Identifikation, der Verständigung, der Gemeinschaftsbildung, mit ihnen grenzt man sich von anderen ab. Diese Funktion übernahmen im Ersten Weltkrieg das »Lied der Deutschen«, ebenso die »Wacht am Rhein«, wie folgende Aussagen belegen. Danach allerdings, mit dem Ende des Kaiserreichs, hatte die »Wacht« weitgehend ausgedient.
Aus dem Vorwort zum Liederbuch »Unsere Feldgrauen. Marsch- und Lagerlieder«, 1914: 6 6 Unsere Feldgrauen. Marsch- und Lagerlieder, Leipzig 1914, (Geleitwort) o. S. 7 Adolf Hitler: Mein Kampf, München 1933, S. 180. 8 Jörg von Uthmann: Poetische Frucht einer Nahostkrise in: Marcel Reich-Ranicki (Hg.): 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen, Frankfurt 1994, Bd. 4, S. 381 f.
»Mit dem ersten Tag der Mobilmachung war ›Die Wacht am Rhein‹ wieder mit einem Male in aller Munde. Unter ihren trotzigen, siegesgewissen Klängen sind unsere Krieger blumengeschmückt aus der Heimat ins Feld gezogen; in dröhnendem Takte sind sie mit diesem stolzen Sang in die feindlichen Städte eingezogen […]. Wie sich unsere Feldgrauen da draußen mit einem munteren Sang über die harten Anstrengungen der Märsche hinweghalfen, sich die kurzen Stunden der Rast am Lagerfeuer verschönern, so wollen auch wir daheim nicht stumm bleiben und in den Gesang unserer Lieben im Felde froh und zuversichtlich miteinstimmen.«
Auch Adolf Hitler (1889–1945) erinnerte sich rückblickend an die »Wacht am Rhein«, als er im Herbst 1914 mit dem Truppenzug auf dem Weg zum »beginnenden Heldenkampf« an der Westfront durch Bingen kam und die »Germania« erblickte: 7 7 Adolf Hitler: Mein Kampf, München 1933, S. 180. 8 Jörg von Uthmann: Poetische Frucht einer Nahostkrise in: Marcel Reich-Ranicki (Hg.): 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen, Frankfurt 1994, Bd. 4, S. 381 f.
»Und so kam endlich der Tag, an dem wir München verließen, um anzutreten zur Erfüllung unserer Pflicht. Zum ersten Male sah ich so den Rhein, als wir an seinen stillen Wellen entlang dem Westen entgegenfuhren, um ihn, den deutschen Strom der Ströme zu schirmen vor der Habgier des alten Feindes. Als durch den zarten Schleier des Frühnebels die milden Strahlen der ersten Sonne das Niederwalddenkmal auf uns herabschimmern ließen, da brauste aus dem endlos langen Transportzuge die alte Wacht am Rhein in den Morgenhimmel hinaus, und mir wollte die Brust zu eng werden.«
Rund 25 Jahre später, zu Beginn des Westfeldzugs (Mai 1940), leitete der Großdeutsche Rundfunk die Sondermeldungen über die militärischen Erfolge der Wehrmacht in Frankreich mit der charakteristischen »Frankreichfanfare« ein; die ersten acht Töne entsprachen der »Wacht am Rhein«. Ein Jahr später trat an ihre Stelle die »Russlandfanfare«. Doch ganz ausgedient hatte der bekannte Titel nicht; im Dezember 1944 verwendete die Wehrmacht die vier eingängigen Wörter als Decknamen für die Ardennenoffensive.
Читать дальше