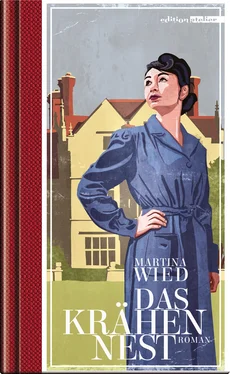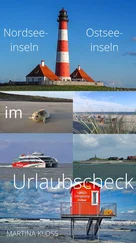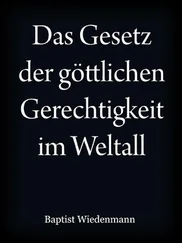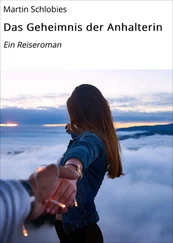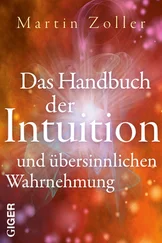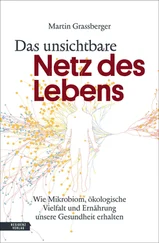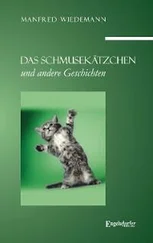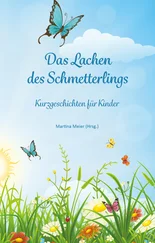Madeleine ist zurück im »Krähennest«.
Das Herannahen der Trimestermitte bringt viel Bewegung, Unruhe und Aufregung in die Télème-Abtei. Es wird, überliefertem Brauch folgend, von mehreren Lehrern und den musikalischen unter den älteren Zöglingen unter Basilios Leitung eine Operette im Konzertstil aufgeführt, ohne Kostüme und Bühnenbilder. Außerdem werden die Mittelschüler aus eigenem ein Theaterstück in Szene setzen, ausstatten und spielen. Dekorationen, Kostüme, Kulissen, alles hausgemacht, auch die kleine Komödie selbst, es bleibt alles in der »Enklave Dorrit« beschlossen. Frau Dorrits Drama ist ein wenig heiteres, wenig kindliches Stück, es läßt sowohl vom künstlerischen wie vom erziehlichen Standpunkt aus einigen Zweifel zu, ob es für Darsteller und Zuschauer richtig gewählt ist.
In Lysanders Werkstatt, die gleichfalls in den Stallungen untergebracht ist, geht es hämmernd, sägend, klopfend, bosselnd lebhaft und geräuschvoll zu, Schwaden vielsträhniger, verknäuelter Gerüche dringen von dorther in Madeleines Stube, am nächsten und anhaltendsten der Schweißgeruch des Leims, welcher in schwarzen Eisentöpfen auf dem kleinen Gasherd in der benachbarten Küche siedet. Auf dem großen Tisch liegen Papiermachémasken und die Gipsmodelle dazu von Löwe und Jaguar, Puma, Schakal, Tiger, Panther und Hyäne, so naturgetreu, daß die kleinen Künstler, welche sie bei einer Aufführung der Juniorenschule tragen sollen, angesichts ihrer eigenen Werke von einem Gruseln erfaßt werden. Daneben gibt’s noch Kulissenteile, Entwürfe für einen Urwaldhintergrund, alles riecht nach Farbe, Firnis, Kleister, Lack und Stoffen, nach Holz und heißem Eisen, hauptsächlich aber nach Leim.
Empfindlicher noch als ihr Geruchsinn wird Madeleines Gehör von den Festvorbereitungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Theatersaal ist nur durch einen querlaufenden Gang von der Küche getrennt, er liegt genau unterhalb des Französischen Zimmers, die Stallungen sind nicht sehr solid gebaut. Madeleine kann sowohl in ihrer Stube wie während der Unterrichtsstunden unsichtbar den Proben beiwohnen, lange vor der Aufführung bereits weiß sie alle eingänglichen Nummern auswendig, denn die Mitwirkenden singen, pfeifen, trällern, grölen Fragmente daraus, wo immer sie sich gerade aufhalten, am liebsten und ausdauerndsten in Madeleines Küche.
»Ich habe die Bücher, die Sie mir zu leihen so gütig waren, gnädige Frau«, sagt Werther, ein Berliner Flüchtling, jetzt Lehrstudent im ›Krähennest‹, »in Ihre Küche gelegt.«
»In meine Küche, Werther? Welche Übertreibung! Es ist Lysanders und Hermias Küche, Arthurs Küche, Taminos, Diegos und Benedikts Küche, vor allem aber Paulinens Küche, die vormittags gleich ihren ganzen Kindergarten herüberbringt, das gibt für den Tag aus, nachts aber kommen Taminos Gäste über den Hof herüber, Tristans Gäste die Treppe herunter, um sich die Hände zu waschen, Kaffee zu kochen, Brot zu rösten, Liedchen zu pfeifen und Dialoge zu sprechen, heut’ zum Beispiel hat es bis drei Uhr morgens hier rumort …«
»Welche Schule!«, ruft Werther, in einem Seufzer seine Teilnahme für Madeleine ausdrückend. »Was für eine Hexensuppe brodelt denn dort? Wahrlich, ein giftiger Geruch.«
»Das ist eine von Imogens Blusen, die, zu ihrer Augenfarbe abgestimmt, auf Blau umgefärbt wird, für die Theateraufführung, versteht sich.«
»Und wem gehört der Leimtopf, der entschieden noch besser riecht? Lysandern, läßt sich vermuten?«
»Ausnahmsweise ist es nicht der seinige, der hier wurde von Arthur aufgestellt, den die drohenden Festlichkeiten aus seiner Gleichgültigkeit aufgerüttelt haben, er hilft bei den Dekorationen mit.«
»Da sie Imogen zu hintergründen bestimmt sind, ist das erklärlich.«
Imogen, das schöne blauäugige Mädchen, das Arthur ein so schweres Leben bereitet, hat in Frau Dorrits kleinem Stück die Hauptrolle übernommen. Liegt darin vielleicht besondere Absicht? Wollte Frau Dorrit der holdselig dreinschauenden Imogen Gelegenheit geben, ihr zänkisches, boshaftes, an anderer Menschen Qual sich weidendes Wesen auf der Szene rückhaltslos zu offenbaren, um dergestalt den Sohn ihrer Dienstgeber von seiner Verblendung zu heilen? Oder hat die Autorin die Rolle, ohne auch nur an Arthur zu denken, jener unter ihren Schülerinnen zugeteilt, die dafür die passendsten natürlichen Gaben mitbringt? Vielleicht auch hatte sie, während sie an dem Stück schrieb, Imogen unbewußt vor Augen gehabt –, wie immer, Frau Dorrit möchte niemanden anderen in diesem Part sehen.
Auch wäre es, sollte man glauben, vom erziehlichen Standpunkt aus geraten, Imogen zu beschäftigen, abzulenken, in Atem zu halten, sie braucht es. Wären jene, in deren Obhut sie gegeben ist, bessere Seelenkenner, sie hätten längst heraus, daß Imogens Sprunghaftigkeit, ihre Reizbarkeit, ihre Launen recht bedenkliche Ursachen haben mögen; darüber indessen scheint sich im »Krähennest« niemand Sorgen zu machen. Hermione zum Beispiel, die doch aus naheliegenden Gründen an Imogen ein gewisses Interesse gefaßt haben müßte, zerbricht sich nicht den Kopf über die Herzenssachen ihrer Zöglinge. Das paarte sich lächelnd, das trennte sich tränenlos, selten nur überdauerte eine solche Vorfrühlingsneigung die Jahreszeit, in welcher sie emporgekeimt war, man konnte recht gut von Lorenzos Weihnachtsliebe, Bassanios Osterbegeisterung, von Beatricens Pfingstleidenschaft sprechen. Arthur aber, dieser Sonderling, hat seinen Geschmack seit zwei Jahren nicht geändert, er scheint sein Gefühl dauerhaft an diese blauäugige künftige Xanthippe gewendet zu haben.
Was ist nun dagegen zu tun? Sollte man Imogen loszuwerden trachten? Das wäre unklug, weil man sich mit der mächtigen Persönlichkeit, die gegenwärtig bei ihrer Mutter Gattenstelle vertritt, gut verhalten muß, auch gibt Imogen eigentlich keinen Anlaß zu solcher Maßregel, sie beträgt sich Lehrern und Pflegerinnen gegenüber durchaus manierlich; was an Groll, Ärger, Unduldsamkeit in ihr quälgeistert, läßt sie einzig an Kameraden und Kameradinnen aus, mit größter Vorliebe namentlich an Arthur. Es geschieht ihm ganz recht: Warum ist er töricht genug, es sich gefallen zu lassen? Seine Kälte würde Imogen sehr schnell umgewandelt haben. Arthur aber, gleichgültig gegenüber den meisten Lebensfragen, seinen Eltern, seiner Schwester, seinen Kollegen, vor allem aber seinem Schulfortgang, seinen Noten, seiner »Beschreibung«, seinen Prüfungsaussichten gegenüber, dehnt diese Teilnahmslosigkeit nicht auf Imogen aus. Alles, was sie betrifft, ist ihm äußerst wichtig. Imogen ist reizend, sie kann bisweilen witzig und schlagfertig sein, sie hat Ideen und Einfälle – und sie ist unglücklich. Sie ist ein losgelöstes Blatt im Wind, kein Zweig, an dem sie haftete, keine Erde, worin sie wurzelte, nirgends ist sie daheim, niemanden hat sie, der ihr wahrhaft anhinge, den es bekümmerte, wenn lmogen blaß ist – hat sie vielleicht schlecht geschlafen? – oder wenn ihre Wangen sich allzusehr röten, weil sie leicht fiebert; keinen, der in ihren Gaben Fingerzeige für einen künftigen Beruf sähe, und in ihrer Unausgeglichenheit einen Anlaß, der Ursache nachzuforschen. Imogen wird in ein paar Wochen fünfzehn: Hängt ihre Reizbarkeit nur mit ihrem schwierigen Lebensalter zusammen, ihre Bitterkeit mit ihrer Ausgesetztheit?
Arthur findet, man zeige im »Krähennest« recht wenig Mitmenschlichkeit – bränge wenig Teilnahme für Imogen auf. Die beiden Dorrits, unstreitig am nächsten befugt und verpflichtet, sich ihrer anzunehmen, sind tüchtige, rührige Lehrer, allzu tüchtig, allzu rührig, findet Arthur sogar, doch es steckt wenig Gemüt dahinter. Sie haben, auf Sozialistenart, für ihre Schüler ein Schema aufgestellt, haben sie in Schubladen verteilt und jede mit Nummer, Namen und Datum versehen, sie sind noch nicht daraufgekommen, daß Imogen in keine Schublade paßt, in keiner Rubrik, samt Querstrich, Zahlen und Buchstaben, unterzubringen ist: ein Geschöpf für sich, getrieben, weglos, führerlos – und unwillig, sich führen, sich helfen zu lassen.
Читать дальше