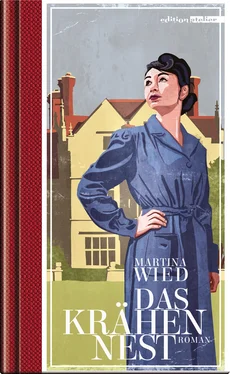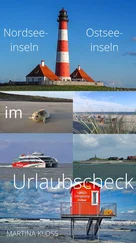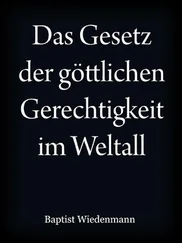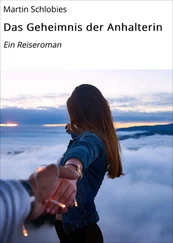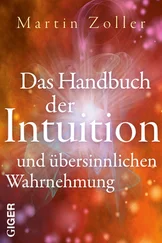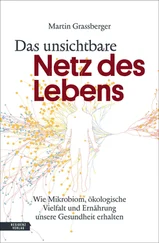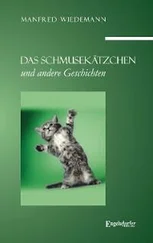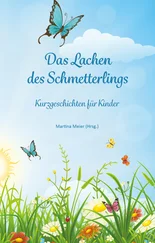Nachzügler kommen, zwei, die nicht darnach aussehen, als schritten sie ihrem Luftschloß entgegen. Auf den ersten Blick dünken sie Madeleine ganz fremd, da sie näherkommen, erkennt sie in dem Burschen den jungen Arthur. So verwandelt sieht er aus, daß ihn zu verkennen begreiflich wird. Sonst blickt er gelangweilt, hochmütig und abwesend über jeden, der ihn anspricht, hinweg – oder durch ihn hindurch, jetzt sieht er zerknirscht und unglücklich drein, verbittert und gekränkt. Leise, unhörbar sogar auf die geringste Entfernung hin, sagt er etwas zu seiner Begleiterin, faßt mit seiner herabhängnden rechten Hand nach ihrer schlaff niederhängenden Linken, sie zuckt zurück, runzelt über ihren gewitterblauen Augen die braunen Brauen, ihr reizendes Gesicht ist verkniffen und verzerrt, noch leiser und zugleich zischend gibt sie ihm etwas Ununterscheidbares zur Antwort, da erblickt sie just Madeleine – und hat im Nu ihre Gesichtszüge geordnet und besänftigt, es ist jetzt ein außerordentlich hübsches, glattes Jungmädchenantlitz, das nämliche, welches Madeleine viermal wöchentlich im Französischen Zimmer vor sich hat.
Den Lehrern in der Télème-Abtei wird nicht das anderwärts übliche Klassenbuch mit Namensregister zur Verfügung gestellt, dadurch verlangsamt sich das Kennenlernen der Schüler, ohne solche sichtbare Beihilfe kann man in wenigen Wochen nicht gut hundertachtzig Namen auswendig behalten und mit den dazugehörigen Physiognomien bekleiden. Madeleine ist beinahe stolz darauf, daß sie Bassanio nicht länger mit seinem Doppelgänger Benedikt, Laertes nicht mehr mit Malcolm, und Romeo nicht mehr mit Florizel verwechselt, der Madeleines Gedächtnis übrigens durch sein Stottern freundlich unterstützt. Es wäre indessen solcher Irrtum verzeihlich, denn jedes Gesicht, jede Gestalt scheint im »Krähennest« zwiefach aufzutauchen: Nur die Kleine mit den schönen dunkelblauen Augen unter gewitternden Brauen – an deren Namen Madeleine sich nicht zu erinnern vermag – und Arthur mit dem aufrechtstehenden flammenden Schopf halten sich einsam abseits, einzig in ihrer Eigenart und unverwechselbar.
II
Madeleine sitzt zu Häupten eines langen Tisches im kleinen Speisesaal vor drei großen Schüsseln aus Emailblech, woraus sie zehn Teller der Reihe nach zu füllen hat, und gewahrt erstaunten Seitenblicks, daß auf dem Platz zu ihrer Linken, der durch ein gekreuztes Besteck bislang freigehalten wurde, verspätet wie immer, Arthur sich niederläßt. Als sie endlich ihre übernommene Hausfrauenpflicht abgeleistet hat und sich ihrem mittlerweile ausgekühlten eigenen Teller zuwenden darf, spürt sie Arthurs Blick auf sich ruhen. Er sieht heute durchaus nicht unnahbar und abweisend aus, eher so, als wäre er einem kleinen Gespräch nicht abgeneigt; da es Samstag ist, will Madeleine gerade nach den Aussichten des Fußballwettkampfes fragen, der am Nachmittag auf den Gründen des Lavendelhofs zwischen den Krähennestlern und den Gymnasiasten des Nachbarstädtchens ausgetragen werden soll, da beginnt Arthur ganz ohne besondere Aufforderung und Anregung aus eigenem zu reden.
Dürfte er sich bei Madame Madrus vielleicht ein wenig nach der französischen Landwirtschaft erkundigen? Sie ist der unsrigen in allen Stücken doch enorm überlegen, nicht wahr?
Madeleine ist nun durchaus nicht sachverständig in Ackerbau und Viehzucht, hat aber immerhin auf dem Besitz ihrer Schwiegereltern, La Tour im Calvados, von dem sie den Namen trägt, ein bißchen zugeschaut.
»Haben Sie dort Kühe gehabt?«
»Freilich, die ›grüne Normandie‹ ist Meierei für ganz Frankreich.«
»Wie viele?«
»Es hat gewechselt. Als ich knapp nach Ende des vorigen Krieges zum erstenmal hinkam, waren kaum vier Dutzend übrig, ein großer Teil war requiriert worden, viele mußten geschlachtet werden, späterhin wurden die Stallungen wieder aufgefüllt auf mehr als das Doppelte; zuletzt, als wir nach dem Tode meines Schwiegervaters das Gut verkauften, waren sie abermals auf die Hälfte ungefähr geschwunden. Wir konnten nicht genug Schweizer und Stallmägde bekommen.‹‹
»Was für Rasse denn?«
»Die heimische Normannische Rasse, braun oder schwarzweiß gescheckt, kurzhörnig.«
»Sie werden besser ausgesehen haben als die unseren. Waren Sie schon einmal im Kuhstall, Madame? Nun, er ist wahrhaftig keine Sehenswürdigkeit. Die Kühe gleichen den sieben mageren Jahren, um eines vermehrt. Es heißt, ihre Magerkeit sei Rasseeigentümlichkeit, wie das blonde Fell, aber warum sind dann Io und Iris ganz gepolstert? Ich glaube eher, der Papa hat sich beim Ankauf übers Ohr hauen lassen, was versteht auch so ein Doktor der Nationalökonomie von Ökonomie! Also muß ich jetzt dazu schauen. Am liebsten möchte ich Landwirtschaft in Frankreich studieren, in einer Schule sowohl wie praktisch. Es gibt doch in Paris eine Hochschule für Bodenkultur, nicht wahr?«
»Nicht bloß in Paris, auch in einer Reihe von anderen Städten, Montpellier zum Beispiel.«
Madeleine klaubt, was ihr von diesem Gegenstand geläufig ist, zusammen, um Arthurs Wißbegierde zu stillen; während sie trockene Namen und Zahlen, Betriebseigenarten und Fachausdrücke für landwirtschaftliche Maschinen aneinanderreiht, sieht sie, wovon sie abgezogen redet, lebendig vor sich:
Die Normandie mit ihren tiefgrünen saftigen Weiden und bunten Rindern, ihren Obstwäldern im rosigen Blütenschaum, mit den tropfenblitzenden Netzen, welche über den schwarzen Kielen der umgestülpten Fischerbarken in der Sonne trocknen. Die Bretagne mit grauen Klippen, grauen Dünen, grauen Steindörfern; die Kiefernwälder der Vendée; die zackigen Weinberge an der Garonne, die im August von tausenden Stanniolblättchen, als Vogelschreck ausgelegt, glitzern und gleißen. Die blonde Beauce, wogenden Weizenhaars; die Provence in dichten Wolken silbergrauen Öllaubs, das sich, von der Stachelpeitsche des Mistrals gezüchtigt, schweratmend hebt und senkt, wo knorriger Stamm den Panfuß zeigt und die schwarzen Sterne der Dryaden aus den staubigen Blättern äugen. Die spiegelnde Loire, welche in gewundenen Treppen und Türmen, mit Terrassen und Zinnen, Belfried und Wallgraben, kräuselnd die untergegangene Feudalzeit hinabschwemmt; die dunklen Maulbeerbaumgänge an der Rhône, die lange nach ihrem Zusammenfluß mit der trägen grauen Saône deutlich unterscheidbar ihre glasgrüne Strömung eigensinnig weiterrollt, so daß die beiden Flüsse sich noch weithin verfolgen lassen, wie im Antlitz eines Kindes die Züge der Mutter, die Wesensart des Vaters deutlich zu erkennen sind, zwiespältig, niemals ganz vereinigt.
Burgund mit seinen Rebenhügeln, wo in der Kartause von Champmôle die Weinenden wie steinerne Trauerweiden sich über die marmorharten Häupter der furchtbaren Herzöge neigen; Flandern mit emsigen Webstühlen, rauchenden Schloten und den verzweifelt ausgestreckten Armen der schwarzen Windmühlen vor dem kalten nordischen Himmel – und Madeleines Heimat, die Insel Frankreichs, die ihr Königtum, ihre Sprache, ihr Gesetz, ihre Überlegenheit den anderen Provinzen mitgeteilt, aufgedrückt, aufgedrängt hat, sie, die kleinste, die unscheinbarste, die unfruchtbarste von allen: fruchtbar nur an Geist, an Mutterwitz, an Flinkheit des Worts, an durchdringendem Blick, an feinem Ohr, an aufbrausendem Temperament, an der Fähigkeit raschen Umschwungs, jener inneren Beweglichkeit, die vorgestern der weißen Schärpe der Armagnacs, gestern dem violetten burgundischen Hut mit dem Andreaskreuz – die heute der Bourbonischen Lilie – morgen der phrygischen Mütze – übermorgen dem Napoleonischen Adler folgte – die vor einem Augenblick die Trikolore gehißt hat – und im nächsten die schwarzweißrote Flagge mit dem Hakenkreuz.
– Man muß – denkt Madeleine – sein Vaterland verloren haben, um es zu lieben, wie ich es liebe, mit eines Kindes ehrfürchtigem Dank für alle Gaben, eines Kindes Demut unter züchtigenden Streichen – und mit der unauslöschlichen Zärtlichkeit einer Mutter, die sich über das Fiebernde beugt: Ach, was immer es angestellt, wie schwer es sich vergangen, wie bitter es sie enttäuscht hat, was macht es schon aus, vorausgesetzt, daß es sich erhole und lebe!
Читать дальше