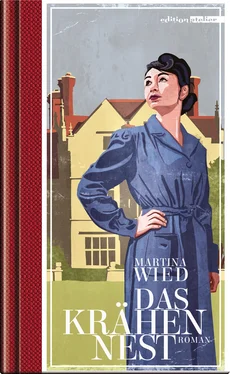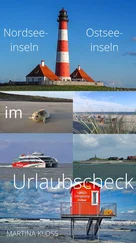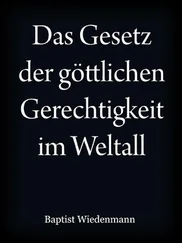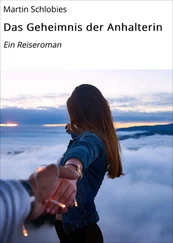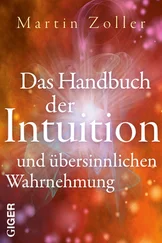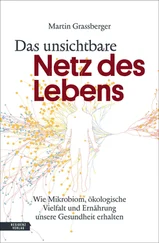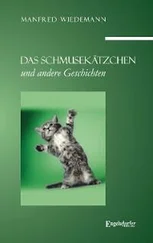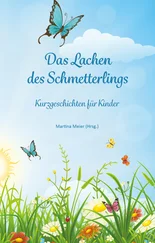Das haben sie. Aber es war ein anderer Kampf mit anderen Mitteln, und er wurde auf beiden Seiten mit Berechtigung, mit Überzeugung, mit Gewissen und – trotz allem – mit Liebe geführt, es war Ehre, auf der einen Seite zu stehen wie auf der anderen, vorausgesetzt, man stand aus reinen Beweggründen dort. Aber meinst Du vielleicht, Agrippa d’Aubigné, ein Sterbender fast, nahm’s als Ehre auf, daß sein Sohn die Pläne von La Rochelle dem Kardinal ausgeliefert hat? Sicherlich hatte auch d’Aubigné der Jüngere gute Gründe – nicht nur böse Gründe – für diese Handlung: Vielleicht sah er in dem mutmaßlich Überlegenen, dem er zum Sieg verhalf, die verläßlichere Bürgschaft für das Gedeihen unseres Landes – vielleicht regte sich in ihm das Blutserbe seiner katholischen Vorfahren; an seinen bisherigen Waffengefährten aber sah er jetzt plötzlich die enge Stirn, die verkniffenen Lippen, den starren Eigensinn und die knöcherne Unduldsamkeit; bei seinen früheren Gegnern aber fand er den weiteren Horizont, ein ihm gemäßeres Lebensgefühl, die beweglichere Geistigkeit, ein schöpferisches Element – es war ein tragischer Zwiespalt, und wie immer er sich entschied, war es tragische Entscheidung. Das ist es nun – und darin geb ich Dir recht, Ernest –, wir müssen, ehe wir uns anmaßen, über einen Charakter zu urteilen, zuerst sein spezifisches Gewicht kennen – das ist es nun, was von fast allen, die über unsere Vordergrundsfiguren sprechen, verabsäumt wird. Immer kommt es ihnen nur auf das ›Was‹ einer Handlung an, nie darauf › wer ‹ es ist, der sie begeht. Niedrige Motive, gemeiner Ehrgeiz, zynische Leichtfertigkeit – sind das denn Begriffe, die überhaupt mit Dir in Verbindung gebracht werden dürfen? Nur wer Dich gar nicht kennt, vermag Dir so etwas vorzuhalten, und ich, die Dich besser kennt als irgendein Lebender, besser vielleicht – wenn auch nicht so ganz vielseitig –, als Du Dich selbst kennst, ich sollte da nicht widersprechen?
Da ich doch ahne, da ich doch weiß, was Dich ergriffen hat: daß Du müde warst unserer Oberfläche, müde unserer geschlossenen starren Form, müde unserer seichten Lebensauffassung, unserer spielerischen Kunst, unserer törichten Übereinkunft, die einen Verstoß gegen Ehre und Ethos läßlich – und einen Verstoß gegen gesellschaftliche Formeln unverzeihlich fand; daß Du überdrüssig warst unserer verniedlichten, eleganten Gefühle, unserer beschnittenen Gärten, unserer Hahnreikomödien, unserer importierten Jazzkapellen und eingeführten Niggersteptänze, unserer entseelten, verdorbenen, verwesenden Zivilisation. Mit der Inbrunst eines Mystikers, der weiß: ›Uns rettet nur Gott‹, hast Du gesagt: ›Uns rettet nur der Krieg‹ …, stumm fortsetzend: ›Nur der verlorene Krieg‹, denn unser Volk hat sich noch jedesmal in der Niederlage groß bewährt. Ich kann auch verstehen, was Du am deutschen Wesen aufsuchst und liebst: den dunklen Urwald des Herzens, den Urgrund alles Menschlichen, den herben Klang einer Ursprache, die über alle fremden Einströmungen hinweg sie selbst geblieben ist, das Wort ›Ur‹ an sich, das in keiner anderen lebenden Sprache ein Äquivalent hat, und das die deutsche adelt. Noch das an ihnen, was man bei uns als Mängel ansieht, steht Dir hoch: das Fehlen aller gesellschaftlichen Überlieferung und damit alles gesellschaftlichen Zwanges, die freiwillige Armut – sind nicht alle großen deutschen Ideen aus unvorstellbar dürftigen Pfarren und Kleinbürgerwohnungen hervorgegangen? –, die seelische Freiheit noch unter Zwang und Bedrückung, die Selbstzucht, womit das Leiden hingenommen wird als eine Vorstufe zur Vollkommenheit.
Diese gerechte Bewunderung aber macht Dich oft ungerecht gegen Dein eigenes Volk: Du siehst nicht, wie anmutig sich seine leichte Art von der deutschen Schwerfälligkeit abhebt, wie vorteilhaft seine Genügsamkeit in Trank und Speise von der deutschen Gier, wie klar sein folgerichtiges Denken von der deutschen Verworrenheit, die oft Tiefe nur vortäuscht. Du anerkennst nicht die eingeborene Fähigkeit des Franzosen zur Form, da dem Deutschen alles unter den Händen ins Ungeheure anwächst – oder zerbricht.
Das alles verstehst Du nicht genug zu schätzen, weil es Dir selbst mehr als irgendeinem Deiner lebenden Landsleute eignet, es ist Dir selbstverständlich, es west in Deiner Dichtung und Deinem Alltag, in Deiner Kunstform und Deiner Lebensform. Du aber reichst über diese Begrenzungen weit hinaus, es ist das Ahnen um Abgründe, was Dich groß macht, kein anderer hebt wie Du, was aus Urtiefen stammt, als Gebild zur Oberfläche. Das ist es, was sie drüben an Dir wert halten, Du hast, was gestaltlos, unfaßbar, flutend in ihrem Unbewußten lebt, ihnen sichtbar gemacht.
Wenn irgendeiner, hast Du das Recht, als Ausnahme zu gelten und Ausnahmsgesetze für Dich zu beanspruchen. Nur vergiß nicht, wie viele Augen an Dir hängen, wie viele Lippen Dir nachbeten, wie viele sich nach Deinem Beispiel entscheiden: ›Was Le Sieutre tut, muß das Rechte sein, ich will ihm nachfolgen.‹
Das ergibt aber zugleich eine furchtbare Verantwortlichkeit, die mich erzittern macht. Wie – wenn er einmal, im guten Glauben, gewiß, mit unwiderleglichen irdischen Gründen dafür, aber dennoch – dennoch einmal das täte, was vor dem forum dei Unrecht ist?
Du weißt, Ernest, ich war immer bereit, mit einer unverwüstlichen Neigung bereit, Dir recht zu geben gegen mich. Immer war mir’s Bedürfnis, Deine Überlegenheit, Deinen schärferen Blick, Dein tieferes Verständnis für alle Lebensdinge anzuerkennen. Ich wußte, Du: überragtest mich so weit, daß Du notwendig über mich hinausblicken mußtest. Doch gerade, weil Du so hoch stehst, mag Deiner edlen metaphysischen Weitsichtigkeit manches Nahe, Kleine, Unscheinbare, Demütige entgangen sein, Du magst übersehen, welche Schönheit im geduldigen Ausharren, welche Kraft in der eigensinnigen Ablehnung alles Fremden, welcher heldische Wille in der stummen Unnachgiebigkeit, dem einsilbigen Widerstand gegen die Bedrücker, lebt.
Gewiß, Du hast mir versprochen, solche zu schonen, ja, ihren Schutz zu übernehmen, war einer der ersten und vornehmsten Gründe, die Dich zum Bleiben bewogen haben. Wie aber weiß ich, ob Du es jetzt nicht schon notwendig findest, sie vor sich selbst zu schützen, in einer Haft, welche die neuen Herren sehr doppelsinnig ›Schutzhaft‹ nennen? Ach, Ernest, wie erträgst Du denn diesen Zwiespalt, dieses Zwischen-den-Lagern-Stehen? Das unaufhörliche Hin-und-zurück-gerissen-Werden, das beständige Sowohl-als-Auch, Du, bei dem es doch immer Entweder-Oder geheißen hat?
Wer könnte Dir besser nachfühlen, was Zwischen-den-Lagern-Stehen bedeutet – als ich? Lang vor unserer Trennung hab’ ich’s durchgemacht: Weißt Du denn, wie wund, wie zerrissen ich mich gefühlt habe, von dem Tag an, als ich merkte, wohin es Dich zog, wo Du, nur mit einem Fuß gleichsam, zögernd, vorfühlend – aber dennoch bereits standest? Du freilich hast es anders gedeutet; da es Dir doch selbstverständlich schien, ich müßte Dir, wohin immer, Gefolgschaft leisten, hast Du mir meine Standhaftigkeit verargt – jene Standhaftigkeit, die mich zur Wanderhaften machte, während Du, der sich innerlich von mir, von allem, was uns Gesetz gewesen war, ja, von Dir selbst entferntest, äußerlich dort verbliebst, wo für mich nicht länger Heimat war.
Du hast mir meine Haltung übelgenommen, ja Du hast mir vorgeworfen, es wäre gar nicht meine Überzeugung, François habe in meiner Seele über Dich gesiegt, um meines Sohnes willen stünde ich im Begriffe, Dich im Stich zu lassen – da es sich doch umgekehrt verhielt, da François es war, der meine Haltung annahm und zur Tat machte! Ach, Ernest, es war, sprichst Du Dir auch alle diplomatische Eignung ab, immer Dein kühnster, Dein schlauester Schachzug, den anderen glauben zu machen, er tue, was Dir willkommen wäre, was Du ihm vielleicht wünschlich übertragen hattest, aus eigenem! Längst, ehe ich noch daran dachte, nahmst Du bereits mein Fortgehen für ausgemacht an, so zwar, daß Du mir’s als Fahnenflucht auslegen konntest.
Читать дальше