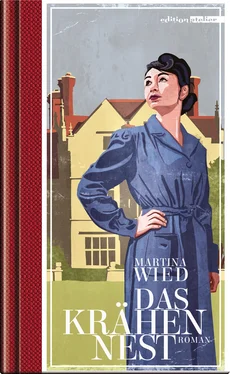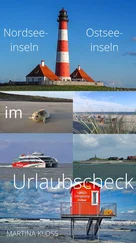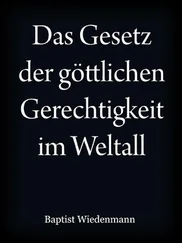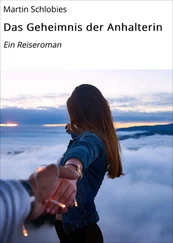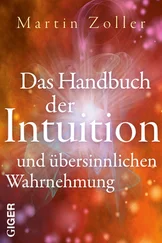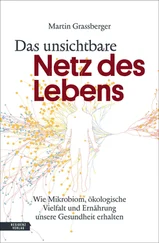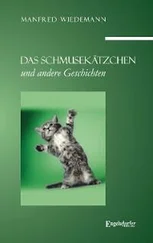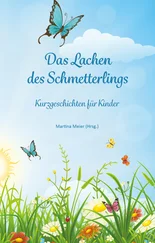1 ...8 9 10 12 13 14 ...22 »Man kann auch«, hatte Madeleine widersprochen, »sein Vaterland verlieren, wenn man darin bleibt, und man kann es mit sich nehmen, überallhin.«
– Was – hatte Madeleine sich nach diesem Gespräch gefragt – steckt, außer dem Einbekannten, noch hinter seinem Entschluß? Stets hat er mir nur seine beleuchtete Hemisphäre zugekehrt, die auch anderen sichtbare, was aber geht auf der für alle dunklen vor sich? Etwas vollzieht sich dort, was er sogar vor mir, vor sich selbst vielleicht, verheimlicht, nie werde ich erfahren, was es ist, denn ich hüte mich, nachzuforschen: aus Achtung vor ihm, aus Angst für mich selbst. Wie, wenn es nicht bloß eine erhabene, überpersönliche Aufgabe wäre, nicht bloß Heimatliebe, was ihn zurückhält? Dunkle Gewalten sind da am Werk, anderes noch gibt’s für ihn. Ehrgeiz? Sicherlich, aber nicht von der gemeinen Art. Niemals hat er ihm die Bahn freigegeben, immer hat er ihn durch andere Kräfte gebändigt und gebunden: da war die Überlieferung seines Hauses, seine religiöse Überzeugung, sein Wille zur Demut (wenn auch nicht Demut selbst), seine philosophische Weltanschauung, sein Abscheu vor der Berührung mit rohem Wettstreit, und – die stärkste unter allen seinen Bindungen: Ich. Hat er mich nicht sein Gewissen genannt? Jetzt aber? Wie – wenn alle diese Hemmungen nun wegfielen? Wenn er, während des allgemeinen Aufruhrs, zeitweilig im Unsichtigen verschwinden dürfte? Wenn er nicht länger zu jeder Stunde, immer im Rampenlicht, eine ideale Stellung, und eine sehr wirkliche zugleich, seinen geistigen Rang, seine nationale Bedeutung und alles, wofür er sonst steht, verteidigen müßte? Da er nun nicht mehr unter dem wachsamen Blick der Freunde – und der-Feinde –, der ihm sich seine Blöße zu geben, nicht erlaubte – nicht mehr in der Nähe solcher lebt, die jede Linie in seinem Gesicht, jede seiner Gebärden, jeden Tonfall seine Stimme nur allzu genau kannten, vor denen sogar er – dessen Weg immer Umweg und Geheimnis ist – sich nicht völlig verbergen konnte? Den Fremden hingegen mag er sich darstellen als eine von ihm selbst erdichtete Gestalt, die auch unter ihrer Bewachung sich in Rauch auflösen – im Namenlosen sich verflüchtigen könnte.
Ah – wie einsam muß er sich jetzt, trotz allem, fühlen! Das »entsittlichende Leben des Exils« – ja, bist du denn nicht im Exil, wo der Fremde gebietet? Wenn er in deiner Stadt, deiner Straße, deinem Haus, deiner Stube allgegenwärtig ist, wenn er ungebeten, unangesagt zu jeder Tages- und Nachtstunde bei dir eintreten darf? »Die meisten Fehlgriffe und die meisten Verbrechen«, hast du gesagt, Ernest, »werden aus Mangel an Vorstellungskraft begangen.« Wie steht es nun um die deine? –
»Die Lust am Verrat …« Ach, Ernest, da fällt mir ein anderes deiner Worte ein: »Niemand«, hast du einmal hingeworfen, »vermag tiefer in uns einzudringen als unser Feind, seherisch vermag er die verstecktesten unserer Schwächen, die behütetsten unserer Geheimnisse, die gehegtesten unserer Leidenschaften, die verhülltesten unserer Laster aufzuspüren, durch ihn erst lernen wir in unsere Abgründe schauen.«
– Horch also jetzt auf die Stimme des Feindes: »Ah, welche Verfeinerung aller Gaben, aller Einfälle, aller Laster! Welche Vorurteilslosigkeit, die gestattet, alle Ideen gleichzeitig in sich aufzunehmen und gegeneinander abzuwägen, welche Intelligenz, die mit Glaubenssätzen jongliert, wie ein Zauberkünstler mit farbigen Kugeln! Und das alles – Ideen, Kunstformen, Religion, Vaterland –, das alles umarmt er, um der tieferen Wollust willen, es fragwürdig zu machen, es zu verraten. Das liegt ihm im Blut: Seine adeligen Vorfahren in der Provence waren ein Geschlecht von Verrätern, bei ihnen blieb’s im kleinen Maßstab, ein Mitkämpfer wurde hinterrücks erstochen, ein Mitbewerber in einen Hinterhalt gelockt und abgetan, eine Geliebte schmählich preisgegeben; aus dem Dienst eines Fürsten gingen sie warnungslos in den eines anderen über, sie verrieten ihre Herren, ihre Freunde, ihre Gegner, ihre Frauen: Dem späten Enkel blieb es vorbehalten, ein ganzes Land zu verraten.« Wo nun steckt hier die tiefere, die seherische Erkenntnis des Feindes? Erschuf er nicht hier eine Gestalt, die in allem und jedem der Gegensatz des echten Ernest Mathieu wäre? Macht dieser Feind nicht den Abgründigen oberflächlich, verwandelt er nicht einen, der wie kein anderer an absolute Werte glaubt, in einen haltlosen Relativisten, einen Eklektiker – stellt er nicht ihn, der keine Halbzeile geschrieben hat, worin nicht seine Überzeugung, seine geistige Entwicklung, seine Blutsverbundenheit mit seinem Volk, seiner Erde, seiner Überlieferung ganz enthalten ist, als seichten Alleskönner hin, dessen Geschicklichkeit über seinen Mangel an Charakter und Persönlichkeit hinwegtäuscht?
Trotzdem – und Ernest wäre wohl der erste, es zu erkennen, wenn auch nicht, es zuzugeben –, trotzdem steckt noch in dieser Verleumdung ein Körnchen Wahrheit. Es ist hier von Ernests »adeligen Vorfahren in der Provence« die Rede, obwohl dieser Feind wissen sollte, daß die Le Sieutres Normannen sind, und es ist doch wiederum richtig, daß Ernests Mutter aus Cahors stammte, von einem Geschlecht, das dort seit Jahrhunderten ansässig war. Genau so ist auch ein Fünkchen richtiger Erkenntnis in dem Satz enthalten: »Um der tieferen Wollust willen, es fragwürdig zu machen.« O ja, immer wieder kommt es bei Ernest zu einer Krisis, worin er unaufhaltsam angetrieben wird, alles, was ihm bislang gültig, ehrwürdig, unverletzlich war, in Zweifel zu ziehen, auf die Probe zu stellen. Nicht zufällig hat er das Griselda-Motiv umgedichtet: Hat er denn nicht auch mich geprüft, ob ich alles, was er von mir verlangte, erfüllen – alles, was er mir auflüde, tragen würde? Hab’ ich nicht oft genug im Gleichnis für ihn die Stiegen gewaschen, wenn eine andere mit ihm geschmückt bei Tische saß? Dieser Unglaube im Glauben, dieser Zweifel noch im Vertrauen, dieser unstillbare Hang, zu wissen, was dem Verstand doch niemals deutlich wird, diese übersinnliche Frag-Würdigkeit ist recht eigentlich die Keimzelle von Ernests Künstlerschaft. Das ist es, was ihn mit deutscher Dichtung und Musik verknüpft: es ist ein faustisches Element, etwas von Beethovens Himmelsaufruhr, eine Dürersche Melancholia, eine Ritter-Tod-und-Teufelschaft, ein Schubertsches Zwiegespräch des Lebens mit dem Tode in Ernests erhabensten Versen enthalten. Was aber geht das denn den Mann im »Ausblick« an, dessen politisches Geschäft von ihm verlangt, Ernest unehrlich zu machen?
Er selbst aber, Ernest, wie faßt er selber das auf?
»Was wir jetzt herzklopfend, erschüttert, in atemloser Spannung miterleben, ist ja nicht länger ein Kampf um Gebietszuwachs, um Reichtümer, um Rohstoffe, es ist ein Kampf um Ideen, ein Kampf zur Durchsetzung einer heroischen Lebenshaltung. Es ist, tiefer gesehen, nur eine Phase der großen Umwälzung – der gewaltigsten seit der Völkerwanderungsepoche –, worin wir jetzt mitten innen stehen. Beginge nun einer, der, seit er zu sich selbst gekommen ist, seinem Volk den Spiegel vorgehalten hat, der ihm seine Gier nach Besitz, seinen Geiz, seine tierische Entseelung der Liebe, seine Herzenshärte, seine Oberflächlichkeit vor Augen gebracht – der ihm immer wieder den Weg zu einer Erneuerung, einer Läuterung, einer Veredelung, einer Umkehr gewiesen hat, Verrat – wenn er die wesentlichsten seiner Forderungen bei einem Nachbarn auf dem Weg zur Erfüllung sieht und sich diesem nun als Reisekamerad anschließen möchte? War es mir etwa verboten, Beethoven, Goethe, Nietzsche zu lieben, weil sie Deutsche sind? Wir – meinesgleichen – sind zu jeder Epoche und in jeder Nation eine kleine Minderheit, und unsere wenigen Brüder leben über die ganze Erde verstreut. Wie Pascal mit Kierkegaard enger verwandt ist als mit irgendeinem seiner Volks- und Zeitgenossen – die in der Mehrzahl ja seine gehässigen Angreifer waren –, finde ich heute solche, die mir zur Gesellschaft taugen, jenseits des Rheins. War Hölderlin vielleicht ein Verräter, als er, am Vorabend von Lunéville, Napoleon anrief, mit dem demütigen Bekenntnis: ›An solchem Stoff wird zum Knaben der Meister‹? Der Genius ist überzeitlich, übernational, überirdisch, allumfassend, und im Flackerlicht des Aufruhrs erkennen die helldunklen Geister einander.«
Читать дальше