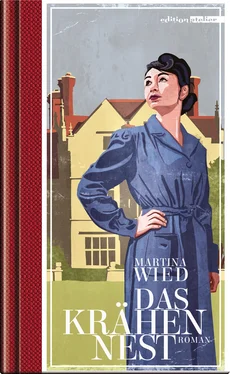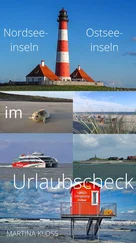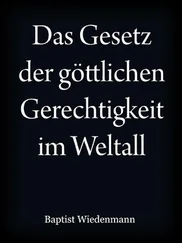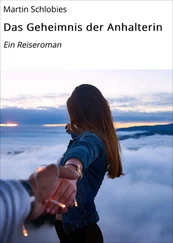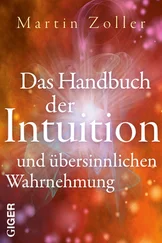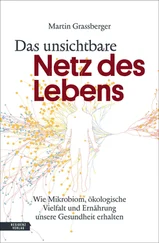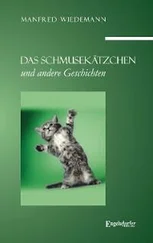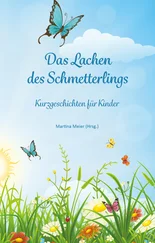Die Anspielung auf Hölderlin wurde wortwörtlich genommen, um Ernest seine »ärgerliche Anbetung des Führers« vorzuhalten. Anbetung ist wohl kaum das zu Ernest passende Wort, bewundernde Zustimmung ziemte hier eher. Er ist für Ernest, was Napoleon für Hölderlin war: eine mythische Gestalt, Symbol des dämonisch getriebenen, aus Eingebungen, Erleuchtungen, Überwältigungen heraus Handelnden. Solche aber, bei denen alles Berechnung ist – wie könnten sie verstehen, daß hinter Ernests Haltung anderes als Berechnung steckte?
– Da verteidige ich ihn – und weiß doch gar nicht, wie weit er heute bereits von jenem Ernest, den ich kenne, abgerückt ist, und was sich, seit ich fort bin, auf der verdunkelten Halbkugel seines Wesens vollzogen hat?
Die Feinde indessen haben vor seinem Eigenleben gar keine Ehrfurcht, stöbern frech und rücksichtslos darin: Ab, hier steht’s ja, darauf hab’ ich schon gewartet! Auf die Enthüllung nämlich, daß Ernest »in der Verbindung mit der Tochter eines mediatisierten Fürstenhauses, die für ihn zugleich das Bindeglied zum Führer ist, die Erfüllung seiner kühnsten, seiner ehrgeizigsten Hoffnungen voraussieht«. Warum so zurückhaltend gerade in diesem Punkt, warum nennen sie den Namen nicht, da er ihnen doch auf der Zunge liegt? Freilich wär’ das eine Eroberung, mit der er sich sehen lassen dürfte, eine schöne Person, und jung – und Ernest …
In diesem Augenblick hat Madeleine ihn vor sich: Daheim in ihrem Wohnzimmer in der Rue de Fleurus, am Kamin sitzend, den Kopf in die rechte Hand gestützt. Zuerst gewahrt sie sein in der Mitte gescheiteltes Haar, worin das glänzende Lackschwarz nun bereits von vielen weißen Fäden durchzogen ist, dann seine früh gebleichten Schläfen; nun steht er auf, viel größer als der Sitzende es hätte erwarten lassen, er blickt auf Madeleine mit jenem Lächeln herab, das er ihr so oft zugewendet hat, wie auf ein begabtes, kluges, aber in weltlichen Dingen völlig unerfahrenes Kind. Seine Stirn ist nun ein bißchen stärker gefurcht, nach einem Zug aus der Zigarette stößt er zweifarbigen Rauch – blaßblau und grau – durch seine leicht gebogene Nase, von deren schmalen Flügeln sich geschwungene Kerben zu den Mundwinkeln abwärts ziehen; Kerben, die von Ironie, Hochmut, Mißtrauen und Wollust eingegraben sind; das weiche Kinn ist von einem Grübchen geteilt, die hellen blaugrünen Augen in dem dunklen Gesicht – Normannenerbe in einem Antlitz, das von einer südländischen Mutter übernommen ist – blicken forschend, unbeteiligt, kühl, überlegend und überlegen in irgendeine, anderen verschlossene Ferne.
Niemals wird Madeleine ganz wissen, was hinter diesen Stirnbuckeln vor sich geht, niemals wird sie diesen Proteus völlig kennen, niemals erraten, welcher seiner Widersprüche jetzt den anderen überwunden hat; niemals – wohin einer dieser Widersprüche ihn abseits locken, wie weit er ihn führen könnte, und wie weit er gehen wird, sobald er nun seinen Weg frei sieht, die Hemmung, die Warnerin, das Gewissen fort – und die Verführung gegenwärtig.
Da man ihn im Feindeslager nach seiner Bedeutung zu schätzen weiß – und besser als unter seinen eifersüchtigen »confrères« – wird man, ihn zu halten, die äußersten Mittel anwenden, wird versuchen, einen, der mit seinem Verstand, seiner Weltanschauung, seinen geistigen Neigungen auf der einen – mit seinem Instinkt, seinem Unbewußten, seiner Religiosität, seiner Kultur, seinem Geschmack auf der anderen Seite steht, bei seinem Irrationalen zu packen, um ihn dergestalt völlig ins andere Lager zu ziehen. Ist dieses Irrationale nun in der Fürstin Mechthild Liewen verkörpert? –
In dem kahlen Zimmer mit den roten Fliesen, den weißgestrichenen Holzwänden, die jetzt, als einzigen Schmuck, einen Kupferstich des Jacques Bellange tragen – ein Noli me tangere –, der für Madeleine besondere Bedeutung besitzt und den sie überallhin mit sich führt –, unter dem gebräunten Gebälk, sitzt Madeleine an dem niederen Tischchen über einem Brief, der, fürchtet sie, ins Leere gesprochen ist:
»Mein Ernest, wie weiß ich denn, ob meine Stimme Dich erreichen wird, so wie, durch einen providentiellen Zufall, die Deine mich kürzlich erreicht hat? Ich war über Weihnachten bei Freunden – was man hier so Freunde nennt: der wirkliche Freund, mein früherer Beichtvater, ist jetzt Kriegsgefangener im Fernen Osten, und seine Familie hatte mich liebenswürdig für die Feiertage eingeladen –, ich war also in einem recht kleinbürgerlichen Haushalt, in einem Provinzstädtchen, das Du wohl kaum dem Namen nach kennst, zu Gast; am Stephanstag, allein geblieben, dreh’ ich, ganz aufs Geratewohl die Nadel des Empfangsapparats, und – meine Hand stockt, meine Hand erstarrt, ich habe gar keine Hand mehr, keinen Mund, kein Auge, keinen Körper, bin nur Ohr – denn ich höre Dich …, Deine Stimme, über einen Abgrund von Zeit und Leid, über ungeheuren Raum, über Trennung, Mißverständnis, Herzweh hinweg, kommt zu mir, und ich – mich auflehnend gegen jedes Wort, gegen den Sinn jedes Wortes, trinke doch das Wort in mich ein, jedes in dem vollkommensten Klang unserer Muttersprache – jedes mit einer Überzeugung gesagt, welche die meine verwundet, jedes zum Preis und Vorteil jener, vor denen ich geflohen bin, und gegen die ich – nicht nur aus trägem Beharren im Gewohnten, aus Anhänglichkeit an eine Standarte, einen Wahlspruch, eine Überlieferung –, nein, aus seherischem Wissen um das Vergebliche, das Frevlerische Deiner Bemühungen, mich zur Wehr setze! Weil ich aus jenseitiger Schau die Kluft, die unüberbrückbare Verschiedenheit zwischen jenen und uns erkannt habe.
Vielleicht wirfst Du mir nun vor, ich sei’s, die sich gegen eins ihrer Heimatländer, das Land ihrer Mutter, auflehnt: Ach nein – es ist ja nicht mehr meiner Mutter Land, Ernest, wovon ich mich abwende –, unfreiwillig, überrumpelt, durch Erpressung, Verrat, feige Preisgabe, wie nur unser gemeinsames Vaterland, ist es rücksichtslosen Siegern ohne Schuß, ohne Waffengebrauch, zugefallen und wird nun von ihnen gewürgt, gepeinigt, geplündert, ausgesaugt. Das, wogegen ich mich kehre, ist ja nicht Deutschland selbst, es ist ja nur ein Wirbel in dem breiten Strom, nur ein Strähn im Geflecht des deutschen Geistes, nur eine Erscheinungsform seiner Vielgestalt, die darin augenblicklich zur Vorherrschaft gelangt ist – und sie mißbraucht. Ich verkenne gewiß nicht, daß sehr edle und sehr bedeutende Menschen jenseits des Rheins mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Vermögen in diesem Lager sind: Sind sie es aber auch mit ihrer ganzen Urteilskraft? Machen sie sich nicht willentlich unfühlsam gegen die Leiden der Andersdenkenden und Überwundenen, nicht taub gegen das geknebelte Stöhnen, das aus den Gefängnissen, den Konzentrations- und Zwangsarbeitslagern dringt, nicht blind vor den brennenden und blutigen Malen der Folter, den roten Striemen, blauen Wunden, schwarzen Frostbeulen? Sind sie denn nicht gehorsam verstummt – da sie doch schreien, brüllen, anklagen müßten?
O ja, ich weiß schon: Was jetzt – sagen sie, sagst Du – an notwendigen und vielleicht auch unnötigen Grausamkeiten verübt wird, gehört zu den Kinderkrankheiten der großen Erneuerung, seien wir nicht allzu wehleidig, bald genug werden sie überwunden sein!
Sie gehören dazu, vielleicht. Aber auch eine politische, eine religiöse Bewegung, ja, eine Nation, kann an ihren Masern, ihrem Scharlach, ihrer Diphtherie sterben, oder einen dauernden inneren Schaden davontragen. Sag nicht, das sei Empfindelei, gehöre zu dem, was wir beide die ›falschen Gefühle‹ zu nennen pflegen.
Worauf es einzig ankommt, ist, sagst Du wohl, Rang und Wert im Geistigen, im Seelischen und in den Handlungen der Menschen richtig zu unterscheiden, immer zu wissen, was das Wichtigere, wer der Wichtigere ist. Jede neue Idee, jeder neue Glaube ist unter blutigen Wehen zur Welt gekommen. Hat nicht ein Marot, ein Ronsard, ein d’Aubigné den Schmerz um die Unterdrückten, die Verfolgten, die Vernichteten so brennend verspürt, wie nur Du und ich ihn jetzt spüren? Und hat nicht jeder von ihnen auf der einen oder anderen Seite dennoch auf seinem Kampf beharrt? –
Читать дальше