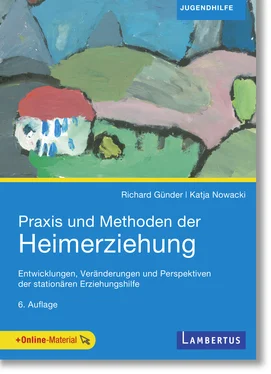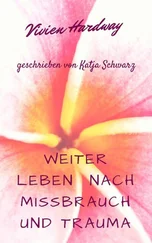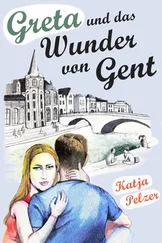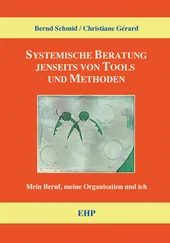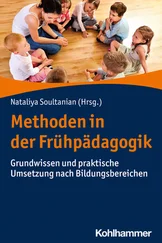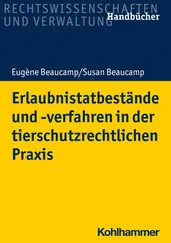Spätestens dann, wenn eine Bezugsperson austritt, merken die Kinder, dass „ihre Familie“ eine organisierte Täuschung war (Bühler-Niederberger 1999, S. 337). Durchsetzen konnte sich allenthalben jedoch die Tendenz, Heimerziehung in Gruppen zu praktizieren, die zumindest von der äußeren Form und Struktur her der Familie ähneln. Bis auf wenige andere Ausnahmen gebührt zweifellos der SOS-Kinderdorfbewegung der Verdienst, Heimkindern einen Rahmen geschaffen zu haben, in dem neben einer beständigen Bezugsperson eine wirkliche Atmosphäre der Geborgenheit und des Sich-Zuhause-Fühlens vorhanden war. Die übrigen Institutionen der Heimerziehung verfügten zwar im Laufe der Jahre auch über bessere Gebäude und nach und nach über zumindest einzelne pädagogisch ausgebildete Mitarbeiter*innen, es waren aber trotzdem immer noch Anstalten mit ihren typischen Negativmerkmalen.
Erst gegen Ende der 1960er-Jahre wurde der Heimerziehung insgesamt mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Initiatoren der sogenannten Heimkampagne oder anders ausgedrückt: der Skandalisierung der Heimerziehung, waren linke Student*innengruppen, die das vorherrschende kapitalistische Gesellschaftssystem anprangerten und sich für Randgruppen, welche durch eben dieses System erzeugt seien, einsetzten. Heimkinder und vor allem Jugendliche in geschlossenen Fürsorgeheimen waren eine solche Randgruppe, mit der Student*innengruppen sich solidarisierten. Die Öffentlichkeit wurde – teilweise in spektakulären Formen – auf die Not der in Heimen lebenden jungen Menschen aufmerksam gemacht, die Rahmenbedingungen und Erziehungspraktiken wurden angeprangert. Heimzöglinge wurden „befreit“, es entstanden die ersten alternativen Wohngemeinschaften. Auch die allgemeine Einstellung zur Erziehung unterlag in diesem Zeitraum Veränderungstendenzen, die im Zusammenhang mit den politischen und gesellschaftlichen Reformen gesehen werden können. Vor allem die Veröffentlichungen von Neill (1970/2014) über die Theorie und Praxis der antiautoritären Internatschule Summerhill gaben sowohl der Fachwelt als auch der breiten Öffentlichkeit wesentlichen Anstoß zu einer lebhaften und lang anhaltenden Diskussion über diese revolutionär anmutenden Erziehungsansichten. Sowohl die Skandalberichte über die Heimerziehung als auch die Auswirkungen der antiautoritären Erziehungsbewegung leiteten erneut Reformforderungen für die Heimerziehung ein, wie
•die Abschaffung repressiver, autoritärer Erziehungsmethoden,
•die Verringerung der Gruppengröße,
•tarifgerechte Entlohnung sowie Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten für Erzieher(innen),
•die Abschaffung von Stigmatisierungsmerkmalen, etwa Anstaltskleidung, Heime in abgelegener Lage etc. (Almstedt/Munkwitz 1982, S. 21–33).
Heimerziehung in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR; 1949 – 1990)
Heimerziehung in der DDR hatte die Aufgabe, sich mit Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen, „für die gesellschaftliche Regelsysteme nicht greifen, also mit Ausnahmefällen“ (Mannschatz 1994, S. 15).
Während in Westdeutschland die 1968er-Bewegung, die Skandalberichte über die Zustände in Heimen sowie liberaler gewordene politische und pädagogische Auffassungen und Realitäten zu andauernden Reformen der stationären Erziehungshilfe führten, gab es in den Heimeinrichtungen der ehemaligen DDR weniger solche Impulse und Veränderungen.
Dagegen bestanden in der Zeit vor 1968 bezüglich der Heimerziehung viele Übereinstimmungen. Kappeler (2008, S. 69 ff.) resümiert, dass in den stationären Jugendhilfesystemen beider deutscher Staaten Merkmale „totaler Institutionen“ vorhanden waren, so wie sie von Goffman (1974) beschrieben wurden. Sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR waren abweichende Verhaltensweisen, die Beobachtung bzw. Zuschreibung von Verwahrlosungstendenzen und sogenannte Schwererziehbarkeit wesentliche Einweisungsgründe. In der DDR wurden – im Gegensatz zu Westdeutschland – die aus den Normabweichungen resultierenden „Erziehungsnotwendigkeiten“ ganz offen dargelegt und ideologisch mit der „Erziehung zu einem neuen Menschen“ und zum Sozialismus begründet. In Ost und West „stand die Einhaltung der ‚Heimordnung‘ durch die Kinder und Jugendlichen gleichermaßen im Mittelpunkt des pädagogischen Geschehens“ (Kappeler 2008, S. 73). Um Disziplin und Veränderungen zu erreichen wurde mit Härte und unnachgiebiger Konsequenz (um)erzogen. Größere Gruppen oft verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher führten nahezu zwangsläufig zu „kasernierten Strukturen und Ordnungen“ (Krause 2004, S. 139).
In der ehemaligen DDR lebten durchschnittlich ca. 30.000 Kinder und Jugendliche in Heimen (Krause 2004, S. 11). In Westdeutschland befanden sich in den 1980er Jahren im Durchschnitt ca. 52.000 junge Menschen in Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe. Vergleicht man diese Zahlen mit der jeweiligen Bevölkerungsanzahl im Jahr 1989 (DDR 16,4 Millionen – Westdeutschland 62,6 Millionen), dann fällt auf, dass in der DDR im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr als doppelt so viele Kinder und Jugendliche in Heimerziehung untergebracht waren als in der Bundesrepublik.
Mannschatz bewertet das inhaltliche Konzept der Jugendhilfe in der DDR als ein von Anfang an pädagogisch orientiertes Konzept. Es ging um die Beeinflussung der Lebens- und Erziehungssituation junger Menschen. Begünstigt wurde dies durch den Aspekt, dass Jugendhilfe der Volksbildung zugerechnet wurde (Mannschatz 1994, S. 40). Die inhaltliche Ausrichtung der Heimerziehung in der DDR orientierte sich wesentlich an den Erziehungsvorstellungen des Pädagogen Makarenko, welcher als Hauptform der Erziehung das Kollektiv betrachtet (Makarenko 1978, S. 125). Die Kollektiverziehung solle zur Heranbildungen des neuen (sozialistischen) Menschen verhelfen (Hafeneger, 2017, S. 14). Entscheidend sei hierbei die Disziplin. Diese „darf nicht nur als Erziehungsmittel angesehen werden. Sie ist das Ergebnis des Erziehungsprozesses, in erster Linie das Ergebnis des Kollektivs der Zöglinge selbst …“ ( S. 39). Während im Westen die individuelle Förderung immer wichtiger wurde, stand im Osten nicht die einzelne Person, sondern die Gemeinschaft im Zentrum der Erziehung.
Die Differenzierung der Heime reichte von Normalkinderheimen für Kinder von 3 – 14 Jahren, Spezialkinderheimen für sogenannte „schwererziehbare“ und auch bildungsschwache Kinder, Aufnahme- und Beobachtungsheimen (auch in Verbindung mit Strafvollzug oder Fürsorgeerziehung) über Jugendwerkhöfe für erziehungsschwierige und straffällige Jugendliche bis hin zu Jugendwohnheimen, Heimen für schwererziehbare, sogenannte bildungsunfähige schwachsinnige Jugendliche und Durchgangsstationen, wohl vergleichbar mit Institutionen der Inobhutnahme (Krause 2004, S. 81 ff.)
Heimerziehung „wurde im Wesentlichen erst dann realisiert, wenn andere Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg gezeigt hatten. Einzigartig und letztes Mittel zu sein, charakterisierte entscheidend das Selbstverständnis von Heimerziehung in der DDR“ (Krause, 2004, S. 89). Die Aufgabe waren vor allem der „Ausgleich und die Korrektur von Fehlverhaltensweisen“ ( S. 90).
Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau war die einzige Institution dieser Art in der DDR. „Sie war gedacht als Disziplinar-Einrichtung. Aufgenommen wurden Jugendliche, die in den Jugendwerkhöfen die Heimordnung ‚vorsätzlich schwerwiegend und wiederholt verletzten‘. (…) Der Aufenthalt durfte 6 Monate nicht überschreiten. Der Jugendwerkhof hatte eine Kapazität von 60 Plätzen“ (Mannschatz 1994, S. 59). Der Jugendwerkhof Torgau wurde zwischenzeitlich zum Inbegriff einer willkürlichen und das einzelne Individuum verachtenden Heimerziehung in der DDR. Ein Vergleich der Kapazitäten geschlossener Heimerziehung relativiert allerdings das Ausmaß dieser Erziehungsform: 60 geschlossenen Heimplätzen in der DDR standen im Jahr 1989 insgesamt 372 geschlossene Heimplätze in der Bundesrepublik gegenüber (v. Wolfersberger/Sprau-Kuhlen 1990, S. 61 ff.). Orientiert an den jeweiligen Bevölkerungszahlen hätte es nach DDR-Maßstäben nur 229 geschlossene Heimplätze in der Bundesrepublik geben müssen. Wir wollen nun jedoch die inhaltlichen Aspekte der geschlossenen Heimerziehung in Torgau betrachten.
Читать дальше