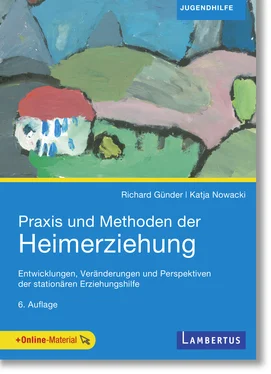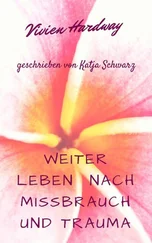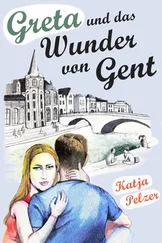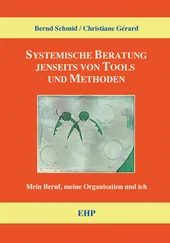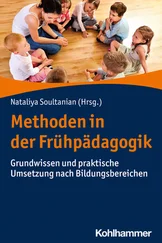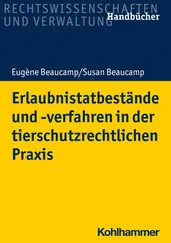1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 54 % der jungen Menschen erhielten nach ihrer Entlassung aus der Heimerziehung weitere Hilfe(n) zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfe, 5 % wurden durch den Allgemeinen Sozialdienst des Jugendamtes oder weitere Beratungsstellen unterstützt, in 41 % wurden allerdings keine weiteren Hilfen mehr gewährt (Statistisches Bundesamt 2018b).
Quantitative Veränderungen/Träger der Einrichtungen
Die Struktur der Trägerschaft der Heime und sonstigen betreuten Wohnformen bietet folgendes Bild: Von den insgesamt 36.754 Institutionen der stationären Erziehungshilfe sind 77,5 % in freier Trägerschaft und 22,5 % in öffentlicher Trägerschaft. Bei den freien Trägern sind die beiden konfessionellen Verbände, das Diakonische Werk (22 %) und der Caritasverband (15 %), besonders stark vertreten, nämlich mit 37 % aller freien Träger. Es folgen Institutionen des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes mit 17 % und der Arbeiterwohlfahrt mit 5 %. Etwa 6 % der Einrichtungen werden von Wirtschaftsunternehmen vorgehalten, 20 % von sonstigen juristischen Personen und anderen Vereinigungen. Die restlichen 15 % verteilen sich auf verschiedene Träger wie z. B. das Deutsche Rote Kreuz, die Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und andere religiöse Gemeinschaften des öffentlichen Rechts (Statistisches Bundesamt 2018a).
Am 31. Dezember 2016 waren insgesamt 93.551 pädagogisch/therapeutische Fachkräfte in Einrichtungen der Heimerziehung und in sonstigen betreuten Wohnformen incl. Internaten, die nach §34 KJHG aufnehmen, tätig. Den Hauptanteil der Mitarbeiter*innen nehmen mit 40 % Erzieher*innen ein. Danach kommen mit 24 % Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen (Diplom Fachhochschule oder Bachelorabschluss, beides mit staatlicher Anerkennung). Die Berufsgruppe der Pädagog*innen und Erziehungswissenschaftler*innen hat einen Anteil von 7 %. Annähernd 1 % sind Heilpädagog*innen. Kinderpfleger*innen findet man nur noch mit einem Anteil von weniger als 1 %. Heilerzieher*innen und Psycholog*innen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen sind jeweils zu etwa 3 % vertreten. Darüber hinaus finden sich verschiedene Berufsgruppen wie z. B. Familienpfleger*innen, Lehrer*innen, aber auch Krankenpfleger*innen (Statistisches Bundesamt 2018a).
Die Geschichte der Heimerziehung ist durch sehr viel Leid, Missachtung und durch das Fehlen einer Befriedigung elementarster Grundbedürfnisse wie liebevolle Zuneigung, Geborgenheit, Anerkennung und Lob gekennzeichnet. Unzulängliche Rahmenbedingungen und der Mangel oder das Außerachtlassen pädagogisch begründeter Vorgehensweisen innerhalb der Praxis haben zu einer Abseitsstellung und einem Negativimage der Heimerziehung geführt. Wie wir gesehen haben, hat sich das Praxisfeld Heimerziehung innerhalb der letzten 70 Jahre sehr stark verändert. Die Einrichtungen wurden von Anstalten mit Aufbewahrungscharakter zu differenzierten pädagogischen Institutionen mit qualitativ gut ausgebildeten pädagogischen Mitarbeiter*innen. Diese verbesserte pädagogische Ausgangslage wird in der Gesellschaft aber weiterhin zu wenig gesehen und anerkannt. Heimerziehung gilt oftmals immer noch als letztes (pädagogisches) Mittel.
Der Ende der 1960er-Jahre während der Heimkampagne laut gewordene Ruf: „Holt die Kinder aus den Heimen!“ ist aus heutiger Sicht, wenn man die Forderungen auf alle Kinder und Jugendlichen bezieht, pädagogisch weder notwendig noch verantwortbar, vor allem aber in der Praxis nicht realisierbar. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn wir die Indikationsstellung, d. h. die Problemlagen der Kinder und Jugendlichen, die auf Heimerziehung angewiesen sind, näher analysieren. Die heutige Heimerziehung hat die notwendigen Reformen weitgehend realisiert. Die sehr differenzierten Institutionen der stationären Erziehungshilfe bieten ein großes Spektrum von Leistungsangeboten für junge Menschen mit schwierigen Ausgangs- und Lebenslagen und für deren Familien. Die breite Öffentlichkeit hat diese Reformen zumeist nicht erkannt, zu oft wird Heimerziehung noch mit einer unfreiwilligen Fürsorgeerziehung gleichgesetzt, die aber weder im Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII) noch in der Praxis existent ist. Auch aktuell ist die Heimerziehung noch immer eine der häufigsten Formen von Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen.
Indikationen für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
Aus welchen Familien kommen Heimkinder?
Aus welchen Gründen kommen heute Kinder und Jugendliche in Heime und sonstige Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe? Wir wissen aus der Geschichte der Heimerziehung, dass es sich früher fast ausschließlich um elternlose oder um ausgesetzte Kinder handelte. Dies ist aber, nachdem zunächst noch zahlreiche Kriegswaisen nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges beheimatet werden mussten, längst nicht mehr der Fall. Waisenkinder sind in der gegenwärtigen Heimerziehung eine seltene Ausnahme.
Kinder und Jugendliche leben heute in Heimen oder in sonstigen betreuten Wohnformen (Außenwohngruppen, Wohngruppen, Betreutes Wohnen), wenn sie aus sehr unterschiedlichen Gründen in ihrer Herkunftsfamilie vorübergehend oder auf längere Sicht nicht leben können, wollen oder dürfen. Es handelt sich in der Regel um junge Menschen, die aus schwierigen oder aus schwierigsten Verhältnissen stammen. Sie bringen bei der Aufnahme ihre eigene individuelle Lebensgeschichte mit, die manchmal schon auf den ersten Blick sehr erschütternd sein kann. Bisweilen werden traumatische Lebenserfahrungen, langandauernde Frustrationen und Erziehungssowie Erfahrungsdefizite jedoch erst im Laufe des Heimlebens erkennbar.
Die Kinder stammen in der Regel aus unterprivilegierten Bevölkerungsschichten, der Ausbildungsgrad und der berufliche Status ihrer Eltern sind überwiegend gering. Kinder mit einem Stiefelternteil sind besonders häufig. Alkoholoder andere Suchtprobleme spielen in vielen der Familien eine Rolle und zeigen in der Regel negative Auswirkungen auf die dort lebenden Kinder.
Sogenannte Scheidungskinder oder auch Scheidungswaisen sind in der Heimerziehung überrepräsentiert. Kinder und Jugendliche aus gescheiterten Pflegeverhältnissen kommen in den vergangenen Jahren immer häufiger in stationäre Institutionen der Jugendhilfe, insbesondere mit Beginn der Pubertät, wenn neue und möglicherweise auch größere Erziehungsprobleme auftauchen. Viele der Kinder und Jugendlichen haben leidvolle – auch sexuelle – Gewalterfahrungen in ihren Familien erdulden müssen.
Eine Heimeinweisung erfolgt in der Regel nicht beim Erstkontakt mit dem Jugendamt. Oftmals wurden die Schwierigkeiten zuvor vergeblich mit ambulanten Maßnahmen abzubauen versucht. Manche älteren Kinder bzw. Jugendliche melden sich auch selbst beim Jugendamt, weil sie es in ihrer Familie nicht mehr aushalten, weil sie sich zu eingeengt und zu unwohl fühlen und bitten um die Aufnahme in ein Heim oder in eine Wohngruppe.
Im Jahr 2016 hat für insgesamt 61.764 junge Menschen die Hilfe zur Erziehung in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform (wieder) neu begonnen, davon waren 28 % Mädchen. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit ausländischer Herkunft mindestens eines Elternteils betrug 59 %, wobei der erhöhte Anteil auf die hohe Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurückgeht (Statistisches Bundesamt 2018b).
Wie war die Situation in der Herkunftsfamilie?
| Situation in der Herkunftsfamilie |
in % |
| Elternteil alleinlebend |
28 |
| Elternteil mit neuem Partner |
14 |
| Eltern zusammenlebend |
18 |
| Unbekannt |
38 |
| Eltern verstorben |
2 |
Es wird deutlich, dass viele der Kinder und Jugendlichen vor der Aufnahme in eine stationäre Erziehungshilfe nicht in traditionellen Familienkonstellationen gelebt haben (Stephens 2013), sondern ein relativ hoher Anteil bei alleinstehenden Elternteilen bzw. in Stiefelternfamilien aufgewachsen ist (Statistisches Bundesamt 2018b). Die Gefahr der Armut ist in diesen Familienkonstellationen höher, was sich wiederum zu einer höheren Belastung der Familienmitglieder führen kann (Pears/Capaldi 2001). Der hohe Anteil der Fälle, in denen über die Familiensituation vor der Aufnahme ins Heim nicht viel bekannt ist, ist sicher unter anderem auch wieder auf die Situation der geflüchteten jungen Menschen zurückzuführen.
Читать дальше