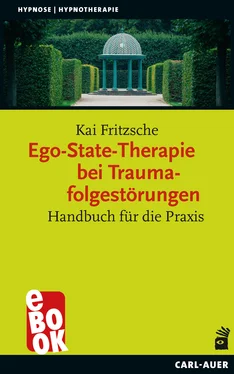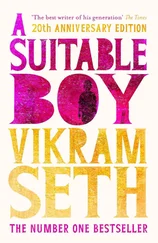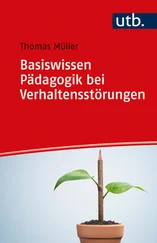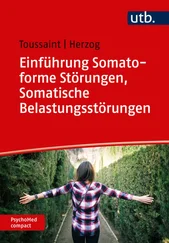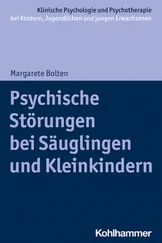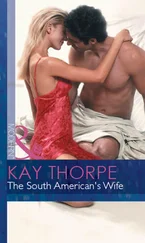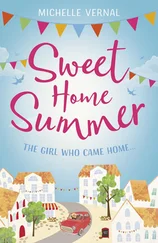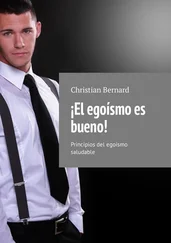1 ...8 9 10 12 13 14 ...21
| Empfehlungen zur Diagnostik von Traumafolgestörungen |
| Typ I |
•CAPS |
( Clinician-Administered PTSD Scale ) |
| •PDS |
( Posttraumatic Diagnostic Scale ) |
| •IES-R |
( Impact of Event Scale, revised ) |
| Typ II |
Speziell auf komorbide Störungen abgestimmt, z. B.: |
| •BDI |
( Back-Depressions-Inventar ) |
| • Hamilton-Depressionsskala |
| Typ III |
•IPDE |
( International Personality Disorder Examination ) |
| •SKID-II |
( Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV ) |
| •SKID-D |
( Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV Dissoziative Störungen ) |
| •SIDES |
( Structured Clinical Interview for Disorders of Extreme Stress ) |
| Typ IV |
•SKID-D |
( Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV Dissoziative Störungen ) |
| •FDS |
( Fragebogen zu Dissoziativen Symptomen ) |
| •DDIS |
( Dissociative Disorders Interview Schedule ) |
Tab. 4: Empfehlungen zur Diagnostik von Traumafolgestörungen (nach Schellong 2013, S. 50)
Kommt eine weitere psychische Erkrankung hinzu, liegt eine Typ-II -Traumafolgestörung vor. Das Störungsbild einer Traumafolgestörung vom Typ III ist durch eine zusätzliche persönlichkeitsprägende Symptomatik mit vorwiegend expansiven Reaktionsmustern gekennzeichnet, die dem impulsiven Verhalten bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ähnelt oder durch internalisierende Persönlichkeitsmerkmale mit negativer, sozialphobischer und dissoziativer Symptomatik imponiert, die häufig von somatoformen Körperbeschwerden begleitet wird. Der schwerste Ausprägungsgrad einer Traumafolgestörung liegt mit dem Typ IV vor. Hier überwiegt die dissoziative Symptomatik einschließlich der Störung der Identitätswahrnehmung mit Amnesien, Teilidentitätsstörungen und Identitätswechseln.
2.3Orientierung entsprechend dem aktuellen Funktionsniveau und der Persönlichkeit
2.3.1Stabilitätskontinuum
Der aktuelle Zustand, die Verfassung, Stabilität, also das Funktionsniveau sowie die gesamte Persönlichkeit unserer Patientinnen und Patienten sind ebenfalls ausschlaggebend für die Orientierung im Bereich der Traumafolgestörungen und deren Behandlung. Wir finden in der Praxis eine große Bandbreite dieser Aspekte vor und müssen darauf entsprechend eingehen.
Zu diesem Zweck ließe sich ein Kontinuum annehmen, dessen linkes Ende durch eine hohe Stabilität und weitere förderliche Faktoren, wie Ressourcen, Zuversicht, soziale Einbindung, finanzielle Sicherheit, bzw. das Fehlen weiterer Störungen oder psychosozialer Stressoren gekennzeichnet ist. Das rechte Ende des Kontinuums wäre durch das Gegenteil geprägt: eine sehr hohe Instabilität, das scheinbare Fehlen von Ressourcen oder protektiven Faktoren, eine starke komorbide somatische und psychopathologische Belastung einschließlich dissoziativer und Persönlichkeitsstörungen, chronische Suizidalität, starke soziale Belastungen wie ein fehlendes soziales Netz, fehlende positive Beziehungen, Täterkontakt, finanzielle Not, finanzielle Abhängigkeit von Tätern, drohender Verlust der Wohnung, abgewiesene Anträge auf Sozialleistungen im Sinne des Opferschutzes oder der Erwerbsunfähigkeit und weitere Schwierigkeiten.
Der Zustand unserer Patientinnen zu Behandlungsbeginn lässt sich auf diesem Kontinuum abtragen und hinsichtlich der Stabilität einschätzen. Wir werden Patientinnen und Patienten begegnen, die sich eher auf der linken Seite des Kontinuums bewegen und durch eine hohe Stabilität und psychische Gesundheit auszeichnen, welche sich aus inneren und äußeren Ressourcen und einer hohen Resilienz speisen. In den meisten Fällen geht es hier eher um Menschen ohne auffällige Vorbelastungen und ohne komorbide Störungen. Der folgende Fall stellt ein Beispiel für diese Gruppe von Patienten dar.
Der junge, sympathische, zugewandte und sportliche Patient hatte gegen seinen Willen eine gewisse Berühmtheit erlangt. Von einem Hai angegriffen zu werden, gehörte nicht zu den alltäglichen Ereignissen der Menschen, die mit ihm zu tun hatten. Er war »der mit dem Hai« , was bei vielen eine gewisse Faszination auslöste, die den Blick auf die von ihm erlebte Lebensbedrohung verstellen kann. Ein solcher Angriff gehörte natürlich auch nicht zu seinen eigenen alltäglichen Erfahrungen. Er stellte für ihn ein Extremereignis dar. Ein stabiles und dichtes soziales Netz hatte bei der Organisation der Hilfemaßnahmen einschließlich der Ermöglichung einer traumatherapeutischen Behandlung gute Dienste geleistet. Der Patient spielte dabei eine wichtige und aktive Rolle. Er habe die unterstützenden Menschen von Anfang an an seiner Seite gespürt und äußerte sich ihnen gegenüber sehr dankbar. Die Liste war lang. Sie umfasste Familienmitglieder ebenso wie seine Lebensgefährtin, befreundete Taucher aus seinem Verein, die bei dem Unfall anwesend waren und vorbildlich reagiert hatten, hinzugerufene Ärzte, weitere an dem Tauchgang und der Rettung Beteiligte, Ärzte der Zweitversorgung sowie Ärzte, Therapeuten und Kollegen an seinem Heimatort. Der Patient berichtete davon, wie viel Glück er gehabt habe und wie gut alles den Umständen entsprechend gelaufen sei. Als angehender Tauchlehrer zeigte er sich auch erfreut, die viel geübten Notfallmaßnahmen für lebensbedrohliche Zwischenfälle beim Tauchen tatsächlich angewandt zu haben. Selbst nach dem Haiangriff konnte er noch unter Wasser für sich sorgen. Er betrachtete sich insgesamt als umsichtig, verantwortungsvoll, aktiv und optimistisch. Tauchen gehörte zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Er hatte diesem Sport viel Zeit und Energie gewidmet und dabei viel Freude erlebt. Seine Herkunftsfamilie stellte für ihn eine große Unterstützung dar. Seine Partnerschaft erlebte er als glücklich und seiner beruflichen Entwicklung blickte er freudig, interessiert und zuversichtlich entgegen.
Nach dem völlig überraschenden lebensbedrohlichen Angriff eines Hais, der eine Schwerstverletzung nach sich zog, das kontrollierte Aufsteigen an die Wasseroberfläche gefährdete, mit einem entsprechend dramatischen Blutverlust verbunden war, zu einem Nahtoderleben führte und das Überleben zunächst ziemlich infrage stellte, ließ sich der Zustand des Patienten während des Erstkontakts in meiner Praxis als erfreulich stabil einschätzen. Die Behandlungsziele konnten sehr differenziert aufgestellt werden. Die Behandlung erwies sich als überaus konstruktiv. Sie ließ sich zügig und ohne Komplikationen durchführen. Der Patient zeigte sich durchgehend optimistisch, was ihm deutlich dabei half, sich in der Therapie mit dem Unfall auseinanderzusetzen und sich dem traumatischen Geschehen und seinen Folgen zu stellen.
Der Fall ist ein Beispiel für Patienten des linken Bereichs des Stabilitätskontinuums . Ich bin beeindruckt von den vielen inneren und äußeren Ressourcen, die ihm den Weg der Bewältigung erleichterten. Durch eine chirurgische Meisterleistung konnte eine Amputation vermieden werden. Der Fall erinnert mich an die Zeit meiner Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin, in der es um die Erforschung der zugrunde liegenden Prozesse und Behandlungsmöglichkeiten von Phantomschmerz ging. Für dieses Vorhaben benötigten wir Daten von Menschen mit entsprechenden Schmerzen, Menschen, die mit einer Amputation und deren Folgen konfrontiert wurden. Das neurowissenschaftliche Studiendesign war sehr aufwendig, die Ausschlusskriterien scheinbar endlos. Aus meiner heutigen Perspektive wirkt es etwas befremdlich, aber wir suchten letztlich nach Menschen mit Phantomschmerzen, die sonst völlig gesund sein sollten. Es gab sie. Aber es gab auch diejenigen, die infolge der Amputation und der Umstände, die dazu geführt hatten, offensichtlich deutlich traumatisiert waren, eine schwere, teilweise komplexe Traumafolgestörung entwickelten und zusätzlich unter einer Reihe von weiteren Störungen und Belastungen litten. Es gab auch hier ein Kontinuum der Stabilität (und Gesundheit), es gibt Menschen, die weit entfernt von einem stabilen Zustand sind und von denen ich nach meiner Dissertation in meiner neu gegründeten Praxis mehr und mehr behandelte. Wir begegnen Patienten, die zunächst eher im rechten Bereich des Stabilitätskontinuums anzusiedeln sind und die eine andere Orientierung unsererseits benötigen. Das folgende Beispiel zeugt von dieser Gruppe Patientinnen.
Читать дальше