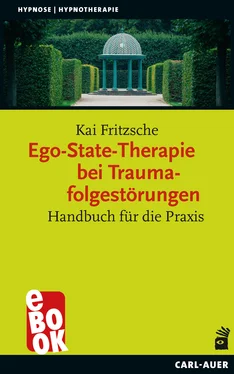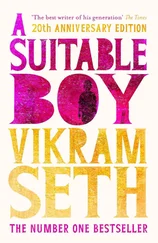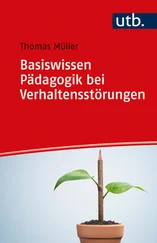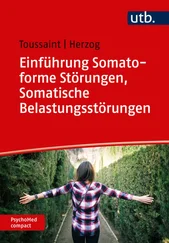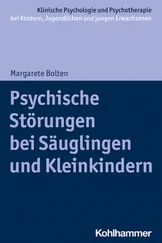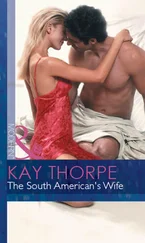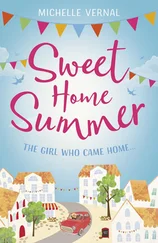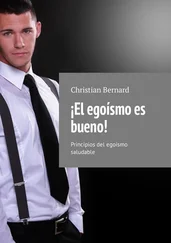1 ...7 8 9 11 12 13 ...21 Für das ICD-11 werden folgende Beispiele angeführt (Pfeiffer, de Haan u. Sachser 2019, S. 42):
•direktes Erleben von durch Menschen verursachten Katastrophen oder Naturkatastrophen, Krieg, schweren Unfällen, Folter, sexueller Gewalt, Terrorismus, körperlicher Gewalt oder lebensbedrohlichen Krankheiten
•Zeugenschaft von bedrohlicher oder plötzlicher Verletzung oder vom Tod anderer in einer unerwarteten oder gewaltsamen Weise
•Erfahren über den unerwarteten oder gewaltsamen Tod eines geliebten Menschen
Martin Sack (2013, S. 14) schlägt eine Ergänzung der Traumadefinition vor, die Vernachlässigung und psychische Gewalt einbezieht:
»Die betroffene Person war Situationen ausgesetzt, in denen die folgenden Bedingungen erfüllt waren:
•Die Person war in ihrer Kindheit wiederholt Situationen emotionaler oder physischer Vernachlässigung ausgesetzt oder wurde wiederholt vorsätzlich und ohne Grund entwertet, gedemütigt oder angeschrien.
•Die betroffene Person reagierte mit starker Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen.«
Der wissenschaftlichen und vermeintlich nüchternen Definition und Betrachtung von traumatischen Ereignissen und ihren Folgen steht das traumatische Erleben betroffener Menschen gegenüber. Die Orientierung wird häufig schwierig, wenn wir auf eine (teilweise extrem ausgeprägte) Kombination, Häufung oder Ausprägung (Intensität) von Traumata stoßen. Nüchtern hieße es: Multitrauma oder Komplextrauma . Was dies für das Leben und die Entwicklung der betroffenen Person bedeutet, ist damit noch nicht beantwortet. Vielleicht geht es hier mehr um eine Sensibilisierung als um eine Orientierung im engeren Sinne.
Hecker und Maercker (2015, S. 549) geben über alle Studien und Traumaarten zusammengefasst eine bedingte Wahrscheinlichkeit, eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, von 8 bis 15 % an. Die bedingten Wahrscheinlichkeiten sind in verschiedenen Ländern annähernd gleich hoch:
•ca. 50–65 % nach direktem Kriegserleben als Zivilist
•ca. 50 % nach Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch
•ca. 25 % nach anderen Gewaltverbrechen
•ca. 5 % nach schweren Verkehrsunfällen
•unter 5 % nach Natur-, Brand- und Feuerkatastrophen
•unter 5 % bei Zeugen von Unfällen und Gewalthandlungen
Traumata sind ihrem Wesen nach unerträglich, schreibt Bessel van der Kolk (2017, S. 9). Entsprechend viel Aufwand wird von betroffenen Menschen betrieben, all das, was mit Trauma und Traumafolgen zu tun hat, aus ihrem Bewusstsein, aus ihrem Leben zu verbannen, um jeden Preis. Sie zahlen in einer spezifischen Währung. Die Währung besteht aus den Strategien, sich selbst vor dem eigenen Schrecken zu schützen, zu distanzieren, in Sicherheit zu bringen. Die Strategien sind für die Patienten nicht verhandelbar. Sie lassen sich nicht »auf Zuruf« verändern. Sie können bewusst oder unbewusst sein und ermöglichten die Bewältigung des traumatischen Ereignisses.
Hinsichtlich der Orientierung und Topografie lassen sich hier bei Patientinnen und Patienten deutliche und für die Behandlung wichtige Unterschiede finden. Der Behandlungsverlauf bei Betroffenen, die sich gut gewappnet und sicher ihrem traumatischen Ereignis stellen können und wollen, sieht anders aus als der von Patientinnen, denen dies nicht möglich ist. Ebenso wie im Hinblick auf die Diagnosen der Traumafolgestörungen und unterschiedlicher Störungsbilder finden wir auch im Bereich der traumatischen Ereignisse Unterscheidungen und somit Entscheidungshilfen für die Behandlungsplanung. Die Art der Traumatisierung, der Zeitpunkt, der Zeitraum, die Umstände, die Verfassung der jeweiligen Person und das Umfeld spielen eine wichtige Rolle.
Die betroffenen Menschen fragen sich, warum sie dem inneren Schrecken nicht entkommen können, warum sie immer wieder daran erinnert werden, warum sie nicht zur Ruhe kommen. Sie erleben, wie sie die Kontrolle über sich selbst und ihr eigenes Leben verlieren, und sie erleben, wie sich ihre Identität verändert oder bei manchen zu verabschieden scheint. Sie schämen sich angesichts ihrer Traumata und ihrer Traumafolgestörung. Scham ist eine zusätzliche Bürde, die im Behandlungsprozess einen angemessenen Raum benötigt. Sie tritt sowohl aufgrund des Erlittenen auf als auch aufgrund von Taten, die Patienten begangen haben oder zu denen sie gezwungen wurden und die nicht mit ihrem eigenen Selbst- und Weltbild vereinbar sind.
Patientinnen kennen die erneute Erniedrigung und die Ohnmacht, die beispielsweise in einem Begutachtungsverfahren oder einem juristischen Verfahren ausgelöst werden können. Diese Prozedere glichen ihren Einschätzungen nach eher einem Casting , bei dem man erneut keine Chancen hat und das nicht selten bizarre Einschätzungen zutage fördert. Die Tatsache, dass Menschen grundsätzlich in der Lage sind, potenziell traumatisierende Ereignisse zu bewältigen, ohne eine Traumafolgestörung zu entwickeln, lastet zusätzlich auf vielen Patienten, da sie sich unter anderem fragen, warum gerade sie diese Störung entwickelt haben, während andere, die Vergleichbares erlebten, »besser« waren, ohne Schaden davonkamen.
Ich erachte es als selbstverständlich, die von Patientinnen erlebten traumatischen Ereignisse in Bezug zu ihrer Biografie einschließlich psychischer, somatischer, persönlichkeitsbezogener, sozialer, gesellschaftlicher und kultureller Faktoren zu bringen. Die mitunter fehlende Anerkennung der erfahrenen Gewalt, Vernachlässigung und des Unrechts sowie fehlende Würdigung des Leids können eine zusätzliche Belastung darstellen und den Heilungsprozess deutlich erschweren.
Leonore Terr schlug 1991 als Erste die Unterscheidung zwischen Trauma-Typ I und Trauma-Typ II vor (Streeck-Fischer 2011, S. 450).
Der Trauma-Typ I bezieht sich auf akute und einmalige Traumatisierung, der Trauma-Typ II auf die Folgen chronischer bzw. multipler Traumatisierung (Streeck-Fischer 2011, S. 450).
Die Traumatypen haben einen hohen therapiepraktischen Wert, da sich die Behandlungspläne je nach Typ voneinander unterscheiden. Die Differenzierung und Berücksichtigung der spezifischen Folgen von sogenannten Man-made disasters (interpersonell) , d. h. menschlich verursachten Traumatisierungen, gegenüber Traumatisierungen, die nicht gezielt von Menschen ausgingen, wie beispielsweise Naturkatastrophen (akzidentell) , dient ebenso der Orientierung in einer Traumalandschaft (Hecker u. Maercker 2015, S. 549).
Schellong stellt eine Erweiterung der Trauma-Typen vor, die das breite Störungsspektrum abbildet und auf die Notwendigkeit angepasster Behandlungspläne verweist (Schellong 2013, S. 47). Sie unterteilt die Traumafolgestörungen nach einem intensiven Dialog mit Praktikerinnen in vier Typen:
| •Typ I |
»einfache« posttraumatische Belastungsstörung |
| •Typ II |
Posttraumatische Belastungsstörung oder partielle posttraumatische Belastungsstörung »plus« traumakompensatorische Symptomatik |
| •Typ III |
Posttraumatische Belastungsstörung oder partielle posttraumatische Belastungsstörung »plus« persönlichkeitsprägende Symptomatik |
| •Typ IV |
Posttraumatische Belastungsstörung oder partielle posttraumatische Belastungsstörung »plus« komplexe dissoziative Symptomatik |
Die Übersicht in Tab. 4zeigt die Empfehlungen zur Diagnostik der Traumafolgestörungen entsprechend den vier Typen. Bei Typ I handelt es sich meist um ein einzelnes potenziell traumatisches Ereignis, das eine Traumafolgestörung nach sich zieht. Hier stehen Symptome der klassischen Symptomtrias im Vordergrund: Intrusion, Vermeidung und/oder Numbing sowie Hyperarousal. Die weitere Typisierung folgt nach Schellong einem »Add-on«-System im Sinne einer »Plus«-Symptomatik.
Читать дальше