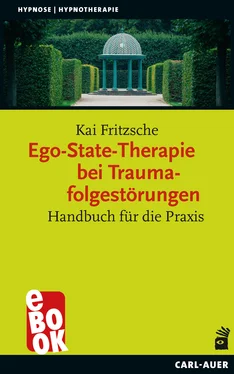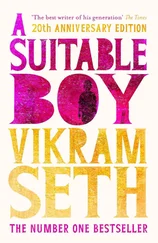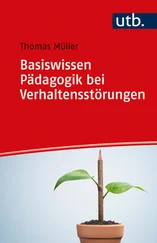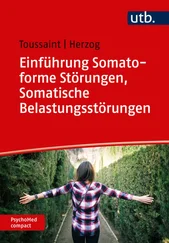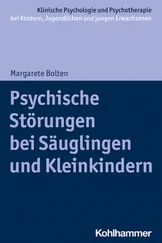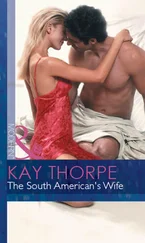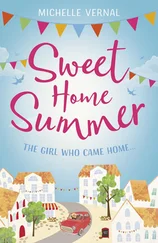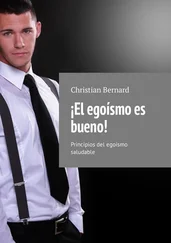Die Patientin berichtet von ihren Erinnerungen aus dem Luftschutzkeller am Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Angriffe konnten jederzeit erfolgen. Es herrschte tiefste Verunsicherung und Panik und es war nicht klar, wie viele dieser Bombardierungen sie noch überleben würden. Es war kein guter Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen, und nicht die Art, auf der Welt willkommen geheißen zu werden, die sich Eltern für ihr Kind gewünscht hätten. Abgesehen von den Belastungen durch die Abwesenheit des Vaters und der Angst um ihn stellte eine bedingungslose mütterliche Zuwendung für das Kind in dieser anhaltend lebensbedrohlichen Situation einen Luxus dar, der für die Mutter unerreichbar war. Die Kriegserlebnisse sollten das Kind ein Leben lang begleiten, man könnte sagen: verfolgen.
Würden sich nun psychische, somatische und soziale Probleme unabhängig davon betrachten lassen? Die Spätfolgen von Kindheitstraumatisierungen und transgenerativen Traumatisierungen sind gut untersucht und zeigen uns, welche Auswirkungen derartige Erlebnisse haben. Lassen sich andererseits sämtliche Probleme im Leben auf diese Erlebnisse zurückführen? Besteht das Risiko einer Art »Generalerklärung«? In dieser Hinsicht ist ein behutsames Vorgehen wichtig, durch das voreilige Schlüsse und Beurteilungen vermieden werden. In den Fällen, in denen es kein bedrohungsfreies Vorher gibt, in denen das Leben mit Traumatisierungen begann, ist ein trauma- und generationssensitiver Umgang mit den verschiedenen Beschwerdebereichen und Problemen notwendig.
Viele traumatisierte Menschen verlieren ihren Bezug zur Welt. Sie verlieren ein Sicherheitsgefühl, ein Gefühl, sich selbstbestimmt in der Welt bewegen zu können, das eigene Leben und die Welt gestalten und anderen Menschen vertrauen zu können. Sie verlieren ebenso den Bezug zu sich selbst, zu ihrem Körper, zu ihrer Identität. Sie verlieren den Bezug zu ihrer Würde, zu ihren Überzeugungen und zu ihren Gefühlen. Das Erleben, plötzlich im fortgeschrittenen Lebensalter mit einer ganz anderen Biografie konfrontiert zu sein, völlig anders, als die eigene Geschichte bis dahin erinnert wurde, stellt eine Extrembelastung für Betroffene dar, wie im zweiten Beispiel deutlich wird.
Die Patientin sollte zwecks einer Burn-out-Prophylaxe eine Rehabilitationsbehandlung absolvieren. Dies war fast ein Standardvorgehen nach vielen Jahren engagierter und verantwortungsvoller Tätigkeit. Dann sei es gut, einmal auszusteigen, auch etwas für den Körper zu tun und die Anzeichen von Überarbeitung ernst zu nehmen. Früher hätte man gesagt: »Sie müssen mal zur Kur.« Was sich anschließend ereignete, hatte mit Kur nicht viel zu tun. Im Laufe der stationären Rehabilitationsbehandlung brachen bei der Patientin unkontrolliert Traumaerinnerungen hervor, so heftig und so schrecklich, dass die Patientin sicher war, nun verrückt geworden zu sein. Das Erinnerungsmaterial wurde jedoch derart deutlich und bezüglich ihrer Biografie eindeutig, dass die Patientin plötzlich mit einem völlig anderen Lebenslauf konfrontiert war, anders als der, den sie bis dahin verinnerlicht hatte. Sie schien nun jemand anderes zu sein: Ein Mensch, dem diese schrecklichen, nicht aussprechbaren Dinge passiert sind. Sie war nicht mehr die Person, die mit solchen Sachen nichts zu tun hatte. Sie hatte den Eindruck, somit auch nicht mehr liebenswert zu sein und die Eigenschaften verloren zu haben, die sie sich bis dahin zugeschrieben hatte, wie mitfühlend, hilfsbereit, verantwortungsvoll, engagiert, interessiert und kreativ. Sie hatte vielmehr den Eindruck, verachtenswert und unwürdig zu sein, nicht mehr dazuzugehören, das Recht auf Gleichbehandlung und Würde verloren zu haben. Die Patientin erlebte den Ausbruch der traumatischen Erinnerungen wie eine Art doppelte Buchführung. Es gab nun zwei Lebensverläufe, zwei Entwicklungen, zwei Identitäten. Es ging hier nicht um eine dissoziative Aufteilung der Persönlichkeit, sondern um das Realisieren und die Akzeptanz einer traumatisierten Biografie sowie um den Verlust einer unversehrten Lebensgeschichte.
Verschiedene biografische Zeitpunkte, Zeiträume und Zeitebenen werden je nach Relevanz in die Behandlung einbezogen: Solche,
a)in denen Traumatisierungen stattfanden
b)in denen Patientinnen keinen Zugang zu traumatischem Material hatten und ihnen das Vorliegen einer Traumafolgestörung nicht bewusst war
c)in denen sich Patienten gegen das Vorliegen einer Traumafolgestörung innerlich wehren
d)in denen sich die Symptome der Traumafolgestörungen spürbar entwickelten, d. h., dass den Patienten klarwurde, dass eine solche Störung vorliegt
e)unbelastete Zeiten vor den Traumatisierungen
f)das gegenwärtige Erleben
g)angestrebtes Erleben (zukünftig).
Vielleicht versuchen wir es mit einigen Basics :
1)Komplexe Traumafolgestörungen haben einen Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit und können Persönlichkeitsveränderungen sowie Persönlichkeitsstörungen nach sich ziehen, das heißt verursachen.
2) Traumafolgestörungen (Typ I und Typ II) können weitere psychische und somatische Erkrankungen sowie soziale Schwierigkeiten verursachen und deren Verlauf erschweren bzw. die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass solche auftreten.
3)Psychische und somatische Erkrankungen, einschließlich der Persönlichkeitsstörungen, können die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer Traumafolgestörung erhöhen und deren Verlauf erschweren.
4)Im Hinblick auf die transgenerative Weitergabe von Traumafolgestörungen haben sowohl diese als auch weitere psychische und somatische Störungen einen Einfluss auf das Auftreten und den Verlauf einer Traumafolgestörung der folgenden Generation.
5)Die Wahrscheinlichkeit der Ausprägung einer traumatischen Erkrankung steigt, je mehr sich traumatische Erfahrungen aneinanderreihen. Menschen werden nicht besser in der Bewältigung von traumatischen Ereignissen, sondern schlechter.
6)Die Frage, welcher Patient nach welchem Ereignis eine Traumafolgestörung entwickelt, ist nicht eindeutig zu beantworten.
2.4Orientierung mittels Klassifikation von Traumafolgestörungen
Für die traumatherapeutische Praxis sind die Fragen der diagnostischen Einordnung äußerst wichtig. Sie sind für die Behandlung wegweisend, helfen dabei, Entscheidungen über die Gewichtung der Behandlungsphasen (zum Beispiel den Umfang der Stabilisierungsphase), die Integration weiterer Behandlungsbereiche (zum Beispiel den Exkurs Schuld, Trauer oder die Therapie von Persönlichkeitsstörungen) sowie spezifischer traumatherapeutischer Interventionen (zum Beispiel die Konfrontation/Beobachtertechnik) zu fällen.
Als die am häufigsten verwendete Orientierungshilfe in der Behandlung von Traumafolgestörungen kann die Unterteilung von Störungsbildern und entsprechenden Diagnosen angesehen werden. Eine differenzierte Klassifikation und das Bemühen um die Festlegung einer Diagnose sind aus vieler Hinsicht notwendig und hilfreich. Sie erlauben Aussagen und Entscheidungen über das therapeutische Vorgehen, den Behandlungsplan sowie einzelne spezifische Interventionen. Weiterhin erleichtern sie die Abschätzung einer Prognose und schützen vor unangemessenen Zielvorstellungen. Nicht zuletzt stellen sie eine Anerkennung des Geschehenen und der Folgen dar. Diagnosen sind nicht als Stempel oder Stigmata zu verstehen. Sie sind jedoch, wie in vielen Bereichen der klinischen Psychologie und Medizin, für eine fundierte und verantwortungsvolle Behandlung notwendig. Wenn ein Onkologe dem mit einer Krebserkrankung konfrontierten Patienten erklären würde, dass er nicht so genau wisse, unter welcher Form der Krebserkrankung er leide und welche Tumor-Art vorläge, dass es aber auch nicht so sehr auf die genaue Diagnose ankäme, da diese ohnehin relativ sei und überbewertet werde, wäre der Patient verständlicherweise höchst beunruhigt.
Читать дальше