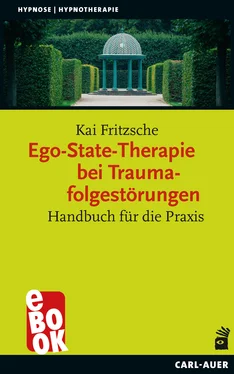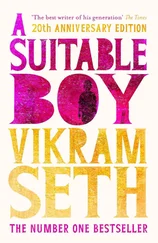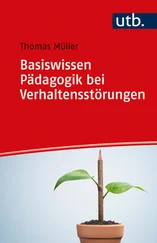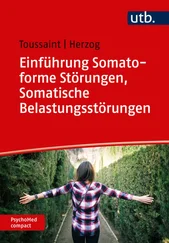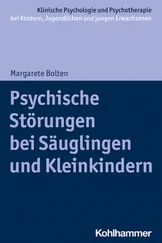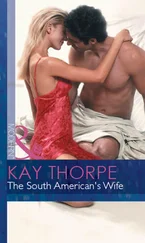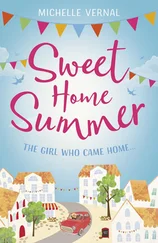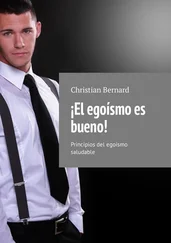Die Klassifikation und Diagnosestellung einer Traumafolgestörung in Verbindung mit einer angemessenen Psychoedukation kann Patientinnen erleichtern und ihnen Hoffnung geben, zum Beispiel, indem sie plötzlich ihre Symptome besser verstehen und einordnen können und indem ein konkreter Behandlungsplan abgeleitet werden kann. Sie kann sie jedoch in gleichem Maße stark verunsichern. Diagnosen können sehr erschrecken, einen Abgrund oder ein schwarzes Loch öffnen, vor denen viele Patienten verständlicherweise große Angst haben und die sie mit absolut besorgniserregenden Attributen verbinden, wie zum Beispiel bei der Diagnose einer Dissoziativen Identitätsstörung (DIS).
Im Fall von Hoffnung erhöhen sich Stabilität und Behandlungsmotivation deutlich, was die psychotherapeutischen Bemühungen entsprechend erleichtert. Im Fall von Erschrecken kann eine nachvollziehbare Aversion für erhebliche Behandlungsschwierigkeiten sorgen, beispielsweise allein schon deshalb, weil die Diagnose nicht wahr sein darf .
Die Diagnose einer Traumafolgestörung kann ungünstigenfalls einen prägenden Einfluss haben, wenn Patientinnen beispielsweise annehmen, dass sie nun unheilbar krank seien, sich alle Menschen von ihnen abwenden würden und ihr Leben auf dem absteigenden Ast besiegelt sei . Nicht zuletzt sind diagnostische Einordnungen für eine differenzierte Selbsthilfe hilfreich, da die Patienten wissen, worum es geht, wonach sie suchen müssen und welche Ansprechpartner neben der Therapeutin infrage kommen. Sie können nach Menschen mit ähnlichen Erfahrungen suchen, die beispielsweise im Heilungsprozess schon einige Schritte voraus sind, ihnen davon berichten und ihnen Mut machen.
Wir brauchen also eine Idee von dem, worunter unsere Patientinnen und Patienten leiden. Wir brauchen dafür Worte, wir brauchen Vergleichs- und Zuordnungsmöglichkeiten, ohne dabei Stempel, Schubladen und starre Kategorien zu verwenden. Wir brauchen Entscheidungshilfen, die die Auswahl der Interventionen ermöglichen und uns den Weg durch die Behandlung zeigen. Diese Wege unterscheiden sich drastisch voneinander und hängen von sehr vielen Faktoren ab. Im Folgenden wird ein Überblick über die diagnostischen Kategorien gegeben.
2.4.1Spezifisch belastungsbezogene psychische Störungen
In die ICD-11, die im Mai 2019 verabschiedet wurde und ab 2022 in Kraft treten soll, wurde erstmals eine Kategorie der » spezifisch belastungsbezogenen psychischen Störungen « aufgenommen (siehe Übersicht in Tab. 1). In dieser Kategorie werden Störungsbilder zusammengefasst, die als direkte Folge des Erlebens verschiedener Arten von Belastungen entstehen können (Lotzin, Mauer u. Köllner 2019, S. 32). In die ICD-11 wurden neue Diagnosekonzepte eingeführt, die dazu beitragen, das breite Spektrum dieser Störungen besser abzubilden.
Die wichtigste Neuerung stellt aus meiner Sicht die lange überfällige Einführung der Diagnose der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung dar, die Judith Herman bereits Anfang der 1990er-Jahre vorgeschlagen hatte. Die Behandlung von Menschen mit dieser Störung machte und macht einen Großteil der psychotherapeutischen Arbeit von Traumatherapeuten aus, ohne dass sie bisher eindeutig diagnostizierbar war, d. h., ohne dass eine offizielle diagnostische Kategorie existierte. Die diagnostische Zuordnung war durch die bisherigen Klassifizierungsrichtlinien nur unzureichend möglich (Schellong 2013, S. 43). Sie geschah auf Umwegen und mittels Restkategorien, Ergänzungen oder phänomenologischen Beschreibungen. Eine klare diagnostische Definition komplexer Traumafolgestörungen ist nicht nur für die Forschung unabdingbar, sie ist ebenfalls für die traumatherapeutische Praxis essenziell.
Entsprechend der neuen Diagnosekonzeption der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung müssen zusätzlich zu den drei Kernsymptomen einer PTBS:
a)Wiedererleben des Ereignisses
b)Vermeidung von Gedanken oder Aktivitäten, die an das Ereignis erinnern, und
c)ein anhaltendes Gefühl einer erhöhten Bedrohung
drei weitere Schwierigkeiten zutreffen:
d)Schwierigkeiten in der Emotionsregulation
e)negative persönliche Grundüberzeugungen und
f)Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten oder sich anderen nahe zu fühlen.
Fakultativ wurde die Dissoziationsneigung mit aufgenommen (Hecker u. Maercker 2015, S. 554).
Die anhaltende Trauerstörung wurde ebenfalls neu in die ICD-11 aufgenommen. Sie beschreibt eine Störung, bei der Betroffene nach dem Tod eines Partners, Elternteils, Kindes oder einer anderen nahestehenden Person mit anhaltender und tiefgreifender Trauer reagieren, die über eine normale Trauerreaktion deutlich hinausgeht (Lotzin, Mauer u. Köllner 2019, S. 34).
Bei den in der ICD-10 bestehenden Diagnosekonzepten wurden deutliche Veränderungen vorgenommen.
Die Konzeption des Traumakriteriums einer PTBS wurde dahingehend verändert, dass es in der ICD-11 weniger eng gefasst wird. Der bisher gültige Zusatz, dass das traumatisierende Ereignis » … nahezu bei jedem eine tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde «, wurde gestrichen. Weiterhin wurden die Symptomkriterien auf die zentralen Symptome komprimiert sowie die Lockerung des Zeitkriteriums vorgenommen.
Eine Modifizierung und Aktualisierung wurde auch für die Anpassungsstörung vorgenommen, die bisher vor allem als Verlegenheitsdiagnose galt. Bis zum Erscheinen des ICD-11 waren für die Anpassungsstörung keine positiv formulierten Symptomkriterien festgelegt, was u. a. die Abgrenzung zu weiteren Störungsbildern, wie Depression und Ängsten, erschwerte. Sie wurde als Ausschlussdiagnose für die Fälle genutzt, in denen die Kriterien anderer, spezifischer Störungen nicht erfüllt waren (Bachem, Lorenz u. Köllner 2019, S. 37). Maercker, Einsle u. Köllner (2007, zit. n. Bachem, Lorenz u. Köllner 2019) entwickelten ein neues Konzept der Anpassungsstörungen, in dem zwei Hauptsymptomgruppen definiert werden: (1) Präokkupation als gedankliches Verhaftetsein sowie (2) Fehlanpassung in Form von Interessenverlust gegenüber Arbeit, dem sozialen Leben, der Beziehung zu anderen und Freizeitaktivitäten, einschließlich möglicher Konzentrations- und Schlafprobleme. Die Diagnosekriterien nach ICD-11 umfassen:
a)maladaptive Reaktionen auf einen einzelnen oder mehrere psychosoziale Stressoren, die innerhalb eines Monats auftreten
b)Präokkupationen mit dem Stressor oder seinen Konsequenzen
c)Fehlanpassung
d)signifikante Beeinträchtigung in wichtigen Funktionsbereichen
e)die Symptome erfüllen nicht die Kriterien einer anderen psychischen Störung (Bachem, Lorenz u. Köllner 2019, S. 38).
Zwei weitere diagnostische Kategorien werden in die Gruppe der Belastungsstörungen aufgenommen: die reaktive Bindungsstörung sowie die Beziehungsstörung mit Enthemmung , beides Störungen des Kindesalters, die ausschließlich in den ersten fünf Lebensjahren diagnostiziert werden können. Kinder, die eine reaktive Bindungsstörung entwickelt haben, zeigen kaum sicherheitssuchendes Verhalten gegenüber Fürsorgepersonen und suchen diese selten auf, um Trost, Unterstützung oder weitere Formen von Fürsorge zu erhalten. Bei Kindern mit einer Beziehungsstörung mit Enthemmung zeigt sich das gegenteilige Bild. Ihr Verhalten ist durch ein nahezu wahlloses und vertrauensvolles Verhalten gegenüber Erwachsenen geprägt (Lotzin, Mauer u. Köllner 2019, S. 35).
2.4.2Dissoziative Störungen
Die diagnostische Einordnung dissoziativer Störungen in den Diagnosesystemen DSM und ICD ist uneinheitlich. Hauptsächlich geht es dabei um die Klassifikation der Konversionsstörungen , die im DSM kategorial von den dissoziativen Bewusstseinsstörungen abgegrenzt sind, während beide Störungsgruppen im ICD zusammengefasst werden (Hoffmann u. Eckhardt-Henn 2004, S. 308). Ein weiterer Unterschied besteht in der Klassifikation der Depersonalisationsstörung , die im DSM-IV den dissoziativen Störungen und im ICD-10 anderen neurotischen Störungen (F48) zugeordnet ist. Auch Spitzer u. Freyberger erachten die Unterscheidung der zwei Gruppen: dissoziative Bewusstseinsstörung sowie Konversionsstörung als sinnvoll (Spitzer u. Freyberger 2011, S. 233).
Читать дальше