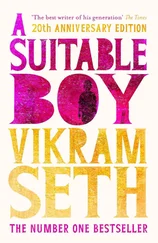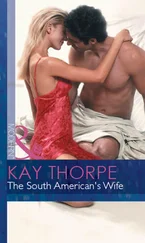Die sehr verunsicherte und ängstliche Patientin berichtete im Erstgespräch distanziert und völlig unzusammenhängend von einer großen Zahl an Symptomen, Beschwerden, Krankheitsbildern und Belastungsfaktoren. Anfangs schien es unmöglich, einen Überblick über ihren Zustand, ihre Lebenssituation und über ihre Biografie zu erhalten. In den jeweils folgenden Sitzungen konnte sie sich nicht mehr an die vorherigen Sitzungen erinnern. Es hatte zum Teil den Anschein, als hätte sie weder meine Praxis noch mich schon einmal gesehen. Zu manchen Sitzungen erschien sie extrem verängstigt und wirkte kindlich. Zu anderen Sitzungen erschien sie sehr erwachsen, kompetent und nüchtern, dann wieder jugendlich cool und kraftstrotzend. Auffällig blieben die Erinnerungslücken und die Schwierigkeiten mit den Terminvereinbarungen. Allein schon das Setting der Therapie zu gestalten, erwies sich als große Herausforderung. Die Patientin, die unter einer Dissoziativen Identitätsstörung (DIS) litt, hatte keine zusammenhängenden Erinnerungen. Jede ihrer Persönlichkeiten erinnerte – wenn überhaupt – jeweils nur die Sitzung und die Zeit, in der sie anwesend war.
Wir standen anscheinend vor einem Paradox: Um die ambulante psychotherapeutische Behandlung in dem Setting und in der Art und Weise durchführen zu können, wie sie gedacht war und empfohlen wird, hätte die Patientin deutlich stabiler (gesünder) sein müssen. Ich hätte sie mit dem Hinweis wegschicken müssen, erst einmal etwas gesünder zu werden, bevor ich sie anschließend behandeln könnte. Sie gehörte zu der Gruppe von Patientinnen, bei denen aufgrund der Instabilität und der therapiegefährdenden Faktoren eine ambulante traumatherapeutische Behandlung fraglich ist. Eine Klinikbehandlung, die an dieser Stelle vielleicht sofort als Lösung ins Auge springt, zeigte sich als unrealistisch, da die Patientin erstens von traumatisierenden Ereignissen während eines solchen Aufenthaltes berichtete und da dies zweitens für sie als alleinerziehende Mutter kaum möglich schien. (Wahrscheinlich fragen Sie sich, wie ein Leben als alleinerziehende Mutter mit einer solchen Traumafolgestörung funktionieren kann.) Wir entschieden uns für den ambulanten Behandlungsversuch und arbeiteten sozusagen gegen das innere und äußere Chaos der Patientin, besser gesagt: wir arbeiteten mit diesem Chaos. Schwere dissoziative Störungen wechselten ab mit weiteren extremen Symptomen der Traumafolgestörungen, erheblichen Schwierigkeiten im Zusammenleben mit den Kindern, bedrohlichen finanziellen Sorgen und vielem mehr. Von Stabilität konnte trotz eines großen Helfernetzes vorerst keine Rede sein.
2.3.2Komorbide und Persönlichkeitsfaktoren
Neben der Frage des aktuellen Zustandes der Patienten gibt es noch weitere wichtige Aspekte für die Orientierung:
•komorbide bzw. zusätzliche Störungen, einschließlich der Persönlichkeitsveränderungen und Persönlichkeitsstörungen,
•prä-, peri- und posttraumatische Faktoren.
Als komorbide Störungen werden dissoziative Störungen, depressive Störungen, Somatisierungsstörungen, Essstörungen, Angststörungen, Zwangsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, Substanzmissbrauch, Suchterkrankungen, Störungen der Affektmodulation und Impulskontrolle, psychotische Störungen, Persönlichkeitsveränderungen und Persönlichkeitsstörungen genannt (Hecker u. Maercker 2015, S. 552; Dammann u. Overkamp 2004, S. 14; Senger 2019, S. 12). Die Liste möglicher physischer bzw. somatischer Folgen , die bei traumatisierten Patientengruppen im Vergleich häufiger nachgewiesen werden konnten, ist lang: erhöhtes Waist-Hip-Ratio 2, Adipositas, Hypertonus, Dyslipidämien (Fettstoffwechselstörung), kardio- und zerebrovaskuläre Erkrankung, Tachykardie, metabolisches Syndrom, nicht zirrhotische Lebererkrankungen, Diabetes mellitus, frühzeitiger Tod, Infektanfälligkeit, Magengeschwüre, HIV-seropositiver Status, rheumatoide Arthritis, Psoriasis, Schilddrüsenerkrankungen, chronische Schmerzen, Fibromyalgie-Syndrom, muskuloskelettale Fehlfunktionen, Knochendemineralisation, Osteoarthritis und Schlafstörungen (Langheim 2019, S. 56). Die Angaben basieren auf einer klaren Vorher-nachher-Einschätzung und beschreiben psychische und somatische Erkrankungen, die sich als Folge von Traumatisierungen bzw. im Zusammenhang mit Traumafolgestörungen entwickeln.
Bei der Behandlung von Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen einschließlich komplexer dissoziativer Störungen, die einen hohen Grad an Komorbidität aufweisen, finden wir hinsichtlich der zusätzlichen Erkrankungen sowie der beeinflussenden und möglicherweise erschwerenden Faktoren eine Schwierigkeit, die man als Henne-oder-Ei-Problem beschreiben könnte. Was war zuerst? Lag beispielsweise eine Depression oder eine Persönlichkeitsstörung bereits vor dem traumatischen Geschehen vor und erhöhte die Wahrscheinlichkeit der Ausbildung einer Traumafolgestörung bzw. erschwerte die Symptomatik dieser Störung oder führten die meist frühen komplexen Traumatisierungen zusätzlich zu einer depressiven Störung, Persönlichkeitsveränderungen oder Persönlichkeitsstörungen?
Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, dass frühere Traumatisierungen die Wahrscheinlichkeit der Ausprägung einer Traumafolgestörung nach erneuter Traumatisierung erhöhen, was auch als Bausteineffekt (»building block«) beschrieben wird (Hecker u. Maercker 2015, S. 550).
Bei Typ-I-Traumatisierungen im Erwachsenenalter lassen sich diese Fragen am einfachsten beantworten, da sich das Leben und das Befinden vor dem Trauma gut explorieren lassen. Gab es psychische oder somatische Erkrankungen vor der Traumatisierung? Das Fehlen von psychischen, somatischen oder sozialen Störungen bzw. Belastungen vor einer Traumatisierung bedeutet jedoch nicht, dass die Traumafolgestörung automatisch milder verläuft. Es bedeutet nicht, dass die Symptome in diesem Fall weniger stark ausgeprägt wären.
Eine Vorher-während-und-nachher-Betrachtung sollte in jedem Falle durchgeführt werden, da prä -, peri - und posttraumatische Faktoren die Entwicklung, die Schwere und den Verlauf einer Traumafolgestörung beeinflussen können (Hecker u. Maercker 2015, S. 550). Der Blick richtet sich gleichermaßen auf Störungen bzw. erschwerende Faktoren wie auch auf Ressourcen.
Einerseits liefert die Orientierung auf die verschiedenen Zeiträume bzw. Zeitpunkte Hinweise zu möglichen Risikofaktoren, andererseits bieten sie die Möglichkeit der Ressourcensuche. Ressourcen aus der Zeit vor einer Traumatisierung sind wichtige unterstützende Faktoren und Bausteine der Behandlung. In der Praxis können uns verschiedene Besonderheiten des Erlebens von Patientinnen und Patienten begegnen, die einen großen Einfluss auf die Behandlungsplanung und den Behandlungsverlauf besitzen. Dazu gehören:
•Fälle, in denen es kein ressourcenreiches Erleben vor Beginn der Traumatisierungen zu geben scheint bzw. dieses nicht erinnerbar ist
•Fälle, in denen komplexes traumatisches Erleben erst in höherem Lebensalter bewusst/zugänglich wird, nachdem die Person eine gewisse Lebenszeit aus ihrer Sicht beschwerdefrei lebte.
Die folgenden Fallsequenzen geben einen Einblick in diese Besonderheiten:
Wenn eine Patientin erklärt, den Schrecken kenne sie schon, solange sie denken könne und zusätzlich über Informationen von Familienmitgliedern oder weiteren Personen verfügt, die bestätigen, dass die traumatisierenden Umstände schon zurzeit ihrer Geburt oder auch vor ihrer Geburt herrschten, dann wird die Einschätzung sowie ein Rückgriff auf prätraumatische Ressourcen schwierig.
Читать дальше