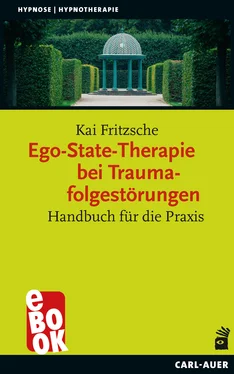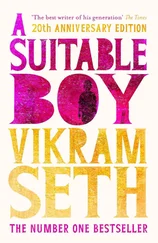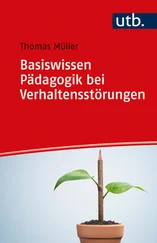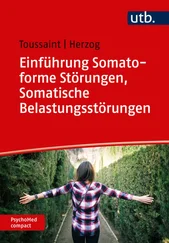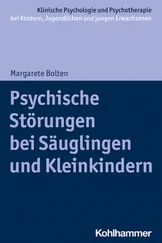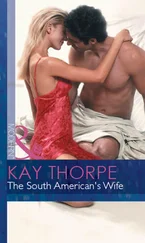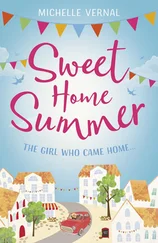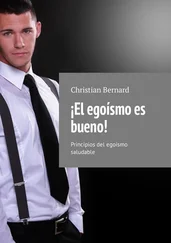1)Symptomatik
2)Ereignisse
3)Funktionsniveau und Persönlichkeit
4)Diagnostik
5)Therapiekonzepte/-verfahren
6)Prozesse und Wirkfaktoren
Die Orientierungshilfen können die psychotherapeutische Arbeit erleichtern. Sie helfen, sich einen Überblick zu verschaffen. Sie dienen noch nicht der Beantwortung von Behandlungsfragen, d. h., sie stellen noch keine konkreten Behandlungsschritte dar, die im zweiten Teil des Buches erläutert werden. Sie dienen der Handhabung einer vermeintlich schwer greifbaren Komplexität. Sie können als Einstiegshilfen sowie als Aktualisierungen genutzt werden. In vielen Punkten überschneiden sie sich. Es geht nicht darum, abgrenzbare Einheiten zu schaffen, sondern Blickrichtungen zu eröffnen und eine Verständigung zu ermöglichen.
2.1Orientierung mittels der Symptomatik von Traumafolgestörungen
In unseren Praxen, in Kliniken, Beratungsstellen und weiteren Institutionen treffen wir auf Menschen, die sich Hilfe suchend an uns wenden. Sie leiden unter Symptomen. Wir fragen in etwa: Was führt Sie zu mir? Worunter leiden Sie? Was möchten Sie verändern? Unabhängig von der schulenspezifischen Strategie der Fragen an Patienten im Erstkontakt verschaffen wir uns einen Überblick über ihre Beschwerden und Symptome. Die Symptome führen uns bestenfalls zu einem Störungsbild, für das wir fundierte Behandlungsangebote auswählen und anbieten. Das klingt wie ein praktikabler roter Faden: Symptome – Störung – Behandlung. Für einen großen Teil der Patientinnen und Patienten, die unter Traumafolgestörungen leiden, ließe sich dieser rote Faden anwenden. Sie schildern eindeutige Symptome einer Traumafolgestörung. Die Einordnung der Störung und die Erstellung eines Behandlungsplanes können zügig erfolgen und die Therapie erfolgt in der gewünschten Art und Weise.
Die Hauptsymptome der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) sind: (1) Intrusionen , (2) Vermeidung/Numbing und (3) Übererregung (Hyperarousal) . Zusätzlich (vor allem bei komplexen Traumatisierungen) finden sich: gestörte Affektregulation und Impulskontrolle, depressive Symptome, chronische Suizidalität, schwere Selbstverletzungen, Selbstwahrnehmungsstörungen, Gefühle der Hilflosigkeit, massive Antriebsarmut, Scham, Schuld, Selbstbeschuldigungen, ausgeprägter Ekel und Selbsthass (Hecker u. Maercker 2015, S. 552).
Das Feld ist trotzdem durch eine erheblich höhere Komplexität charakterisiert. Nicht alle Fälle lassen sich so leicht zuordnen, wie es hier erscheinen könnte.
Zum einen ist vielen Patientinnen und Patienten der traumatische Hintergrund ihrer Beschwerden gar nicht klar. Sie zeigen eine große Bandbreite psychischer und somatischer Beschwerden, die nicht unbedingt auf eine Traumafolgestörung hinweisen. Viele dieser Symptome lassen sich letztlich als komorbide Symptome beschreiben. Laut Leitlinienempfehlung 2 der S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung ICD-10: F43.1 soll beachtet werden, dass komorbide Störungen bei der Posttraumatischen Belastungsstörung eher die Regel als die Ausnahme sind (Flatten et al. 2011, S. 203). In diesen Fällen ist die Orientierung anhand der Symptome ziemlich schwierig, die Landschaft scheint vor allem vernebelt, nirgends finden sich Wegweiser und niemand sagt einem, womit man es zu tun hat.
Zum anderen kann eine spezifische Symptomatik derart hervorstechen, dass der Blick für den Hintergrund missglückt. Beispielsweise können Symptome der Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen oder Suchterkrankungen den Blick auf einen möglichen traumaassoziierten Hintergrund verbauen. Selbst wenn ein traumatischer Hintergrund auftaucht, bleiben die Fragen offen, ob er als primär anzusehen ist und die weiteren Symptome als sekundäre Störungen oder umgekehrt (Dammann u. Overkamp 2004, S. 13).
Weiterhin besteht die Charakteristik von dissoziativen Störungen als wichtigen Traumafolgestörungen (Flatten et al. 2011, S. 202) gerade darin, eine direkte Verbindung, also den Kontakt zu traumatischem Geschehen zu unterbrechen (Fritzsche 2017, S. 79 ff.; Fritzsche 2018b, 119 ff.). Für die klinische Praxis bedeutet dies, dass wir auf Patientinnen und Patienten treffen, die unter einer Traumafolgestörung leiden, jedoch kein typisches PTBS-Störungsbild aufweisen. Beispielsweise können sie kein traumatisches Ereignis nennen. Sie erinnern nichts dergleichen. Wir können insofern zwei Patientengruppen unterscheiden: die Gruppe mit deutlichen und typischen Symptomen von Traumafolgestörungen (beispielsweise der PTBS) und die Gruppe mit einem eher diffusen, unklaren Symptombild, in dem ein traumatischer Hintergrund vorerst fehlt bzw. nicht vonseiten der Patienten benennbar ist.
Für die zweite Gruppe möchte ich zwei kurze Beispiele schildern. Eine Patientin wandte sich mit dem Anliegen an mich, einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen zu erhalten. Sie schilderte eine absolut unproblematische Kindheit und konnte sich ihre Schwierigkeiten nicht erklären. Im Behandlungsverlauf stellte sich eine komplexe dissoziative Störung heraus, die u. a. beinhaltete, dass der bewusste Zugang zu langjährigen sexuellen Traumatisierungen unterbunden blieb. In einem weiteren Fall stand die massive Alkoholsucht eines Patienten im Vordergrund. Mehrere zurückliegende stationäre und ambulante Behandlungsversuche waren gescheitert. Im Behandlungsverlauf wurde die Funktionalität des Alkoholkonsums als bisher einzig wirksame Bewältigungsstrategie im Umgang mit jahrelang anhaltenden Traumafolgen deutlich. Die Beispiele sollen nicht dafür sprechen, dass hinter jeder psychischen und somatischen Störung eine Traumatisierung verborgen liegt. Sie sollen vielmehr dafür sensibilisieren, dass uns viele Patienten mit einem unklaren Symptombild begegnen.
Von welchen typischen Symptomen sprechen wir? Lotzin, Mauer und Köllner erstellten eine Übersicht über die Symptomkriterien der »spezifisch belastungsbezogenen psychischen Störungen« nach ICD-11 mit den Kategorien: Störung nach ICD-11, Stressor, Symptomkriterien nach ICD-11 und Zeitkriterium nach ICD-11 (Lotzin, Mauer u. Köllner 2019, S. 33). Im Folgenden werden die Störungen und Symptomkriterien aufgeführt.
Neben den hier aufgeführten Störungen sind in der S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung ICD-10: F43.1 weitere Traumafolgestörungen sowie weitere Störungen, bei denen traumatische Belastungen maßgeblich mitbedingend sind, aufgeführt (Flatten et al. 2011, S. 202):
•akute Belastungsreaktion (wird im ICD-11 nicht mehr als Diagnosekategorie, d. h. als psychische Erkrankung aufgeführt; Lotzin, Mauer u. Köllner 2019, S. 35)
•andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung
•dissoziative Störungsbilder
•somatoforme Schmerzstörung
•emotional instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline)
•dissoziative Persönlichkeitsstörung
•Essstörungen
•affektive Störungen
•Substanzabhängigkeit
•somatoforme Störungen
•körperliche Erkrankungen
| Übersicht über die Symptomkriterien der »spezifisch belastungsbezogenen psychischen Störungen« nach ICD-11 |
| Störung nach ICD-11 |
Symptomkriterien nach ICD-11 |
| PTBS |
•Wiedererleben •Vermeidung von Gedanken und Aktivitäten, die an das Ereignis erinnern •anhaltendes Gefühl einer erhöhten aktuellen Bedrohung |
| Komplexe PTBS |
•Wiedererleben •Vermeidung von Gedanken und Aktivitäten, die an das Ereignis erinnern •anhaltendes Gefühl einer erhöhten aktuellen Bedrohung •Schwierigkeiten in der Emotionsregulation •negative persönliche Grundüberzeugungen •Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten oder sich anderen nahe zu fühlen |
| Anhaltende Trauerstörung |
•intensive Sehnsucht nach dem Verstorbenen •gedankliches Verhaftet-Sein mit dem Verstorbenen oder den Todesumständen, begleitet von tiefem emotionalem Leid |
| Anpassungsstörung |
•Beschäftigung mit dem belastenden Ereignis oder seinen Folgen, einschließlich übertriebenes sich Sorgen, wiederkehrende belastende Gedanken an das Ereignis oder Grübeln über seine Auswirkungen •mangelnde Anpassung an die veränderte Lebenssituation |
| Reaktive Bindungsstörung |
•keine Zuwendung zur Fürsorgeperson, um Trost, Unterstützung und Fürsorge zu erhalten, selbst wenn eine angemessene Bindungsperson verfügbar ist •kaum Annäherungsverhalten gegenüber Erwachsenen •keine Reaktion, wenn Trost angeboten wird |
| Beziehungsstörung mit Enthemmung |
•wahllose Annäherung an Erwachsene •Fehlen von Zurückhaltung •Weggehen mit unbekannten Erwachsenen •übermäßig vertrautes Verhalten gegenüber Fremden |
Tab. 1: Übersicht über die Symptomkriterien der »spezifisch belastungsbezogenen psychischen Störungen nach ICD-11« (Auszug aus: Lotzin, Mauer u. Köllner 2019, S. 33)
Читать дальше