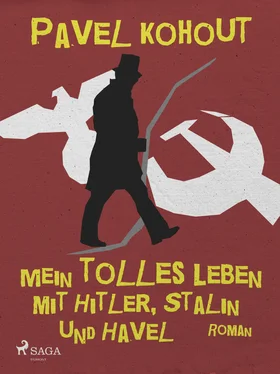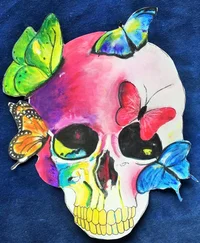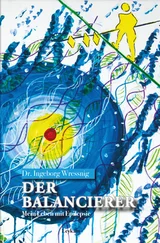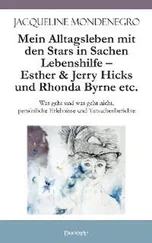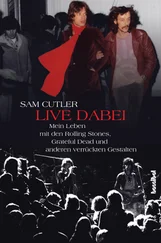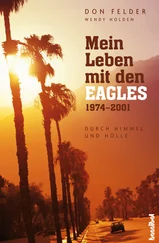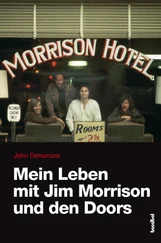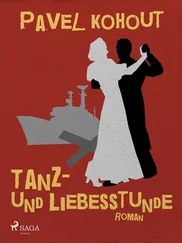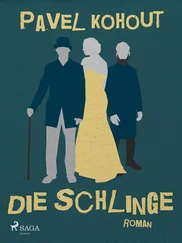Was den schulischen Fortgang betrifft, so entsprach er der Formel ›Einzelkind aus guter Familie‹: Im Zeugnis lauter Einsen bis auf zwei Zweien, im Turnen und im Zeichnen. Das letztere Fach entwickelte sich zu einem wahren Leidensweg in der Prima des Realgymnasiums, wo sie der aufbrausende Professor F. X. Böhm unterrichtete. Er fühlte sich nicht nur, wie es seine Initialen andeuteten, als Künstler, sondern er besaß auch ein Patent für teure Malstifte, die sich »Efixböhms« nannten und die nur risikofreudige Eltern ihren Sprösslingen sich vorzuenthalten trauten. Zu solchen gehörte auch die Mutter des Jungen, die an die Gerechtigkeit glaubte. Als sie sah, wie ihr Kleiner zum fünften Mal verzweifelt eine griechische Amphore malte, weil der schreckliche Mann alle vorherigen Versuche durchgestrichen hatte, veranlasste dieses Unrecht sie dazu, sich dem Lehrer, allen flehentlichen Bitten des Sohnes zum Trotz, vor dem Unterricht in den Weg zu stellen. Auf dem Gehsteig vor der Schule sahen Dutzende wartender Schüler, wie der Pädagoge mit einem neuen Kunstwerk über seinem Kopf wedelte und dabei rief: »Gnädige Frau, das ist keine Amphore, das ist ein Arsch!« Der Himmel sollte es dem armen Jungen damit vergelten, dass er dereinst für das Gebiet der bildenden Kunst einen Malersohn haben wird.
Die Höllenangst vor jeder Stunde in der Turnhalle, wo sich nicht nur die Ringe, der Bock, der Kasten und der Balken in Folterwerkzeuge verwandelten, sondern auch eine gewöhnliche, vom Schweiß tausender Leiber bis in die letzte Faser verhärtete Matte, auf der er keine Rolle schaffte, führte zu einem überraschenden Ende: Der kleine Junge entschied sich, kein Kümmerling mehr zu sein. Seine sportliche Karriere nahm er auf dem Sportplatz der Schule in Angriff, wo er ganz allein nach dem Unterricht die Latte beharrlich immer wieder auf die Ständer legte und sich in den Sand fallen ließ, der auch noch zu Hause von ihm herabrieselte, so lange, bis er sich am Ende des Frühlings von einhundert Zentimetern auf einhundertunddreißig hochschwingen konnte. Im Herbst begann er Schlittschuh zu laufen, und weil das Eisstadion zu teuer war, lief er am liebsten auf der Moldau, die vor dem Bau der Staudamm-Kaskade so dick zufror, dass schwere Walachen Pritschenwagen mit Fässern aus der Brauerei in Smíchov über das Eis an das rechte Ufer und aus der konkurrierenden Brauerei in Braník wieder zu den Trinkern an das linke Ufer schleppten. Zur gleichen Zeit begann er auch Ski zu fahren. Die Bretter schnallte er sich direkt vor Onkel Emans Haus mit Riemen an gefütterte Schuhe, rutschte auf ihnen über die Gleise der Linie 11 und stieg gleich den freien Hügel hinauf, wo er durch menschenleeres Terrain im Schuss bis ins Tal hinabfuhr; eines Tages werden auf dieser Piste einhunderttausend Prager wohnen. Wie jeden Skifahrer kostete ihn damals diese eine Minute glückseligen Flugs eine Viertelstunde beschwerlichen Anstiegs. Im Jahr darauf spielte er schon Eishockey. Auf den Wendepunkt all dieser Bemühungen, den Sturzflug auf Skiern in Harrachov, wird man noch rechtzeitig zu sprechen kommen. Der Gipfel besteht in der Entscheidung des Sechzigjährigen, täglich ausgiebig zu turnen und die Einheiten mit jedem weiteren Jahr – zu verringern? Falsch, zu erhöhen! Der Kümmerling würde staunen.
Eine Kette von Krankheiten und Operationen in Verbindung mit dem Spott der mitleidslosen Altersgenossen führte dazu, dass sein Minderwertigkeitsgefühl wuchs und er sich häufig in die Einsamkeit flüchtete. Damit überhaupt jemand mit ihrem armen Jungen sprach, wenn sich schon niemand danach sehnte, mit ihm befreundet zu sein, lud seine Mutter einmal in der Woche selbst zu einem nicht allzu reich gedeckten Tisch die noch ärmeren Mitschüler aus der Holzbarackenkolonie ein, die dort stand, wo sich heute das nun schon wieder veraltete postmoderne Hotel Diplomat neben dem immer noch modernen Gymnasium aus den dreißiger Jahren befindet.
Die armen Jungs verschlangen das Mittagessen, packten ihre Schildmützen und rannten dann hinaus, um sich über Erdhügel, Löcher und Gräben zu den riesigen, damals noch unbebauten Parzellen zu schleichen; dem kleinen Jungen blieben wieder nur Bücher und Schreibblöcke übrig. Damit versorgten ihn seine Eltern fleißig. Aus der bekannten Reihe Bastel es dir selbst! kaufte ihm sein Vater den Band Mach dir deine eigene Zeitung! Als ihm der Sohn dann feierlich die maschinengeschriebene Ausgabe der Zeitschrift »Studiosus« vorstellte, besorgte er ihm auch eine kleine Vervielfältigungsmaschine. Diese funktionierte mit Matrizenfolien, in welche die Schreibmaschine ohne Schreibband die Buchstaben ›setzte‹ und sie so perforierte. Die Seiten wurden auf eine Walze gespannt, die die Farbe auf das Papier durchdrückte – die Mutter war am Verzweifeln, dass sie auf jeglichem Textil wie Pech und Schwefel hielt! Die Matrize ließ erst nach sechzig Umdrehungen nach, eine ausreichende Auflage für die ganze Klasse und die Verwandten, die allerdings als Vorläufer künftiger Sponsoren für diese einzigartige Drucksache blechen mussten. Die Korrekturzeichen, aus jener lehrreichen Publikation übernommen, werden den angehenden Literaten das ganze Leben lang begleiten, wurden daher auch beim Anfertigen dieses Schriftstücks benützt.
Die Bücher führten dazu, dass der Junge, der endlich robuster wurde, zum Glück rechtzeitig ein weiteres Unvermögen in sich entdeckte. Unweit seiner Wohnung hatte ein Buchhändler seinen Laden, den er gerne besuchte, da jener für einen Pappenstiel zerfledderte Romanhefte, Detektivfälle von Charlie Chan und Kriegsabenteuer des Piloten Biggles anbot. Diese Erinnerung taucht auch heute noch auf, wenn jemand über die Kinder zetert, welche den Schund der Gegenwart, vor allem den des Fernsehens, gierig in sich aufnehmen; kaum einer konsumierte mehr Mist als unser kleiner Junge, und siehe da, schon zweimal fand er Eingang in die Lesebücher und schon einmal wurde er aus ihnen wieder gestrichen! In dem kleinen Laden tauchte plötzlich ein volles Regal mit gut erhaltenen Büchlein im sogenannten Kolibriformat auf, welche die Lebensbeschreibungen tschechischer Geistesgrößen enthielten. Als der Buchhändler das Interesse des Kleinen wahrnahm, bot er an, ihm alle auf Lager befindlichen Exemplare für lediglich zwei Kronen zu verkaufen, damit er sie begierigen Schülern für fünf Kronen weiterverkauft, folglich mit einem Gewinn von hundertundfünfzig Prozent. Der künftige Unternehmer leerte voller Eifer seine Sparbüchse, wo er sein Taschengeld hortete, damals schon sieben Kronen pro Woche und dazu verschiedene Prämien für kleine Gefälligkeitsdienste oder etwaige Schulerfolge. Seine hundert Exemplare schaute er dann zu Hause gebannt wie eine Lebensversicherung an, eigentlich wollte er sich von ihnen gar nicht trennen. Er musste es auch nicht. Er verkaufte kein einziges, auch wenn er sie letztendlich aus Verzweiflung für jeweils eine Krone anbot! Von da an war ihm wiederum ein für allemal klar, dass er sich niemals seinen Lebensunterhalt durchs Geschäftemachen verdienen könnte.
Der Vater musste auch ein ausgezeichneter Pädagoge gewesen sein, da der Sohn einige seiner Anweisungen, Ratschläge und Sprüche erfolgreich seinem Sohn und noch dem Sohn seines Sohnes vermachen wird. Auch sie werden den Frauen in den Mantel helfen. Auch sie werden beim Trinken unbeirrt zwei Grundregeln einhalten – stets dabei mäßig zu essen und niemals den Geist unter den Alkoholspiegel sinken zu lassen, also darauf zu achten, noch denken und sprechen zu können. Weil der Junge ferner ein Aufschneider war, der häufig den Pluralis majestatis benützte, um sich als Erster unter Gleichen erkennbar zu machen, widmete ihm sein Vater folgendes Gleichnis: Auf der Moldau schwimmen die Äpfel und dazwischen wird ein Scheißhäufchen angeschwemmt; als sich alle gemeinsam der Karlsbrücke nähern, von wo aus einige Leute auf den Fluss schauen, fängt das Scheißhäufchen an, begeistert zu winken und zu rufen: »Wir Äpfel schwimmen!«
Читать дальше