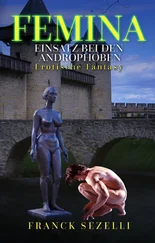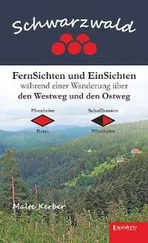Jenny Schuckardt - Einsatz über den Wolken
Здесь есть возможность читать онлайн «Jenny Schuckardt - Einsatz über den Wolken» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Einsatz über den Wolken
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Einsatz über den Wolken: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einsatz über den Wolken»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Einsatz über den Wolken — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einsatz über den Wolken», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Der Motor begann bereits merklich rauer zu laufen, jeden Moment war mit einem Kolbenfresser zu rechen. Angespannt bis zum Äußersten flog ich über von Bombentrichtern übersätes Land. Und dann war es vorbei. Der Motor würgte und blieb stehen, meine Me 109 wurde in knapp zwanzig Meter Höhe zum Segelflugzeug. Der Angstschweiß brach mir aus. Denn unser aller größter Albtraum war die Vorstellung, in russische Gefangenschaft zu geraten. Und ich war gerade kurz davor, den Russen direkt vor die Füße zu fallen.
Mit dem letzten bisschen Fahrt versuchte ich meine Maschine etwas hochzuziehen und ein wenig Zeit zu gewinnen, um einen geeigneten Fleck für die unmittelbar bevorstehende Bauchlandung zu suchen, auch auf die Gefahr hin, dem Feind eine noch bessere Zielscheibe zu bieten. Besser tot als in Gefangenschaft. Und runter! Ich warf das Kabinendach ab, und zwischen Bombentrichtern legte ich den Flieger dann mit der geringstmöglichsten Fahrt auf den Bauch.
Kaum war meine Me 109 zum Stillstand gekommen, detonierten auch schon die ersten Granaten in meiner Nähe. Oh Gott! Bitte nicht! Nichts wie weg hier! Hastig kletterte ich aus der Maschine, um Deckung zu suchen – möglichst weit weg. Laufen, hinschmeißen, warten und wieder sprinten, so wie man es uns damals in der Grundausbildung beigebracht hatte.
Die Einschläge rückten näher. Da tauchten auf einmal Soldaten vor mir auf. In der Staubwolke war nicht klar zu erkennen, ob es sich um Deutsche oder Russen handelte. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Das war’s also! Reflexartig zog ich meine Dienstpistole. Eigentlich lächerlich, denn was kann man schon mit einer Faustfeuerwaffe gegen Sturmgewehre ausrichten? Aber egal, lebend sollten mich die Russen nicht bekommen. Ein kurzer Moment der Stille, in der ich nur mein Herz klopfen hörte. Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten. Plötzlich erkannte ich die Stimmen: Es waren Deutsche.

Auf meiner Me 109 beim JG3 in Russland
»Nicht schießen, Leute! Hier bin ich, nicht schießen!«, brüllte ich so laut ich nur konnte und hob vorsichtig die Hand.
Ein mutiger Landser sprang in meinen Bombentrichter. Gott, was war ich erleichtert! Ich hätte ihn knutschen können.
»Sind Sie verwundet?«, wollte er wissen.
Ich verneinte und fragte ihn, ob wir uns auf deutscher Seite befinden würden. Denn ich hatte in diesem Moment vollkommen die Orientierung verloren.
»Der Russe startet gerade auf breiter Front eine Großoffensive«, erklärte mir der Unteroffizier knapp. Der Frontverlauf sei ihm daher auch nicht klar.
Den Überblick über die jeweils aktuelle Lage zu behalten, war in dieser Phase des Krieges nicht einfach. Die Alliierten eroberten unsere Flugplätze und nutzten sie häufig selbst, während wir von Behelfspisten irgendwo in der Pampa operieren mussten.
Mit einer Handbewegung gab mir der Unteroffizier zu verstehen, ihm zu folgen. Wir sprangen aus dem Trichter und rannten um unser Leben. Schließlich schafften wir es zu einem Gefechtsstand, von dem aus es möglich war, eine Telefonverbindung herzustellen. Ich meldete mein Missgeschick, und mein Staffelkapitän schickte sofort unseren Fieseler Storch, der für solche Fälle beim Geschwader bereitstand, um mich rauszuholen.
Der Bataillonskommandeur, der diesen Frontabschnitt führte, sicherte eine Landefläche, um die Landestelle zu schützen, in der Hoffnung, meine nur leicht beschädigte Me 109 zu bergen. Ob das gelungen ist, habe ich nie erfahren, denn kaum war ich zurück bei meiner Einheit, wurde diese auch schon wieder verlegt.
Gefährlicher Crash auf der Hallig
Unter dem Codenamen »Operation Gomorrha« starteten Briten und US-Amerikaner im Juli 1943 eine Reihe von schweren Luftangriffen auf Hamburg, nachts die Engländer, tagsüber die Amerikaner. In der Nacht vom 24. auf den 25. Juli kurz vor Mitternacht näherten sich Tausende Bomber der Küste. Die deutschen Nachtjagdflieger waren von der gewaltigen Übermacht am Himmel völlig überrascht, und auch am Tag versagte die deutsche Luftverteidigung.
Es waren die bis dato schwersten Angriffe in der Geschichte des Luftkrieges. Begünstigt durch besondere Witterungsbedingungen entfachten diese Flächenbombardements insbesondere in den östlichen Stadtteilen einen fürchterlichen Feuersturm, dem schätzungsweise 34 000 Menschen zum Opfer fielen.
Nach diesem verheerenden Angriff auf die Hansestadt wurden wir am 2. August 1943 zur Heimatluftverteidigung nach Holland verlegt. Die Verlegung unseres Geschwaders nach Westen zur Reichsverteidigung war eine bedeutende Veränderung, die uns den Ernst der militärischen Lage ahnen ließ. Wir waren gerade mit nagelneuen Me 109 G ausgerüstet worden, von uns »die Beule« genannt. Diese Maschinen sollten dann auch an die Rumänen, unsere Verbündeten, geliefert werden.
Am 12. September landeten wir in Schiphol, südlich von Amsterdam. Von hier wurden wir zur Reichsluftverteidigung eingesetzt. Unser Einsatz im Westen wurde zu einem Debakel: Unsere Verluste betrugen 23 Gefallene und zehn Verwundete. Zwar konnten wir 46 Abschüsse verzeichnen, verloren dabei aber 49 Flugzeuge. Auch ich sollte einige unangenehme Erfahrungen machen.
Es war am Morgen des 18. Oktober 1943, einem Montag. Diesig und wolkenverhangen kroch der Tag herauf. Dichter Nebel hatte sich über den Anlagen von Schiphol gebildet, als plötzlich Alarmstart befohlen wurde. Der Start erfolgte bei dicker Suppe in Rotten, also zu jeweils zwei Maschinen, das Sammeln sollte dann über der Wolkendecke geschehen. Mit einiger Mühe wegen des dichten Nebels fanden wir uns zum lockeren Verband zusammen, und die Einsatzleitung dirigierte uns nordwärts, einem Verband amerikanischer Viermotoriger vom Typ B-24 Liberator entgegen, den wir aber trotz langen Suchens nicht zu Gesicht bekamen.
Die Zeit verstrich, und der Brennstoff in meiner Me 109 wurde immer weniger. Zusatzbehälter, die Tropfentanks unter dem Rumpf, waren zwar schon lange beantragt, aber bis dato nicht eingetroffen. Unverrichteter Dinge mussten wir daher bald den Rückflug Richtung Holland antreten, und das Bild, das sich uns da bot, war alles andere als ermutigend. Ganz Holland, Belgien und Nordwestdeutschland lagen unter einer geschlossenen Nebeldecke, eine regelrechte Waschküche, und die »Suppe« lag vermutlich immer noch auf, wie wir sie verlassen hatten. Als wir nach der Zeitberechnung die Küste erreichten, waren wir schon eine ganze Weile im dichten Nebel im Sinkflug. Das rote Lämpchen der Brennstoffwarnanzeige hatte schon längst über England aufgeleuchtet. Das bedeutete, nur noch Sprit für zwanzig Minuten.
»Das kann ja heiter werden!«, dachte ich mit einem Anflug von Panik. Und so wurde es auch: Ein Durchstoßen im Verband hätte bei dem am Boden aufliegenden Nebel zur Katastrophe geführt. Daher ließen die Staffelkapitäne einem jeden freie Hand in der Wahl ihrer Mittel, runterzukommen – in letzter Konsequenz: die Maschine zu opfern und den Fallschirm zu benutzen.
Was sich anschließend ereignete, waren reine Verzweiflungstaten, denn keiner war so ohne Weiteres bereit, sein Flugzeug aufzugeben und zu springen. Es ist schwer, die Empfindungen meiner Kameraden in dieser Situation wiederzugeben. So beschränke ich mich auf die Schilderung meines eigenen Erlebens.
Schon 18 Minuten lang leuchtete das rote Lämpchen, und ich war immer noch in der »dicken Suppe«. Noch zwei Minuten, und meine Me 109 würde zum Segelflugzeug werden – ein weit über zwei Tonnen schwerer Segler mit gut über 550 km/h und das im dichten Nebel. Also, Gas raus … und doch etwas tiefer an den Boden herantasten. Es war ein Blindflug mit Höhenmesseranzeige 0 Meter – ein schauriges Gefühl. Jeder noch so gefährliche Luftkampf wäre mir lieber gewesen. Vorsichtig gab ich Gas in der Hoffnung doch noch Bodensicht zu bekommen. Um höher zu steigen in der Hoffnung, das oft besungene »Löchlein vom Dienst« am Himmel in der »Waschküche« zu finden, war kein Sprit mehr da. Diesmal musste ich also runter. Erdsicht musste kommen. Wieder stand der Höhenmesser bei 0 Meter. Jeden Moment konnte es nun krachen, und dann war es aus. Aber dieser Gedanke wurde sofort verdrängt. Es hatte zu klappen! Jeden Augenblick musste der Motor stehen bleiben; aussteigen und abspringen war nun keine Option mehr.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Einsatz über den Wolken»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einsatz über den Wolken» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Einsatz über den Wolken» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.