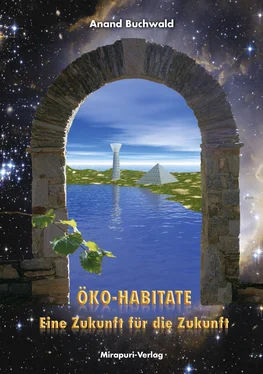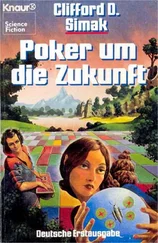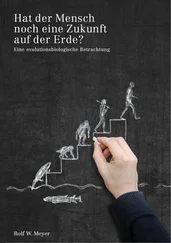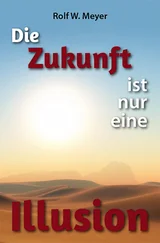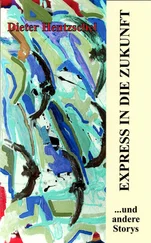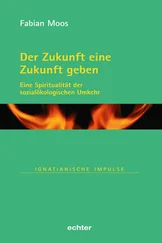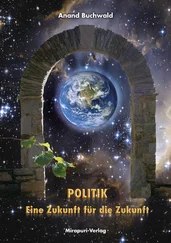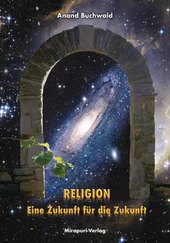Diese Letzteren sind es, die an den Schalthebeln weltlicher Macht sitzen und diese entartete Selbstzweck-Ökonomie fördern, die nicht mehr das Ganze sieht, sondern nur noch Kennzahlen, kurzfristige Gewinne und maximale Ausbeute bekannter Rohstoffe und Technologien kennt, statt das Beste für die Welt im Auge zu haben. So wird es ohne mit der Wimper zu zucken in Kauf genommen, dass Böden unfruchtbar werden, um Unkrautvertilgungsmittel und Dünger verkaufen zu können, oder dass die genetische Vielfalt der Grundnahrungsmittel zu einem konzernbestimmten Gen-Mono-Pool wird, von dem dann plötzlich Milliarden ehemals freier Menschen abhängig werden, weil sie ihr eigenes Saatgut aufgegeben haben und sich teures und nicht unbedingt gutes Hybridsaatgut nun mal nicht vermehren lässt, von Rechten, die plötzlich jemand anderes daran hat, ganz zu schweigen. Alles was in Politik und Wirtschaft unternommen wird, dient immer nur dem einen Zweck, nämlich Macht und Besitz anzuhäufeln und Abhängigkeiten zu schaffen. Und die Erde und die auf ihr lebenden Völker sind ihre Spielwiese.
Diese Menschen leben in ihrer eigenen abgeschlossenen Welt, und auch wenn sie gewisse Mechanismen und Zusammenhänge gut kennen, ist ihnen das wirkliche Leben fremd. Sie begreifen nicht, dass ihre Spielwiese unter Druck zurückschlagen kann und dass Macht und Besitz ausgesprochen vergänglich sind. Und sie begreifen auch nicht, dass man manche Dinge nicht ungeschehen machen kann, dass ihre Spielwiese die Grundlage unseres Lebens ist – Neustart ausgeschlossen.
Das bedeutet, es wird höchste Zeit, die Ökonomie zu erneuern oder ihre wahre Natur zu entdecken und zu verwirklichen. Dazu muss man wissen, was man möchte oder benötigt, denn daraus leitet sich die Natur der Ökonomie ab. Also muss man zuerst ein Ziel definieren, das mittels der Ökonomie erreicht werden soll. Das Ziel speist sich aus der Erkenntnis dessen, was bislang schiefgelaufen ist.
Schiefgelaufen ist, dass die Erde aufgrund ihrer schieren Größe und enormen Regenerationsfähigkeit als endlose Ressource angesehen wird, und dass die Ökonomie ein isoliertes, um nicht zu sagen elitäres Eigenleben führt, also kein Diener ist, sondern sich als Herr aufführt. Und schiefgelaufen ist außerdem, dass die Menschen sich nicht als Einheit betrachten, sondern ganz im tierischen Sinne als Konkurrenten und ihre Sichtweise darum begrenzt ist.
Die Erkenntnis, von der eine neue Ökonomie ausgehen muss ist, dass die Ressource Erde endlich ist, dass wir, trotz aller technologischen Fortschritte, auf Dauer gesehen von ihr abhängig, und ihre Pflege und Erhaltung darum vordringlich sind. Eine neue Ökonomie muss also als großes Ganzes die Erde und das Leben auf ihr, also Mensch und Natur, in den Mittelpunkt stellen. Dazu muss sie die Bedingungen optimieren, die es der Ressource erlauben, sich optimal zu entfalten.
Diese Bemühung wird dann unweigerlich zu einer weiteren Erkenntnis führen, nämlich dass Ökologie nichts anderes ist als praktizierte Ökonomie. Wir haben gesagt, dass Ökonomie die Verwaltungs- und Infrastruktur zur Bedarfsdeckung darstellt, die Bemühung um Optimierung der Beschaffung. Nichts anderes macht die Natur. Unzählige bekannte und mehrheitlich unbekannte Prozesse greifen ineinander, um jedes Lebewesen der Erde mit dem zu versorgen, was es zum Leben benötigt. Die Ökologie versucht diese Prozesse zu verstehen. Aufgabe der Ökonomie ist es, den Menschen in dieses System einzubinden, effizient und nachhaltig. Denn auch wenn der Mensch ein Kind der Natur ist, so hat er doch mit der Entwicklung des Verstandes ihre fürsorgliche Umarmung verlassen. Das ist aber kein Zurück-zur-Natur- oder Nieder-mit-dem-Verstand-Argument. Es geht nicht um einen Rückschritt, sondern um einen Fortschritt. Das mentale Element ist eine neue Errungenschaft der Natur, ein Evolutionssprung, der aber nicht in ihr Wirken integriert ist. Jede Spezies nimmt, was sie braucht, und wird von anderen in Schach gehalten, die es genauso halten. Einzig den Menschen weist niemand in seine Schranken; das kann nur er selbst, und das Instrument hierfür ist diese neue Fähigkeit, der Verstand. Es liegt an uns, so weiterzumachen wie bisher und von der Natur als Fehlentwicklung ausgemerzt zu werden oder mit unseren erwachenden Fähigkeiten, mit Herz und Verstand und stetig wachsendem Bewusstsein, zu einem Zusammenleben mit der Natur zu finden, das für beide einen Fortschritt bedeutet. Ökologie und Ökonomie sind die Wissenschaften, die wir dabei einsetzen müssen.
Nun hat Ökonomie im Speziellen auch noch, auf menschlicher Ebene, die Bedeutung der Geld- und Warenwirtschaft, und auf den ersten Blick scheint man das Duo Ökologie/Neue Ökonomie mit der monetären Ökonomie nicht in Einklang bringen zu können. Auf Gifte und Kunstdünger zu verzichten, bringt Produktionseinbußen, bestehende Kraftwerke abzuschalten und kurzfristig neue Technologien zur Energiegewinnung heranzuziehen, belastet die Volkswirtschaft, und Umstellungen in der Ernährung (mehr pflanzliche, weniger tierische Nahrung) sowie Konsumeinschränkungen werden die Menschen kaum freiwillig und frohgemut hinnehmen, von empfindlichen Börsenreaktionen auf verordnete Veränderungen mal ganz abgesehen. Aber das sind alles kurzfristige Überlegungen. Die Neue Ökonomie denkt langfristig, und langfristig ist letztlich alles machbar, man benötigt nur einen klaren Blick für das, was nötig ist, und man muss es vor allem wollen.
Nehmen wir zum Beispiel die gefährdete Bienenpopulation. Niemand weiß genau, was das beginnende Bienensterben verursacht. Die Varroa-Milbe ist sicherlich nur ein Teil davon. Ein anderer Teil ist wahrscheinlich die Belastung der Bienen mit den verschiedensten gefährlichen Substanzen, von denen vielleicht sogar jede unter den ohnehin dubiosen Grenzwerten liegt, die aber in ihrer Gesamtheit, Abbauprodukten, Interaktion und beträchtlicher Einwirkungsdauer in ihren Auswirkungen nicht zu kalkulieren sind. Nun hängt, vom Getreideanbau abgesehen, fast die gesamte Nahrungsmittelproduktion von den Bienen ab. Sollten die Bienenvölker drastisch zurückgehen oder gar aussterben, dann hat das Auswirkungen, die heftiger sind als jede Ölkrise, denn es gibt keine Technologie, welche die Arbeit der Bienen global ersetzen könnte. Und die Auswirkungen betreffen nicht nur den Anbau von Nutzpflanzen (da kann man mit massivem Einsatz von Arbeitskräften zumindest die Saatgutgewinnung sicherstellen, wenn auch nicht die Ernte von Obst und Fruchtgemüsen), sondern die Erhaltung aller Pflanzen, die auf Bienenbestäubung angewiesen sind, die Bäume, Blumen, Sträucher und Kräuter. Das ist ein Schaden, der sich in Geld nicht beziffern und vor allem auch mit Geld nicht ausgleichen lässt.
Und genauso wenig lassen sich die anderen stetig wachsenden Schäden mit Geld oder der dadurch finanzierbaren Technologie ausgleichen, seien es unfruchtbare Böden, ein ausgezehrter Genpool, an Kunststoffmüll eingehendes Meeresleben, ausgerottete Fischbestände, unfruchtbar gewirtschaftete Tropenböden, radioaktive Verseuchung, Klimakatastrophe... All diese Dinge kann man nicht mehr ungeschehen machen. Und all diese Dinge haben Kosten für die Volkswirtschaft und die Gesundheit zur Folge, die höher sind als der Gewinn, den unser absichtliches oder gedankenloses Fehlverhalten ermöglicht hat.
Und dieses Fehlverhalten ist manchmal wie ein Teufelskreis. In der Landwirtschaft etwa werden Herbizide, Insektizide, überzüchtete Sorten und Kunstdünger eingesetzt und das Leben auf den Feldern dadurch weitestgehend reduziert. Das Ungleichgewicht sorgt für das Auftreten von Polizei, Kriegsgewinnlern oder Plünderern (je nach Sichtweise), also zu erhöhtem Schädlingsbefall, der noch mehr Insektizide notwendig macht, gegen welche die Schädlinge immer schneller unempfindlich werden. Herbizide sorgen für eine Verminderung der Bodenfruchtbarkeit, und überzüchtete Sorten sind auf leicht verfügbaren Kunstdünger angewiesen und anfälliger für Schädlinge, so dass stärker gedüngt und gespritzt werden muss. Der ganze Chemieeinsatz verursacht Probleme, die zu noch mehr Chemie führen. Und daran verdienen einzig und allein die chemische Industrie und monopolistische Saatgutfirmen, die gerne Hand in Hand arbeiten. Dass man aus so einem Kreislauf auch ausbrechen kann, zeigen nicht nur die Biobauern, sondern auch das Beispiel einer skandinavischen Klinik, die steigende Resistenzen von Klinikkeimen, an denen nicht wenige Patienten erkranken, erfolgreich durch Verminderung des Antibiotika-Einsatzes bekämpft und damit das Konzept der De-Eskalation angewandt hatte.
Читать дальше