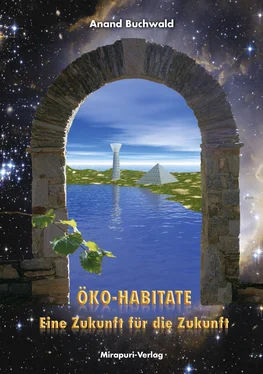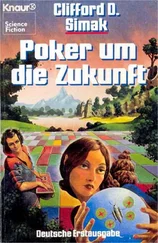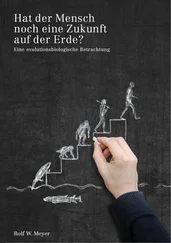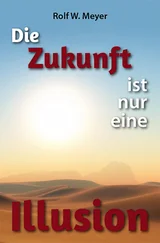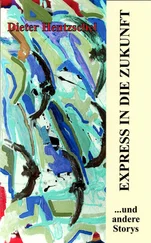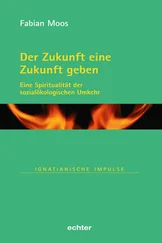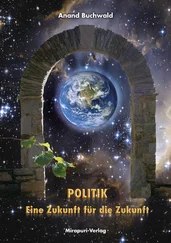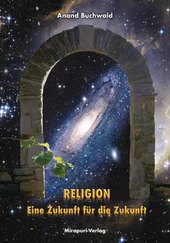Aber trotz all dieser Fähigkeiten ist der Mensch noch nicht der wahre Mensch, der die Möglichkeiten, die in ihm stecken, ausgeschöpft hat. Der Mensch ist immer noch eine tierische Spezies, die all diese wunderbaren Fähigkeiten wie ein Tier anwendet – oder schlimmer. Mit all diesen Fähigkeiten ist es ihm gelungen, Fallen zu bauen, um Tiere zu fangen, gegen die er eigentlich keine Chance hätte, und Waffen, um sich zu verteidigen. Er hat Getreide angebaut und verbessert, um nicht von Zufallsfunden abhängig zu sein. Er hat sich Kleidung gemacht und Häuser gebaut, um in jedem noch so tödlichen Klima überleben zu können. Doch dabei ist es nicht geblieben. Von einer Spezies unter vielen ist er zur dominierenden Spezies geworden, die von anderen nicht mehr im Zaum gehalten werden kann und die damit über dem natürlichen Gleichgewicht steht, also keinen Gegenpol hat. Der Mensch kann im Grunde genommen machen, was er will, weil es keine Macht gibt, die ihm irgendwie Einhalt gebieten könnte.
Alles, was der Mensch macht, macht er nicht nur, weil er es braucht, sondern auch, weil er es kann oder weil er sich einen zukünftigen, nur scheinbar materiellen Nutzen verspricht (Geld) oder um seine Stellung als möglicher Herdenprimus zu stärken (Macht) oder weil er glaubt, damit mehr Chancen auf Fortpflanzung zu haben (Sex). Was den Menschen bewegt, hat seine Wurzeln also in seinem tierischen Erbe. Die meisten Tiere töten, um ihre Ernährung sicherzustellen, und kämpfen direkt um das Amt an der Spitze und das Recht auf Fortpflanzung. Der Mensch benutzt dazu seine mannigfachen Fähigkeiten, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste und ohne aufzuhören, wenn er sein Ziel erreicht hat.
Wir haben also jetzt den Menschen mit seinen überragenden Fähigkeiten, die er in tierischem Getriebensein ausschließlich für seine eigene Befriedigung einsetzt. Im sogenannten natürlichen Gleichgewicht hat jede Spezies ihren Platz und nimmt und gibt dementsprechend. Und diese, wenn auch nicht bewusste, Zusammenarbeit hat nun schon über viele Hundert Millionen Jahre Bestand. Der Mensch ist die erste Spezies, die sich, zumindest in etwa den letzten zehntausend Jahren, zunehmend aus diesem Zusammenspiel gelöst hat.
Durch zunehmend besseres medizinisches Wissen ist die Kindersterblichkeit immer weiter zurückgegangen. Dass dies bei gleichbleibenden Geburtenraten zu einem exponentiellen Bevölkerungswachstum führt, sollte eigentlich seit den mathematischen Erkenntnissen der Antike kein Geheimnis mehr sein. Aber die Tiernatur des Menschen kennt dafür kein Regulativ, und die meisten Menschen folgen lieber ihren Instinkten als dem Verstand. Und erst in jüngster Zeit hat, vor allem in den westlich geprägten Gesellschaften, die Kombination aus Verhütungsmitteln, Bewusstwerdung und Bequemlichkeit einen regulierenden Einfluss.
Man kann also sehen, dass das Wissen da ist, aber ohne einen handfesten Grund wird es nicht eingesetzt werden. Und selbst mit einem Grund wird es üblicherweise ziemlich lange dauern, bis eine konkrete, wenn auch meist eher halbherzige Bemühung daraus erwächst. Und so ist die Stärke des Menschen auch seine Schwäche. Das, was ihn als Spezies groß gemacht hat, hat auch das Potenzial, ihn zu vernichten: seine Fähigkeit, auf die Natur Einfluss zu nehmen.
Viele Jahrtausende lang hat der Mensch sich ungestraft praktisch unbegrenzt ausbreiten können. Er hat dabei seine unmittelbare und zunehmend auch weitere Umgebung in immer größerem Maße geformt. Und er hat dabei feststellen müssen, dass er nicht unbegrenzt in die Ökologie des Planeten eingreifen kann. Als Schottland und der Balkan für den Bau von Schlachtschiffen abgeholzt wurden, wurden die jeweiligen Ökosysteme massiv geschädigt, und Erosion wie auch Schaf- und Ziegenzucht verhinderten nachhaltig eine Regeneration der Landschaft. Andere Landschaften wurden durch Versalzung infolge künstlicher Bewässerung unbewohnbar, und die Sahara wächst auch nicht nur wegen klimatischer Veränderungen, und Spanien wird wegen fehlgeleiteter Landwirtschaft und kurzfristigem Gewinnstreben bald zur Wüste, wahrscheinlich gleichzeitig mit der amerikanischen Kornkammer. Und die südamerikanische grüne Lunge und Klimamaschine Regenwald wird für kurzfristigen Sojaanbau auf schnell unfruchtbar werdenden Tropenböden abgeholzt. Hinzu kommt eine weltweit seit über hundert Jahren zunehmende Umweltverschmutzung, die unser Klima, und das globale Ökosystem insgesamt, extrem gefährdet. Der Anstieg des Meeresspiegels und noch zunehmende Hungerkatastrophen sind abzusehen, aber immer noch dominiert kleinkariertes Gewinn- und Machtstreben gegen den aktiven Einsatz für unser fragiles Ökosystem, buchstäblich nach dem Motto: „Nach uns die Sintflut!“
Wenn sich an dieser Situation etwas ändern soll, dann sind grundlegende Änderungen notwendig. Es nützt nichts, an Teilaspekten herumzulaborieren, während sich vielleicht unbemerkt die nächste Katastrophe anbahnt. Wenn man wirklich etwas ändern will, dann muss man darangehen, das Wachstum einer neuen Welt mit neuen Menschen zu fördern. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen – das wird viele Generationen dauern, und es wird viel Geld kosten. Aber wenn wir nicht gleich beginnen, wird es nie so weit kommen.
Das Wort Öko dient zwar eigentlich nur als Abkürzung für Ökologie, aber man kann es doch auch für Ökonomie verwenden, auch wenn die beiden immer wie feindliche Brüder gegeneinander ausgespielt werden und als unvereinbar gelten. Dass sich die beiden nicht ansehen können, liegt vielleicht nur daran, dass sie zwei Seiten einer Münze sind. Und diese Münze ist unsere Lebenssituation auf der Erde.
Ob frühere Generationen auf diesem Planeten nun einfühlsam und bewusst mit der Natur zusammengearbeitet haben, kann man heute eigentlich nicht mehr zuverlässig sagen. Es wird wie immer solche und solche Menschen gegeben haben. Aber mit den damaligen Mitteln konnte man allenfalls mal einen Landstrich verwüsten. Man war nicht wirklich gezwungen, mit der Natur in Einklang zu leben und auf sie Rücksicht zu nehmen, weil sie einfach schneller nachwuchs, als der Mensch sie zerstören konnte. Und das Interesse für langfristige und systematische Beobachtungen setzte erst spät ein. Es gab also lange Zeit kein wirkliches ökologisches Bewusstsein. Die Bemühung um das Wissen von natürlichen Gesetzmäßigkeiten im Umgang mit Pflanze, Boden und Tier kam vermutlich erst mit dem Sesshaftwerden der bislang nomadischen Menschen in Gang. Der Grund dafür war aber nicht primär der Wunsch nach mystischem Einssein, sondern die schnöde Ökonomie.
Ökonomie bedeutet, dass man einen Bedarf für etwas hat, zum Beispiel Nahrung, und dafür sorgen muss, wie man diesen Bedarf decken kann. Zur Ökonomie gehört also die gesamte Infrastruktur, die zur Bedarfsdeckung nötig ist: Planung, Anbau, Pflege, Ernte, Verarbeitung, Verteilung, Verkehr, Geld, Tauschwaren, Angebot, Nachfrage... Wenn der Mensch sich mit der Natur beschäftigt, und wenn ihm etwas daran liegt, dass die Felder, die er mühsam gerodet und vorbereitet hat, auch nach vielen Jahren noch reichlichen Ertrag liefern, dann ist das kein primär ökologisches, sondern vor allem ein ökonomisches Interesse. Und dieses Interesse gilt nur den eigenen Feldern und nicht den Feldern der Nachbarn. Und eventuell gibt es noch ein Interesse daran, dass die Felder auch den unmittelbaren Nachkommen noch zugutekommen.
Seit die Zeiten schnelllebiger wurden und das Wertesystem von Familien-, Clan- und Stammesstrukturen sich zunehmend auflöst, schwindet auch das ohnehin nur schwache Gefühl von Verbundenheit und dass man Teil von etwas Größerem ist, um Platz zu machen für eine stärker werdende Egozentrierung und Kurzlebig- und -sichtigkeit. Wurde das Land früher noch instinktiv oder unbewusst als Teil des eigenen Lebens aufgefasst, so hat es heute mehr den Charakter einer Ressource, und zwar einer unbegrenzten Ressource, so wie auch die Lufthülle als unbegrenzte Ressource galt, in die man alles ablassen konnte. Und jetzt haben wir ein Ozonloch, eine enorme Luftverschmutzung und eine zu hohe Belastung mit Substanzen, welche die Aufheizung des Klimas fördern. Und erst jetzt, nachdem man lange Zeit untätig zugesehen hat, wie das Kind in den Brunnen fällt, beginnt man zaghaft, darüber nachzudenken, ob man der Entwicklung etwas entgegensetzen kann und will, wobei es zwei Gruppen von Menschen gibt, die dem ablehnend gegenüberstehen: das sind auf der einen Seite die Blinden und Verstockten, die nicht wahrhaben wollen, dass sich die Welt in stetigem Wandel befindet und dass jegliches Wissen nur so lange wahr ist, bis es von noch größerem Wissen überholt wird, und auf der anderen Seite die Menschen, für die Imperialismus und Kapitalismus, also Macht und Geld, die einzig wahren Götter sind.
Читать дальше